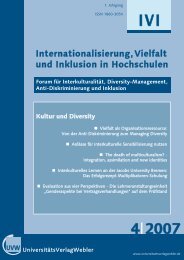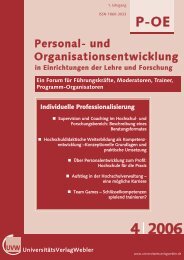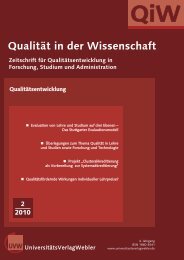QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>QiW</strong><br />
K. Hauss & M. Kaulisch • Diskussion gewandelter Zusammenhänge zwischen Promotion, ...<br />
folg gebunden ist. Das lange Zeit gepflegte Leitbild einer<br />
weitgehend auf Wissenschaftsfreiheit und Selbstkontrolle<br />
beruhenden Wissensproduktion weicht einer an quantifizierbaren<br />
Erfolgen und Leistungen orientierten Wissenschaftsphilosophie,<br />
die in der Praxis der Forscher und Forscherinnen<br />
zu einem gestiegenen Leistungsdruck und mehr<br />
Wettbewerb untereinander führt. Anreizstrukturen, wie sie<br />
beispielsweise im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe<br />
gesetzt werden, führen auf der Ebene der Hochschulen<br />
zu einem stärker wettbewerblichen Handeln und<br />
der Etablierung von Qualitätssicherungssystemen. Auf der<br />
individuellen Ebene kann dies zu Wettbewerbssituationen<br />
führen, die – wie für den Fall der biomedizinischen Forschung<br />
in den USA beschrieben – einem „Tournament“ um<br />
berufliche Unabhängigkeit und Anerkennung durch Fachkollegen<br />
gleichen, in dem geringe Unterschiede in der Produktivität<br />
Einzelner zu großen Unterschieden in der Belohnung<br />
führen können (Freeman/Weinstein/Marincola/Rosenbaum/Solomon<br />
2001). In der Folge kommt es zu veränderten<br />
Bewertungsmaßstäben im Wettbewerb um Reputation,<br />
Stellen und Ressourcen. Georg Krücken (2006) spricht<br />
in diesem Zusammenhang von einer Ablösung der sonst<br />
eher polymorphen Bewertungsstrukturen in der Wissenschaft<br />
durch standardisierte Maßstäbe in Gestalt von Publikationen<br />
und Zitationen in Zeitschriften mit hohem Impact<br />
(Krücken 2006, S. 11).<br />
Für Promovierende bedeutet dies die Sozialisation in eine<br />
Forschungspraxis, in der Leistungen und Erfolge anhand<br />
scientometrischer Größen beschrieben, evaluiert und selektiert<br />
werden. Dies trifft insbesondere für Promovierende<br />
aus Fachbereichen zu, in denen Reputation in hohem Maße<br />
über die Veröffentlichung in US-amerikanischen Fachzeitschriften<br />
erworben wird. Es ist ferner davon auszugehen,<br />
dass Promovierende zunehmend in die Publikationsaktivitäten<br />
einer wissenschaftlichen Einrichtung eingebunden<br />
und in die Pflicht genommen werden, Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen<br />
Arbeit zu veröffentlichen. Die Dissertationsschrift<br />
in Gestalt der Monographie wird in ihrer historischen<br />
Bedeutung kurz- bis mittelfristig zwar nicht einbüßen.<br />
Allerdings wird sie angesichts eines steigenden Publikationsdrucks<br />
eine unter vielen Publikationen in einer<br />
insgesamt an Bedeutung gewinnenden Publikationsliste<br />
sein. Dies mag in publikationsstärkeren Fächern schon länger<br />
Tradition haben, führt aber in anderen Fächern zu einer<br />
Verminderung des Stellenwerts der Monographie.<br />
2.3 Der wissenschaftliche Arbeitsmarkt und Karrieresysteme<br />
im Wandel? Zwei Thesen.<br />
Doch welche Folgen haben die beschriebenen Veränderungen<br />
für wissenschaftliche Arbeitsmärkte und in ihnen stattfindende<br />
Karrieren von Promovierten? Wenngleich dies nur<br />
empirisch über einen längeren Zeitraum überprüfbar ist,<br />
weisen die beobachtbaren Veränderungen in zwei entgegengesetzte<br />
Richtungen.<br />
Wissenschaftliche Arbeitsmärkte unterscheiden sich von<br />
vergleichbaren Arbeitsmärkten z.B. in der Industrie dadurch,<br />
dass sie keine ausgefeilten Karrierestrukturen aufweisen<br />
(Enders 1996; Sørensen 1992; Enders/Bornmann<br />
2001). Die Herausbildung von internen Arbeitsmärkten, die<br />
in Unternehmen Aufstiege strukturieren (vgl. Doeringer/<br />
Piore 1985) existiert in dieser vergleichbaren Form nicht für<br />
wissenschaftliche Arbeitsmärkte, in denen die Position des<br />
Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin gewissermaßen<br />
die einzige Sprosse der Karriereleiter darstellt und<br />
die Eingangsposition durch die Aufnahme einer Promotion<br />
auf einer Mitarbeiterstelle gekennzeichnet ist. Gleichzeitig<br />
fehlt die für interne Arbeitsmärkte typische Bindung des Arbeitsnehmers<br />
an die Organisation. Grund hierfür ist ein<br />
grundsätzlich verschiedenes Ressourcenmanagement:<br />
Während in klassischen Unternehmen die Produktivität<br />
eines Angestellten zum Gesamtwohl des Unternehmens,<br />
und damit zur Gesamtproduktivität beiträgt, werden individuelle<br />
Ergebnisse der Forscher und Forscherinnen nicht der<br />
Organisation, sondern dem Erzeuger von Erkenntnis selbst<br />
in Form von Reputation zugeschrieben (Sørensen 1992).<br />
Im Zuge der Stärkung der Autonomie der Hochschule,<br />
neuer Steuerungsmodelle in der Wissenschaft, durch leistungsorientierte<br />
Mittelvergabesysteme, Rankings und<br />
damit verbundene Wettbewerbszunahme unter Forschungseinrichtungen<br />
ist einerseits von einer zunehmenden<br />
institutionellen Bindung einzelner (exzellenter) Wissenschaftler<br />
und Wissenschaftlerinnen an die Forschungseinrichtungen<br />
auszugehen, wodurch es zu einer stärkeren Ausprägung<br />
von Merkmalen des internen Arbeitsmarktes<br />
kommt (vgl. Sorensen 1992). Die Leistungen einzelner Forscher<br />
und Forscherinnen werden in Evaluationen zu zentralen<br />
Erfolgskriterien in der Ressourcen- und Mittelzuweisung<br />
von wissenschaftlichen Einrichtungen. In der Folge<br />
entstehen Anreizstrukturen, die die langfristige Bindung<br />
jener Forschenden an die Einrichtung begünstigen, die Erfolge<br />
erwarten lassen. Dabei entstehen interne Arbeitsmärkte<br />
auch über die institutionelle Bindung von Forschenden,<br />
deren Stellen über wechselnde Projektträger, z.B. über<br />
aufeinander folgende Drittmittelprojekte finanziert werden.<br />
Empirisch ließe sich eine Annäherung von Karrieremustern<br />
in wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Arbeitsmärkten<br />
erwarten, die sich quantitativ in einer graduellen<br />
Annäherung in der Häufigkeit von Wechseln zwischen Organisationen<br />
zeigen sollte (vgl. Baruch/Hall 2004; Enders/<br />
Kaulisch 2005).<br />
Andererseits treffen Hochschulen Personalentscheidungen<br />
unter Markbedingungen und überantworten Risiken, die<br />
aus Marktdynamiken entstehen an ihrer Beschäftigten. Insbesondere<br />
durch die projektförmige Forschung und die Erarbeitung<br />
von Forschungs- und Promotionsvorhaben im<br />
Rahmen von Drittmittelprojekten (vgl. Hornbostel/Heise<br />
2006), findet Forschungshandeln seit längerer Zeit in befristeten<br />
Beschäftigungsverhältnissen statt. Wissenschaftliche<br />
Karrieren nehmen in der Folge die Gestalt von „Projektkarrieren“<br />
an (Torka 2006, S. 64), die sich durch häufige Wechsel<br />
zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen auszeichnen.<br />
Die für den wissenschaftlichen Arbeitsmarkt typische Rekrutierung<br />
von Experten über den externen Arbeitsmarkt,<br />
so die Erwartung, wird sich in Folge eines zunehmenden<br />
Wettbewerbs um Drittmittel verstetigen. Enders und Kaulisch<br />
(2006) weisen darauf hin, dass im Zuge einer zunehmend<br />
im globalen Raum stattfindenden Wissenschaftslandschaft<br />
mit einer größeren geographischen Mobilität unter<br />
Forschenden zu rechnen ist (Enders/Kaulisch 2006).<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
25