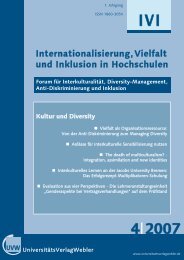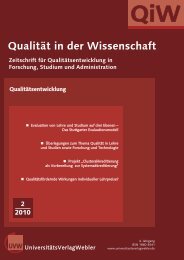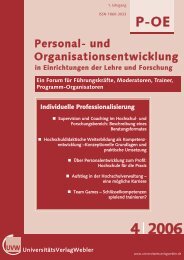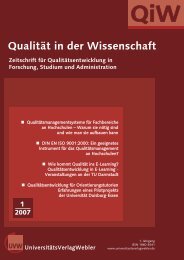QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>QiW</strong><br />
R. Krempkow • Von Zielen zu Indikatoren – Versuch einer Operationalisierung für Lehre ...<br />
verständnis der HIS-Absolventenstudien über die Befragung<br />
von Absolventen erfasst und als Mittelwerte<br />
(Index 9 ) dargestellt werden (vgl. Schaeper/Briedis<br />
2004, S. 10). Hierbei ist die begrenzte Aussagekraft<br />
von Selbsteinschätzungen zu berücksichtigen.<br />
In jedem Fall sind zur Frage des Kompetenzgewinns<br />
während des Studiums a posteriori Absolventen zu befragen<br />
(vgl. WR 2008, S. 79). Schaeper/Briedis (2004,<br />
S. 6) argumentierten hier bezüglich eines Vergleiches<br />
der verschiedenen o.g. Ansätze: „Demnach müssten<br />
objektive Messverfahren wie die Beobachtung der Bewältigung<br />
von Aufgaben in natürlichen oder quasinatürlichen<br />
Situationen oder im Rahmen von Leistungstests<br />
präferiert werden. Solchen Ansätzen, die<br />
z.B. im Rahmen von Assessment Centers oder in PISA<br />
realisiert werden, wird zwar eine hohe Validität zugesprochen,<br />
sie haben aber den Nachteil, zeitlich und finanziell<br />
sehr aufwändig zu sein. Wohl auch aus diesem<br />
Grund sind in der Praxis der Kompetenzmessung und<br />
-diagnostik subjektive Kompetenzeinschätzungs- und<br />
-beschreibungsverfahren mittels standardisierter Fragebogeninstrumente<br />
weit verbreitet. Dabei sprechen für<br />
den Einsatz solcher subjektiver Verfahren nicht nur<br />
ökonomische Gründe. Zum einen konnten verschiedene<br />
Studien einen systematischen Zusammenhang zwischen<br />
dem Selbstkonzept eigener Kompetenzen und<br />
den Ergebnissen von Leistungstests ermitteln (vgl. z. B.<br />
Klieme/Neubrand/Lüdtke 2001, S. 184 f.). Zum anderen<br />
wird auch argumentiert, dass Selbstkonzepte<br />
zukünftiges Handeln entscheidend mitstrukturieren,<br />
also handlungsleitend sind (vgl. Maag Merki/Grob<br />
2003, S. 128) und dass damit die Erhebung von Selbsturteilen<br />
eine größere prognostische Validität besitzt,<br />
als ihr oftmals zugesprochen wird. Dennoch kann nicht<br />
in Abrede gestellt werden, dass etwa Beschönigungstendenzen<br />
und mangelnde Fähigkeiten der<br />
Selbstbeurteilung die Validität und Reliabilität dieser<br />
Messinstrumente gefährden können.“ Das verwendete<br />
Befragungsinstrument „beansprucht aber (…), eine zuverlässige<br />
und gültige Messung wahrgenommener<br />
Kompetenzen und Qualifikationsanforderungen zu liefern.“<br />
(Schaeper/Briedis 2004, S. 8). Zu Zusammenhangsanalysen<br />
bezüglich Einflussfaktoren auf die Kompetenzentwicklung<br />
vgl. Minks/ Briedis (2005, S. 63f.).<br />
Wie erwähnt, werden in anderen europäischen und außereuropäischen<br />
Staaten die Ergebnisse von Absolventenbefragungen<br />
auch als Indikatoren für Wirkungen der Hochschulbildung<br />
eingesetzt. Beispielhaft für ein breiteres Verständnis<br />
von Wirkungen der Hochschulbildung als Integration<br />
in den Arbeitsmarkt unter Einschluss der benötigten<br />
berufsbezogenen Kompetenzen sollen hier die in der<br />
Schweiz verwendeten Indikatoren genannt werden (BfS<br />
2008) 9 . Dort ist von verwendeten Qualifikationen ähnlich<br />
wie in Deutschland von Kompetenzen die Rede und der<br />
vom WR (2008, S. 78f.) als fehlend bemängelte Berufserfolg<br />
wird einbezogen: Allerdings ist beim Berufserfolg nur<br />
schwer erfassbar, welchen Anteil die Hochschule daran hat.<br />
Die Interpretation ist nicht trivial (vgl. z.B. Schatz/<br />
Woschnack 2007, S. 99) und zahlreiche potentielle Einflussfaktoren<br />
können ebenfalls Wirkungen auf den Berufserfolg<br />
haben und müssen daher berücksichtigt werden (vgl. zusammenfassende<br />
Diskussion in Krempkow 2008a). Daher<br />
sollten mit diesen potentiellen Indikatoren in Deutschland<br />
zunächst Erfahrungen gesammelt und ein Modell zur<br />
Berücksichtigung unterschiedlicher Ausgangs- und Kontextbedingungen<br />
für den Berufserfolg entwickelt werden.<br />
Zum Sachziel Kompetenzerwerb zählt auch die Bereitschaft,<br />
Verantwortung gegenüber sich und anderen wahrzunehmen.<br />
Inwieweit dies den Absolventen möglich ist,<br />
kann z.B. deren Berufserfolg aufzeigen, der nach dem Stand<br />
der Absolventenforschung in mehreren Dimensionen zu erfassen<br />
ist. In jedem Fall sollten objektive und subjektive Indikatoren<br />
verwendet werden: Vgl. Reinfeld/Frings (2003, S.<br />
286), Teichler (2002, S. 13ff.), Brüderl/Reimer (2002, S.<br />
209), Enders/Bornmann (2001, S. 181), Krempkow u.a.<br />
(2000f.), Teichler/Schomburg (1997, S. 248).<br />
f-g) Kompetenzerwerb bezüglich wahrgenommener Verwendungschancen:<br />
Angemessene Qualifikation gibt<br />
Auskunft über die wahrgenommene Übereinstimmung<br />
zwischen den Anforderungen der momentanen Beschäftigung<br />
und den während des Studiums erworbenen<br />
Qualifikationen (sowohl ein Jahr wie auch 5 Jahre<br />
nach Studienabschluss). Dies ist eine Einschätzung der<br />
erwerbstätigen Absolvent/innen auf einer fünfstufigen<br />
Skala, ob sie ihre im Studium erworbenen Qualifikationen<br />
in ihrer momentanen Erwerbstätigkeit angemessen<br />
einsetzen können. Qualifikationsanforderung zeigt die<br />
Qualifikationen, welche seitens des Arbeitgebers zur<br />
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit von den Absolventinnen<br />
und Absolventen gefordert werden, ein Jahr<br />
sowie fünf Jahre nach Abschluss des Studiums. Die<br />
Qualifikationsanforderung zeigt auf, ob und wie spezifisch<br />
ein Hochschulabschluss für die Erwerbstätigkeit<br />
ein Jahr bzw. 5 Jahre nach Studienabschluss vom Arbeitgeber<br />
verlangt wurde.<br />
Zur Berechnung dieses Indikators wurde folgende Frage<br />
aus dem Fragebogen beigezogen: „Wurde für Ihre jetzige<br />
Stelle von Ihrem Arbeitgeber/in ein Hochschulstudium<br />
verlangt?” mit den folgenden Antwortkombinationen:<br />
1. Ja, ausschliesslich in meinem Studienfach, 2, Ja,<br />
auch in verwandten Fächern, 3. Ja, es wurde aber keine<br />
spezifische Studienrichtung verlangt, 4. Nein, ein Hochschulabschluss<br />
wurde nicht verlangt.<br />
Berufseintrittsquote eruiert den Anteil jener Absolvent/innen,<br />
die eine Arbeitsstelle innehaben, welche<br />
mindestens einen Hochschulabschluss erforderte, gemessen<br />
am Total der Absolvent/innen (vgl. BfS 2008).<br />
Die Daten stammen aus der Befragung der Hochschulabsolventen.<br />
Neuabsolvent/innen einer universitären<br />
Hochschule werden ca. ein Jahr nach dem Abschluss des<br />
Studiums zu ihrer Beschäftigungssituation befragt. Bei<br />
der Berufseintrittsquote kommt im Gegensatz zur Erwerbsquote<br />
eine qualitative Komponente zum Tragen.<br />
h-k) Kompetenzerwerb bezüglich Verwendungschancen im<br />
Beruf: Erwerbsquote misst den Anteil der erwerbstätigen<br />
Absolventinnen und Absolventen sowohl ein Jahr<br />
wie auch fünf Jahre nach Studienabschluss, gemessen<br />
9 Siehe URL: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06<br />
/key/ind1.approach.101.html.<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
49