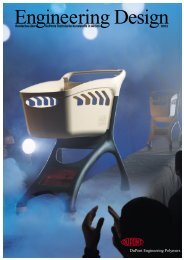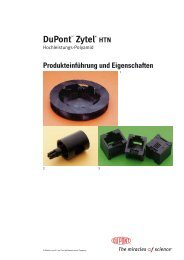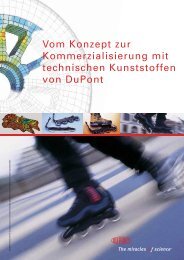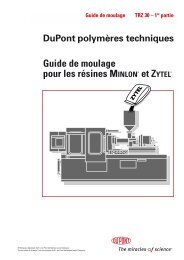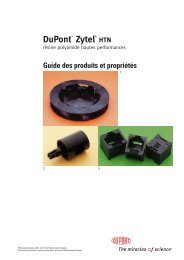Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Man darf derartige Konstruktionen nur mit größter Vorsicht<br />
und nach entsprechender Beratung durch Fachleute ausführen.<br />
Wenn man den sicheren Weg beschreiten und kein Risiko<br />
eingehen will, wählt man besser eine Lösung entsprechend<br />
Abb. 10.35. Hier ist die Doppelnaht in zwei einfache Schweißungen<br />
getrennt, die nachein<strong>and</strong>er erfolgen und bei richtiger<br />
Anpassung keine Probleme darstellen. Da bei dieser Lösung<br />
die Teile normal mit Zahnkronen angetrieben werden können,<br />
lassen sie sich leichter in eine vollautomatische Anlage<br />
einfügen. Der Gesamtaufw<strong>and</strong> ist deshalb kaum größer als<br />
für eine Doppelnaht, dagegen sind keine langwierigen und<br />
kostspieligen Vorversuche notwendig<br />
.<br />
Das Verschweißen gefüllter<br />
und verschiedenartiger Kunststoffe<br />
Gefüllte Kunststoffe lassen sich im allgemeinen ebenso gut<br />
rotationsschweißen wie ungefüllte. Wenn die Füllstoffe den<br />
Reibwert vermindern, muß unter Umständen der Schweißdruck<br />
erhöht werden, um die Abbremszeit der Schwungmasse<br />
kurz zu halten.<br />
Bei glasfasergefüllten Materialien wird die Nahtfestigkeit<br />
theoretisch kleiner, da die Glasfasern die tatsächlich verschweißte<br />
Fläche verringern. Diese Tatsache macht sich<br />
in der Praxis indessen selten bemerkbar, da der schwächste<br />
Punkt meistens ohnehin nicht in der Naht liegt. Falls erforderlich,<br />
kann das Nahtprofil etwas vergrößert werden.<br />
Glasfasern bewirken in allen Kunststoffen eine erhebliche<br />
Verkleinerung der Bruchdehnung, so daß Spannungskonzentrationen<br />
verheerend wirken. Diesem Umst<strong>and</strong> wird in der<br />
Konstruktion viel zu wenig Rechnung getragen.<br />
Gelegentlich steht man auch vor dem Problem, Kunststoffe<br />
verschiedener Gruppen und ungleicher Schmelzpunkte verschweißen<br />
zu müssen. Dies wird naturgemäß umso schwieriger,<br />
je weiter die Schmelzpunkte ausein<strong>and</strong>er liegen. Man<br />
kann in solchen Fällen nicht mehr von einer eigentlichen<br />
Verschweißung sprechen, da es sich mehr um ein mechanisches<br />
Verhängen der Oberflächen h<strong>and</strong>elt. Die Nahtfestigkeit<br />
genügt dann nur noch geringen Anforderungen. Es kann auch<br />
notwendig sein, spezielle Nahtprofile anzuwenden und mit<br />
sehr hohen Schweißdrücken arbeiten zu müssen.<br />
Die wenigen in der Praxis vorkommenden Verbindungen<br />
dieser Art betreffen indessen ausschließlich unbelastete<br />
Schweißnähte.<br />
Als typische Beispiele dieser Art kann man Ölst<strong>and</strong>sanzeiger<br />
und Schaugläser aus Polycarbonat erwähnen, die in Gehäuse<br />
aus DELRIN ® eingeschweißt werden.<br />
Nachfolgende Versuchsresultate sollen einige Anhaltspunkte<br />
über mögliche Verbindungen von DELRIN ® mit <strong>and</strong>eren Kunststoffen<br />
geben:<br />
Der in Abb. 10.13 gezeigte Schwimmer aus DELRIN ® erreicht<br />
einen Berstdruck von etwa 4 MPa.<br />
Wird eine Abschlußkappe aus einem <strong>and</strong>eren Material auf<br />
den Körper aus DELRIN ® geschweißt, so ergeben sich folgende<br />
Berstdrücke:<br />
ZYTEL ® 101 (Polyamid) 0,15–0,7 MPa<br />
PC 1,2 –1,9 MPa<br />
PMMA 2,2 –2,4 MPa<br />
ABS 1,2 –1,6 MPa<br />
Dabei ist zu beachten, daß bei allen erwähnten Verbindungen<br />
die Schweißnaht schwächer ist als die Materialfestigkeit.<br />
<strong>Rotationsschweißen</strong> von weichen<br />
Thermoplasten und Elastomeren<br />
Von wenigen Ausnahmen abgesehen (PTFE) hat ein Kunststoff<br />
einen umso höheren Reibwert, je weicher er ist.<br />
Das <strong>Rotationsschweißen</strong> wird deshalb aus drei Gründen mit<br />
zunehmender Weichheit schwieriger oder sogar unmöglich.<br />
– Der hohe Reibwert hat eine so starke Bremswirkung, daß<br />
die Schwungmasse nicht im St<strong>and</strong>e ist, durch Reibung<br />
Wärme zu erzeugen. Ein großer Teil der Energie wird<br />
durch die Deformation des Teils absorbiert, ohne daß<br />
genügend Relativbewegung auf den Schweißflächen stattfindet.<br />
Erhöht man die Energie, so riskiert man eher eine<br />
Beschädigung der Teile als eine Verbesserung der Verhältnisse.<br />
Das Problem kann manchmal so gelöst werden, daß man<br />
Schmierstoff auf die Nahtfläche sprüht (z.B. Silikon-<br />
Formtrennmittel). Dadurch wird der Reibwert zuerst sehr<br />
klein und die Drehung findet normal statt. Auf Grund der<br />
hohen spezifischen Pressung wird der Schmierstoff jedoch<br />
sehr schnell weggedrückt, wodurch der Reibwert ansteigt<br />
und das Material zum Schmelzen kommt.<br />
– Bei weichen Kunststoffen, die im Gegenteil einen sehr<br />
niedrigen Reibwert aufweisen (PTFE), müßte der spezifische<br />
Flächendruck sehr viel höher sein, um in kurzer Zeit<br />
genügend Reibwärme zu erzeugen. Die meisten Teile wären<br />
ohnehin nicht im St<strong>and</strong>e, den hohen Axialdruck ohne bleibende<br />
Deformation aufzunehmen. Für diese Kunststoffe<br />
gibt es gegenwärtig noch kein sicheres Vorgehen, um<br />
befriedigende Rotationsschweißungen zu erzeugen.<br />
– Teile aus weichen Kunststoffen können nur schwer in Aufnahmevorrichtungen<br />
festgehalten bzw. gedreht werden. Die<br />
Übertragung des hohen Drehmomentes wird deshalb ein<br />
oft unlösbares Problem, vor allem auch, weil kaum Zahnkronen<br />
verwendet werden können.<br />
Zusammenfassend kann man deshalb sagen, daß derartige<br />
Grenzfälle mit äußerster Vorsicht zu beh<strong>and</strong>eln sind, und daß<br />
die Entwicklungen entsprechende Vorversuche unumgänglich<br />
machen.<br />
Beispiele h<strong>and</strong>elsüblicher<br />
und experimenteller Schweißmaschinen<br />
Die in Abb. 10.36-10.38 gezeigten Maschinen sollen einige<br />
ausgewählte Beispiele aus der großen Zahl der in der Praxis<br />
verwendeten Schweißvorrichtungen illustrieren.<br />
107