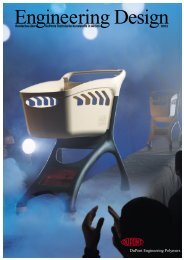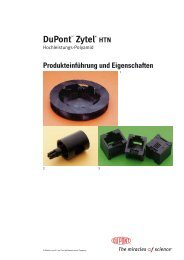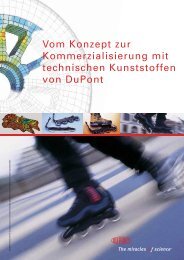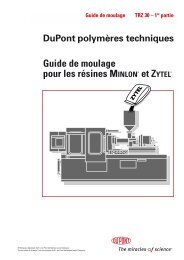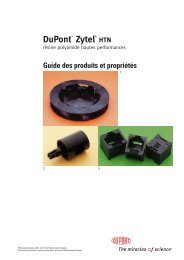Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
a<br />
b<br />
c<br />
Abb. 10.03 Vorgang des Drehzapfenschweißens<br />
Die Spitze dient also ausschließlich dazu, den Nachdruck zu<br />
erzeugen. Die Kunststoffteile sollen jedoch mit Zentrierungen<br />
versehen sein, um eine bessere Werkzeugführung und einen<br />
guten Rundlauf zu erreichen.<br />
Um eine korrekte Schweißung zu erzielen, braucht man eine<br />
gewisse, vom Kunststoff abhängige Wärmemenge. Diese ist<br />
ein Produkt aus Druck, Geschwindigkeit und Zeit. Andererseits<br />
muß das Produkt aus Druck × Geschwindigkeit einen<br />
bestimmten Minimalwert aufweisen, da sonst an der Nahtoberfläche<br />
nur Abrieb und kein genügender Temperaturanstieg<br />
auftritt. Da auch der Reibwert einen Einfluß hat, lassen sich<br />
diese Größen nicht für alle Kunststoffe allgemein angeben,<br />
sondern müssen individuell bestimmt werden.<br />
Als erste Annahme für die Umfangsgeschwindigkeit bei<br />
DELRIN ® Acetalhomopolymer und ZYTEL ® PA66 kann man<br />
rund 3-5 m/s. wählen. Dann wird man den Druck so einstellen,<br />
daß eine Schweißzeit von 2-3 Sekunden das gewünschte<br />
Resultat ergibt.<br />
Voraussetzung für gute Ergebnisse sind natürlich korrekte<br />
Nahtprofile. (Vorschläge und Dimensionen siehe Abschnitt 8).<br />
Drehzapfenschweißen mit besonders dazu gebauten Maschinen<br />
Das oben beschriebene Verfahren läßt sich nicht ohne einen<br />
gewissen Aufw<strong>and</strong> automatisieren, weshalb es für die Großproduktion<br />
kaum mehr angewendet wird.<br />
Leicht abgeändert und mit besonders dazu konstruierten<br />
Maschinen (Abb. 10.04) kann man indessen einen einfacheren<br />
Funktionsablauf erreichen.<br />
b<br />
a<br />
c<br />
d<br />
e<br />
f<br />
Abb. 10.04 Prinzip einer Drehzapfenschweißmaschine<br />
Die Maschine ist mit einer vorzugsweise elektromagnetisch<br />
betätigten Kupplung a versehen, die ein schnelles Ein- und<br />
Auskuppeln der Arbeitsspindel b gestattet. Letztere ist in<br />
einem Rohr c gelagert, das seinerseits den pneumatischen<br />
Kolben d trägt.<br />
Das Antriebsteil e kann eine Zahnkrone oder wie weiter<br />
unten beschrieben, irgend eine <strong>and</strong>ere dem Kunststoffteil<br />
angepaßte Mitnehmervorrichtung sein.<br />
Der Schweißvorgang geht folgendermaßen vor sich:<br />
– Einlegen beider Teile in die untere Aufnahme f.<br />
– Herunterfahren des druckluftbetätigten Kolbens mit der<br />
Arbeitsspindel.<br />
– Einschalten der Kupplung, wodurch das Drehen des oberen<br />
Kunststoffteils erfolgt.<br />
– Nach der durch ein Zeitrelais gesteuerten Schweißzeit<br />
schaltet die Kupplung aus, wogegen der Druck noch eine<br />
vom Kunststoff abhängige Zeit aufrechterhalten wird.<br />
– Hochfahren der Spindel und Auswerfen der geschweißten<br />
Teile (oder Weiterschalten des Rundtisches).<br />
93