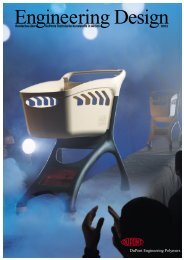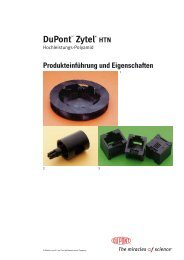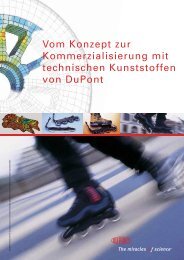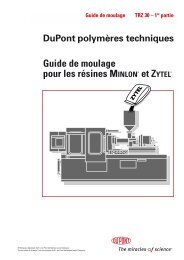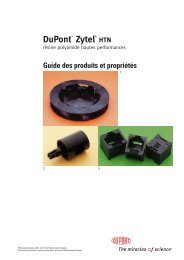Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Rotationsschweißen - Plastics, Polymers, and Resins - DuPont
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß diese Methode aus verschiedenen<br />
Gründen unzufriedenstellend ist. Wie in Abb.<br />
10.74 und 10.75 veranschaulicht wird, heben sich die beträchtlichen<br />
Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte auf, wenn<br />
das Gewicht der oberen Vorrichtung mit Kunststoffteil dem<br />
Gewicht der unteren Vorrichtung mit Kunststoffteil entspricht.<br />
(Beim Winkelschweißen müssen die beiden Trägheitsmomente<br />
identisch sein, um gleiche und entgegengesetzte Trägheitskräfte<br />
zu erzielen).<br />
Falls nur ein Teil bei doppelter Frequenz vibriert, sind die<br />
Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte viermal höher<br />
und müßten über eine zusätzliche und regelbare Vorrichtung<br />
kompensiert werden. Das gesamte Getriebe würde somit<br />
weitaus schwerer und teurer für eine Maschine mit gleicher<br />
Kapazität. Außerdem haben Erfahrung gezeigt, daß sich eine<br />
gute und feste Verbindung leichter erhalten läßt, wenn beide<br />
Teile schwingen.<br />
Schweißbedingungen<br />
Um den Schmelzpunkt des Materials zu erreichen, müssen die<br />
zwei Teile zusammengepreßt werden und bei einer bestimmten<br />
Frequenz und Amplitude schwingen. Diese Bedingungen<br />
können als PV-Werte definiert werden, wobei «P» der spezifische<br />
Kontaktdruck in MPa und «V» die Flächengeschwindigkeit<br />
in m/s ist.<br />
Die zwei Exzenterscheiben erzeugen eine sinusförmige<br />
Geschwindigkeitskurve wie in Abb. 10.76. Da sie in entgegengesetzte<br />
Richtungen laufen, beträgt die maximale relative<br />
Geschwindigkeit des einen Teils gegenüber dem <strong>and</strong>eren<br />
Teil 2 W. Die resultierende relative Geschwindigkeit liegt<br />
somit beim 1,27fachen des maximalen Wertes «W».<br />
Beispiel: Eine Maschine, die Acetalpolymer schweißt, wie<br />
in Abb. 10.74 hat einen Exzenterabst<strong>and</strong> «f» von 3 mm<br />
und läuft bei einer Geschwindigkeit von 5000 U/min.<br />
Die Umfangsgeschwindigkeit ist somit wie folgt:<br />
V = f × � × n = 0,003 m × � × 5000 = 0,78 m /s<br />
60<br />
W W<br />
128<br />
Y = 0,635 W 2 Y = 1,27 W<br />
Y Y<br />
1 Umdrehung<br />
W = maximale Geschwindigkeit jedes Teils<br />
Y = Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Teils<br />
Abb. 10.76 Geschwindigkeitskurven beim Vibrationsschweißen<br />
2 Y<br />
2 W<br />
Dies entspricht der maximalen Geschwindigkeit «W» in<br />
Abb. 10.76. Die durchschnittliche relative Geschwindigkeit<br />
eines Teils gegen das <strong>and</strong>ere wäre dann:<br />
1,27 × 0,78 = 1 m / s<br />
Bei einem spezifischen Kontaktdruck von 3 MPa wird der<br />
resultierende PV-Wert:<br />
3 × 1 = 3 MPa × m/s<br />
Da die erzeugte Wärme außerdem eine Funktion des Reibungskoeffizienten<br />
ist, muß der obige PV-Wert auf das zu<br />
schweißende Material bezogen werden. Glasfaserverstärkte<br />
Polyamide wurden zum Beispiel erfolgreich bei einem PV-<br />
Wert von 1,3 verschweißt. Hieraus läßt sich folgern, daß bei<br />
einer Maschine, die verschiedene Materialien und Formteilgrößen<br />
verschweißen soll, Druck, Drehzahl und Amplitude<br />
verstellbar sein müssen. Sobald die optimalen Arbeitsbedingungen<br />
für ein gegebenes Teil festgelegt sind, dürfte die<br />
Maschine jedoch mit Ausnahme des Druckes keine weiteren<br />
Einstellungen erfordern.<br />
Die Schweißzeit ist das Produkt von Geschwindigkeit, Druck<br />
und Amplitude. Die Praxis hat jedoch gezeigt, daß die<br />
Schweißnahtfestigkeit oberhalb eines bestimmten Druckes<br />
eher abnimmt – möglicherweise aufgrund von ausgequetschtem<br />
geschmolzenem Kunststoff. Auf der <strong>and</strong>eren Seite legen<br />
die resultierenden mechanischen Belastung des Getriebes<br />
Beschränkungen auf. So vervierfacht eine Verdopplung der<br />
Geschwindigkeit die Beschleunigungskräfte der vibrierenden<br />
Massen.<br />
Umfangreiche Tests haben ergeben, daß sich eine Frequenz<br />
von etwa 100 Hz für kleine und mittelgroße Teile sehr<br />
gut eignet, während größere, schwere Formteile bei einer<br />
Frequenz von 70-80 Hz verschweißt werden.<br />
So wurden auch große Teile wie Ansaugrohre erfolgreich,<br />
mit Frequenzen bis zu 250 Hz, verschweißt. Siehe auch<br />
Abb. 10.79D.<br />
Bei Linearmaschinen sollte der Abst<strong>and</strong> der beiden Exzenterscheiben<br />
(«f» in Abb. 10.74) so eingestellt werden, daß<br />
eine relative Bewegung von etwa 0,9 × Schweißnahtbreite<br />
erzielt wird, siehe Abb. 10.77.<br />
Der spezifische Oberflächendruck, der die höchste Schweißnahtfestigkeit<br />
ergibt, muß über Tests ermittelt werden. Als<br />
Faustregel gilt, daß eine Maschine einen Druck von 4 MPa<br />
auf die zu schweißende Fläche erzeugen muß.<br />
W<br />
� 0,9 W<br />
Abb. 10.77 Relative Bewegung – Schweißnahtbreite