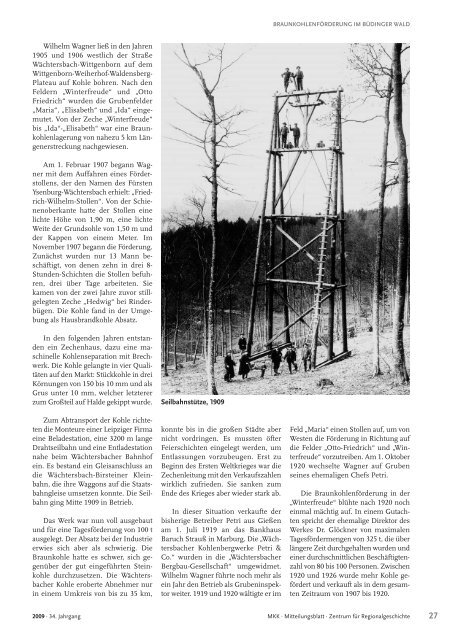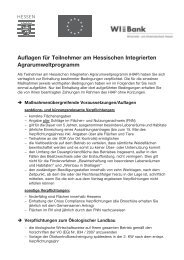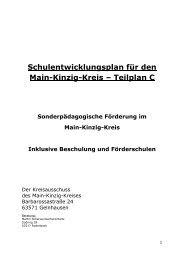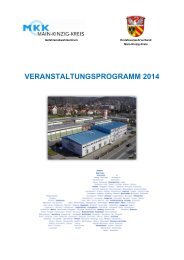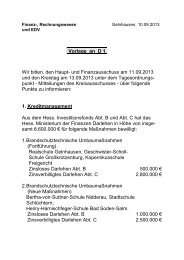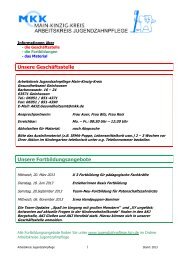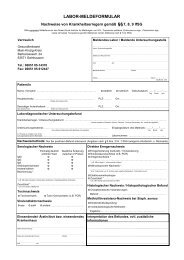Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wilhelm Wagner ließ in den Jahren<br />
1905 und 1906 westlich der Straße<br />
Wächtersbach-Wittgenborn auf dem<br />
Wittgenborn-Weiherhof-Waldensberg-<br />
Plateau auf Kohle bohren. Nach den<br />
Feldern „Winterfreude“ und „Otto<br />
Friedrich“ wurden die Grubenfelder<br />
„Maria“, „Elisabeth“ und „Ida“ eingemutet.<br />
Von der Zeche „Winterfreude“<br />
bis „Ida“-„Elisabeth“ war eine Braunkohlenlagerung<br />
von nahezu 5 km Längenerstreckung<br />
nachgewiesen.<br />
Am 1. Februar 1907 begann Wagner<br />
mit dem Auffahren eines Förderstollens,<br />
der den Namen des Fürsten<br />
Ysenburg-Wächtersbach erhielt: „Friedrich-Wilhelm-Stollen“.<br />
Von der Schienenoberkante<br />
hatte der Stollen eine<br />
lichte Höhe von 1,90 m, eine lichte<br />
Weite der Grundsohle von 1,50 m und<br />
der Kappen von einem Meter. Im<br />
November 1907 begann die Förderung.<br />
Zunächst wurden nur 13 Mann beschäftigt,<br />
von denen zehn in drei 8-<br />
Stunden-Schichten die Stollen befuhren,<br />
drei über Tage arbeiteten. Sie<br />
kamen von der zwei Jahre zuvor stillgelegten<br />
Zeche „Hedwig“ bei Rinderbügen.<br />
Die Kohle fand in der Umgebung<br />
als Hausbrandkohle Absatz.<br />
In den folgenden Jahren entstanden<br />
ein Zechenhaus, dazu eine maschinelle<br />
Kohlenseparation mit Brechwerk.<br />
Die Kohle gelangte in vier Qualitäten<br />
auf den Markt: Stückkohle in drei<br />
Körnungen von 150 bis 10 mm und als<br />
Grus unter 10 mm, welcher letzterer<br />
zum Großteil auf Halde gekippt wurde.<br />
Zum Abtransport der Kohle richteten<br />
die Monteure einer Leipziger Firma<br />
eine Beladestation, eine 3200 m lange<br />
Drahtseilbahn und eine Entladestation<br />
nahe beim Wächtersbacher Bahnhof<br />
ein. Es bestand ein Gleisanschluss an<br />
die Wächtersbach-Birsteiner Kleinbahn,<br />
die ihre Waggons auf die Staatsbahngleise<br />
umsetzen konnte. Die Seilbahn<br />
ging Mitte 1909 in Betrieb.<br />
<strong>Das</strong> Werk war nun voll ausgebaut<br />
und für eine Tagesförderung von 100 t<br />
ausgelegt. Der Absatz bei der Industrie<br />
erwies sich aber als schwierig. Die<br />
Braunkohle hatte es schwer, sich gegenüber<br />
der gut eingeführten Steinkohle<br />
durchzusetzen. Die Wächters -<br />
bacher Kohle eroberte Abnehmer nur<br />
in einem Umkreis von bis zu 35 km,<br />
Seilbahnstütze, 1909<br />
konnte bis in die großen Städte aber<br />
nicht vordringen. Es mussten öfter<br />
Feierschichten eingelegt werden, um<br />
Entlassungen vorzubeugen. Erst zu<br />
Beginn des Ersten Weltkrieges war die<br />
Zechenleitung mit den Verkaufszahlen<br />
wirklich zufrieden. Sie sanken zum<br />
Ende des Krieges aber wieder stark ab.<br />
In dieser Situation verkaufte der<br />
bisherige Betreiber Petri aus Gießen<br />
am 1. Juli 1919 an das Bankhaus<br />
Baruch Strauß in Marburg. Die „Wächtersbacher<br />
Kohlenbergwerke Petri &<br />
Co.“ wurden in die „Wächtersbacher<br />
Bergbau-Gesellschaft“ umgewidmet.<br />
Wilhelm Wagner führte noch mehr als<br />
ein Jahr den Betrieb als Grubeninspektor<br />
weiter. 1919 und 1920 wältigte er im<br />
BRAUNKOHLENFÖRDERUNG IM BÜDINGER WALD<br />
Feld „Maria“ einen Stollen auf, um von<br />
Westen die Förderung in Richtung auf<br />
die Felder „Otto-Friedrich“ und „Winterfreude“<br />
vorzutreiben. Am 1. Oktober<br />
1920 wechselte Wagner auf Gruben<br />
seines ehemaligen Chefs Petri.<br />
Die Braunkohlenförderung in der<br />
„Winterfreude“ blühte nach 1920 noch<br />
einmal mächtig auf. In einem Gutachten<br />
spricht der ehemalige Direktor des<br />
Werkes Dr. Glöckner von maximalen<br />
Tagesfördermengen von 325 t, die über<br />
längere Zeit durchgehalten wurden und<br />
einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl<br />
von 80 bis 100 Personen. Zwischen<br />
1920 und 1926 wurde mehr Kohle gefördert<br />
und verkauft als in dem gesamten<br />
Zeitraum von 1907 bis 1920.<br />
2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 27