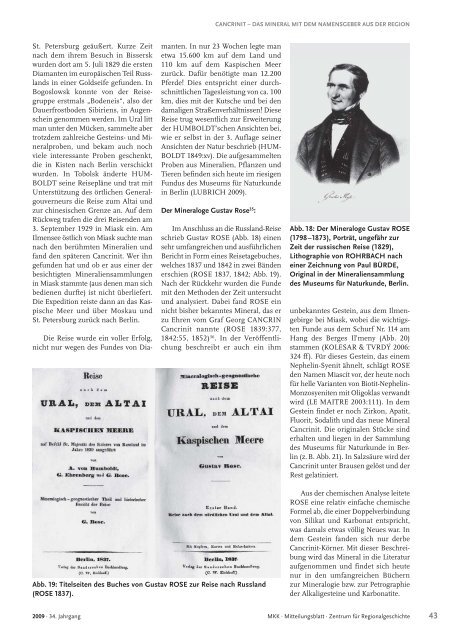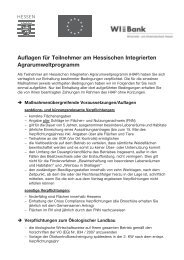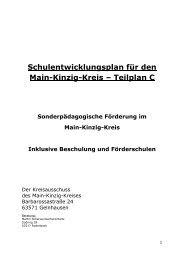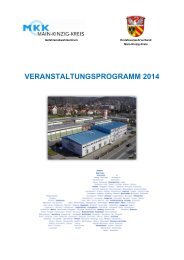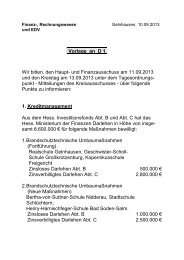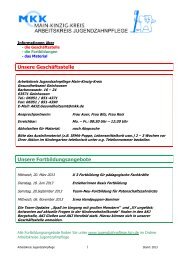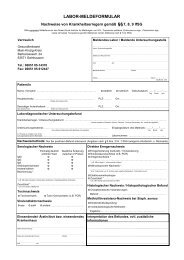Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
St. Petersburg geäußert. Kurze Zeit<br />
nach dem ihrem Besuch in Bissersk<br />
wurden dort am 5. Juli 1829 die ersten<br />
Diamanten im europäischen Teil Russlands<br />
in einer Goldseife gefunden. In<br />
Bogoslowsk konnte von der Reisegruppe<br />
erstmals „Bodeneis“, also der<br />
Dauerfrostboden Sibiriens, in Augenschein<br />
genommen werden. Im Ural litt<br />
man unter den Mücken, sammelte aber<br />
trotzdem zahlreiche Gesteins- und Mineralproben,<br />
und bekam auch noch<br />
viele interessante Proben geschenkt,<br />
die in Kisten nach Berlin verschickt<br />
wurden. In Tobolsk änderte HUM-<br />
BOLDT seine Reisepläne und trat mit<br />
Unterstützung des örtlichen Generalgouverneurs<br />
die Reise zum Altai und<br />
zur chinesischen Grenze an. Auf dem<br />
Rückweg trafen die drei Reisenden am<br />
3. September 1929 in Miask ein. Am<br />
Ilmensee östlich von Miask suchte man<br />
nach den berühmten Mineralien und<br />
fand den späteren Cancrinit. Wer ihn<br />
gefunden hat und ob er aus einer der<br />
besichtigten Mineraliensammlungen<br />
in Miask stammte (aus denen man sich<br />
bedienen durfte) ist nicht überliefert.<br />
Die Expedition reiste dann an das Kas -<br />
pische Meer und über Moskau und<br />
St. Petersburg zurück nach Berlin.<br />
Die Reise wurde ein voller Erfolg,<br />
nicht nur wegen des Fundes von Dia-<br />
manten. In nur 23 Wochen legte man<br />
etwa 15.600 km auf dem Land und<br />
110 km auf dem Kaspischen Meer<br />
zurück. Dafür benötigte man 12.200<br />
Pferde! Dies entspricht einer durchschnittlichen<br />
Tagesleistung von ca. 100<br />
km, dies mit der Kutsche und bei den<br />
damaligen Straßenverhältnissen! Diese<br />
Reise trug wesentlich zur Erweiterung<br />
der HUMBOLDT’schen Ansichten bei,<br />
wie er selbst in der 3. Auflage seiner<br />
Ansichten der Natur beschrieb (HUM-<br />
BOLDT 1849:xv). Die aufgesammelten<br />
Proben aus Mineralien, Pflanzen und<br />
Tieren befinden sich heute im riesigen<br />
Fundus des Museums für Naturkunde<br />
in Berlin (LUBRICH 2009).<br />
Der Mineraloge Gustav Rose 35 :<br />
Im Anschluss an die Russland-Reise<br />
schrieb Gustav ROSE (Abb. 18) einen<br />
sehr umfangreichen und ausführlichen<br />
Bericht in Form eines Reisetagebuches,<br />
welches 1837 und 1842 in zwei Bänden<br />
erschien (ROSE 1837, 1842; Abb. 19).<br />
Nach der Rückkehr wurden die Funde<br />
mit den Methoden der Zeit untersucht<br />
und analysiert. Dabei fand ROSE ein<br />
nicht bisher bekanntes Mineral, das er<br />
zu Ehren vom Graf Georg CANCRIN<br />
Cancrinit nannte (ROSE 1839:377,<br />
1842:55, 1852) 36 . In der Veröffentlichung<br />
beschreibt er auch ein ihm<br />
Abb. 19: Titelseiten des Buches von Gustav ROSE zur Reise nach Russland<br />
(ROSE 1837).<br />
CANCRINIT – DAS MINERAL MIT DEM NAMENSGEBER AUS DER REGION<br />
Abb. 18: Der Mineraloge Gustav ROSE<br />
(1798–1873), Porträt, ungefähr zur<br />
Zeit der russischen Reise (1829),<br />
Lithographie von ROHRBACH nach<br />
einer Zeichnung von Paul BÜRDE,<br />
Original in der Mineraliensammlung<br />
des Museums für Naturkunde, Berlin.<br />
unbekanntes Gestein, aus dem Ilmengebirge<br />
bei Miask, wobei die wichtigsten<br />
Funde aus dem Schurf Nr. 114 am<br />
Hang des Berges Il’meny (Abb. 20)<br />
stammen (KOLESAR & TVRDÝ 2006:<br />
324 ff). Für dieses Gestein, das einem<br />
Nephelin-Syenit ähnelt, schlägt ROSE<br />
den Namen Miascit vor, der heute noch<br />
für helle Varianten von Biotit-Nephelin-<br />
Monzosyeniten mit Oligoklas verwandt<br />
wird (LE MAITRE 2003:111). In dem<br />
Gestein findet er noch Zirkon, Apatit,<br />
Fluorit, Sodalith und das neue Mineral<br />
Cancrinit. Die originalen Stücke sind<br />
erhalten und liegen in der Sammlung<br />
des Museums für Naturkunde in Berlin<br />
(z. B. Abb. 21). In Salzsäure wird der<br />
Cancrinit unter Brausen gelöst und der<br />
Rest gelatiniert.<br />
Aus der chemischen Analyse leitete<br />
ROSE eine relativ einfache chemische<br />
Formel ab, die einer Doppelverbindung<br />
von Silikat und Karbonat entspricht,<br />
was damals etwas völlig Neues war. In<br />
dem Gestein fanden sich nur derbe<br />
Cancrinit-Körner. Mit dieser Beschreibung<br />
wird das Mineral in die Literatur<br />
aufgenommen und findet sich heute<br />
nur in den umfangreichen Büchern<br />
zur Mineralogie bzw. zur Petrographie<br />
der Alkaligesteine und Karbonatite.<br />
2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte<br />
43