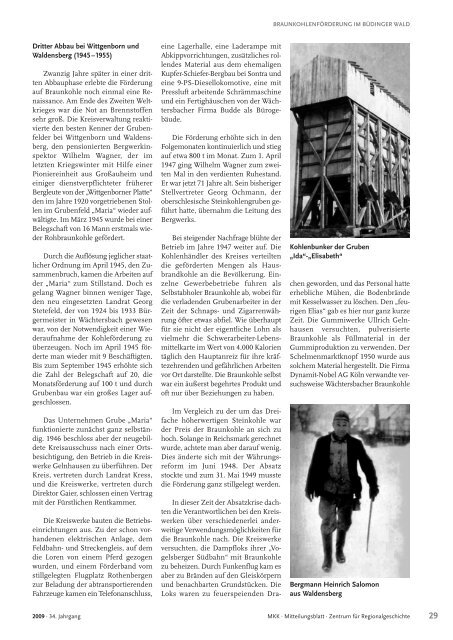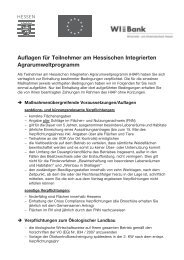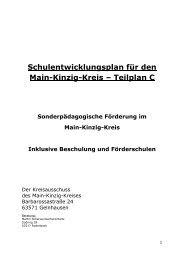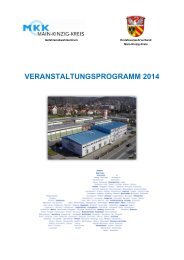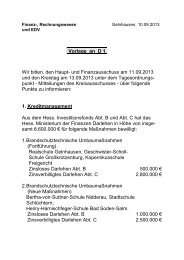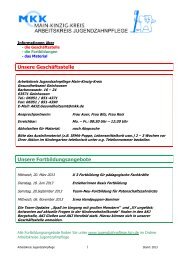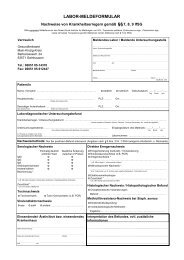Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dritter Abbau bei Wittgenborn und<br />
Waldensberg (1945–1955)<br />
Zwanzig Jahre später in einer dritten<br />
Abbauphase erlebte die Förderung<br />
auf Braunkohle noch einmal eine Renaissance.<br />
Am Ende des Zweiten Weltkrieges<br />
war die Not an Brennstoffen<br />
sehr groß. Die Kreisverwaltung reaktivierte<br />
den besten Kenner der Grubenfelder<br />
bei Wittgenborn und Waldensberg,<br />
den pensionierten Bergwerkinspektor<br />
Wilhelm Wagner, der im<br />
letzten Kriegswinter mit Hilfe einer<br />
Pioniereinheit aus Großauheim und<br />
einiger dienstverpflichteter früherer<br />
Bergleute von der „Wittgenborner Platte“<br />
den im Jahre 1920 vorgetriebenen Stollen<br />
im Grubenfeld „Maria“ wieder aufwältigte.<br />
Im März 1945 wurde bei einer<br />
Belegschaft von 16 Mann erstmals wieder<br />
Rohbraunkohle gefördert.<br />
Durch die Auflösung jeglicher staatlicher<br />
Ordnung im April 1945, den Zusammenbruch,<br />
kamen die Arbeiten auf<br />
der „Maria“ zum Stillstand. Doch es<br />
gelang Wagner binnen weniger Tage,<br />
den neu eingesetzten Landrat Georg<br />
Stetefeld, der von 1924 bis 1933 Bürgermeister<br />
in Wächtersbach gewesen<br />
war, von der Notwendigkeit einer Wiederaufnahme<br />
der Kohleförderung zu<br />
überzeugen. Noch im April 1945 förderte<br />
man wieder mit 9 Beschäftigten.<br />
Bis zum September 1945 erhöhte sich<br />
die Zahl der Belegschaft auf 20, die<br />
Monatsförderung auf 100 t und durch<br />
Grubenbau war ein großes Lager aufgeschlossen.<br />
<strong>Das</strong> Unternehmen Grube „Maria“<br />
funktionierte zunächst ganz selbständig.<br />
1946 beschloss aber der neugebildete<br />
Kreisausschuss nach einer Ortsbesichtigung,<br />
den Betrieb in die Kreiswerke<br />
Gelnhausen zu überführen. Der<br />
Kreis, vertreten durch Landrat Kress,<br />
und die Kreiswerke, vertreten durch<br />
Direktor Gaier, schlossen einen Vertrag<br />
mit der Fürstlichen Rentkammer.<br />
Die Kreiswerke bauten die Betriebseinrichtungen<br />
aus. Zu der schon vorhandenen<br />
elektrischen Anlage, dem<br />
Feldbahn- und Streckengleis, auf dem<br />
die Loren von einem Pferd gezogen<br />
wurden, und einem Förderband vom<br />
stillgelegten Flugplatz Rothenbergen<br />
zur Beladung der abtransportierenden<br />
Fahrzeuge kamen ein Telefonanschluss,<br />
eine Lagerhalle, eine Laderampe mit<br />
Abkippvorrichtungen, zusätzliches rollendes<br />
Material aus dem ehemaligen<br />
Kupfer-Schiefer-Bergbau bei Sontra und<br />
eine 9-PS-Diesellokomotive, eine mit<br />
Pressluft arbeitende Schrämmaschine<br />
und ein Fertighäuschen von der Wächtersbacher<br />
Firma Budde als Bürogebäude.<br />
Die Förderung erhöhte sich in den<br />
Folgemonaten kontinuierlich und stieg<br />
auf etwa 800 t im Monat. Zum 1. April<br />
1947 ging Wilhelm Wagner zum zweiten<br />
Mal in den verdienten Ruhestand.<br />
Er war jetzt 71 Jahre alt. Sein bisheriger<br />
Stellvertreter Georg Ochmann, der<br />
oberschlesische Steinkohlengruben geführt<br />
hatte, übernahm die Leitung des<br />
Bergwerks.<br />
Bei steigender Nachfrage blühte der<br />
Betrieb im Jahre 1947 weiter auf. Die<br />
Kohlenhändler des Kreises verteilten<br />
die geförderten Mengen als Hausbrandkohle<br />
an die Bevölkerung. Einzelne<br />
Gewerbebetriebe fuhren als<br />
Selbstabholer Braunkohle ab, wobei für<br />
die verladenden Grubenarbeiter in der<br />
Zeit der Schnaps- und Zigarrenwährung<br />
öfter etwas abfiel. Wie überhaupt<br />
für sie nicht der eigentliche Lohn als<br />
vielmehr die Schwerarbeiter-Lebensmittelkarte<br />
im Wert von 4.000 Kalorien<br />
täglich den Hauptanreiz für ihre kräftezehrenden<br />
und gefährlichen Arbeiten<br />
vor Ort darstellte. Die Braunkohle selbst<br />
war ein äußerst begehrtes Produkt und<br />
oft nur über Beziehungen zu haben.<br />
Im Vergleich zu der um das Drei -<br />
fache höherwertigen Steinkohle war<br />
der Preis der Braunkohle an sich zu<br />
hoch. Solange in Reichsmark gerechnet<br />
wurde, achtete man aber darauf wenig.<br />
Dies änderte sich mit der Währungs -<br />
reform im Juni 1948. Der Absatz<br />
stockte und zum 31. Mai 1949 musste<br />
die Förderung ganz stillgelegt werden.<br />
In dieser Zeit der Absatzkrise dachten<br />
die Verantwortlichen bei den Kreiswerken<br />
über verschiedenerlei anderweitige<br />
Verwendungsmöglichkeiten für<br />
die Braunkohle nach. Die Kreiswerke<br />
versuchten, die Dampfloks ihrer „Vogelsberger<br />
Südbahn“ mit Braunkohle<br />
zu beheizen. Durch Funkenflug kam es<br />
aber zu Bränden auf den Gleiskörpern<br />
und benachbarten Grundstücken. Die<br />
Loks waren zu feuerspeienden Dra-<br />
BRAUNKOHLENFÖRDERUNG IM BÜDINGER WALD<br />
Kohlenbunker der Gruben<br />
„Ida“-„Elisabeth“<br />
chen geworden, und das Personal hatte<br />
erhebliche Mühen, die Bodenbrände<br />
mit Kesselwasser zu löschen. Den „feurigen<br />
Elias“ gab es hier nur ganz kurze<br />
Zeit. Die Gummiwerke Ullrich Gelnhausen<br />
versuchten, pulverisierte<br />
Braunkohle als Füllmaterial in der<br />
Gummiproduktion zu verwenden. Der<br />
Schelmenmarktknopf 1950 wurde aus<br />
solchem Material hergestellt. Die Firma<br />
Dynamit-Nobel AG Köln verwandte versuchsweise<br />
Wächtersbacher Braunkohle<br />
Bergmann Heinrich Salomon<br />
aus Waldensberg<br />
2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 29