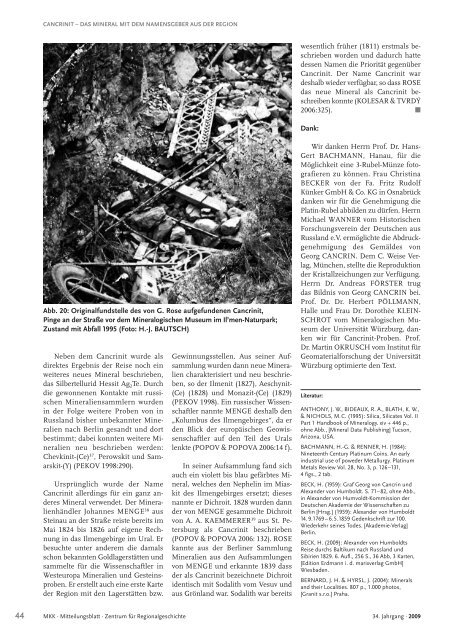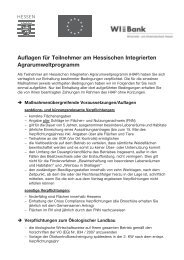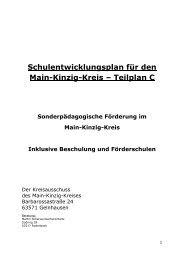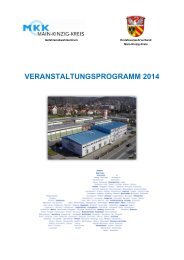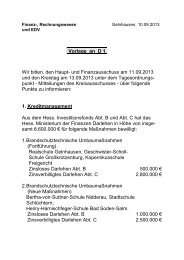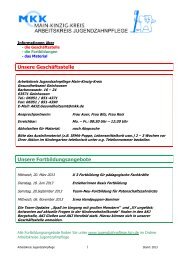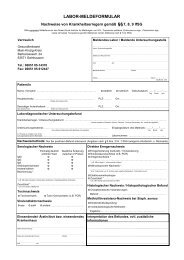Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
CANCRINIT – DAS MINERAL MIT DEM NAMENSGEBER AUS DER REGION<br />
Abb. 20: Originalfundstelle des von G. Rose aufgefundenen Cancrinit,<br />
Pinge an der Straße vor dem Mineralogischen Museum im Il’men-Naturpark;<br />
Zustand mit Abfall 1995 (Foto: H.-J. BAUTSCH)<br />
Neben dem Cancrinit wurde als<br />
direktes Ergebnis der Reise noch ein<br />
weiteres neues Mineral beschrieben,<br />
das Silbertellurid Hessit Ag 2Te. Durch<br />
die gewonnenen Kontakte mit russischen<br />
Mineraliensammlern wurden<br />
in der Folge weitere Proben von in<br />
Russland bisher unbekannter Mine -<br />
ralien nach Berlin gesandt und dort<br />
bestimmt; dabei konnten weitere Mineralien<br />
neu beschrieben werden:<br />
Chevkinit-(Ce) 37 , Perowskit und Samarskit-(Y)<br />
(PEKOV 1998:290).<br />
Ursprünglich wurde der Name<br />
Cancrinit allerdings für ein ganz an -<br />
deres Mineral verwendet. Der Mineralienhändler<br />
Johannes MENGE 38 aus<br />
<strong>Steinau</strong> an der Straße reiste bereits im<br />
Mai 1824 bis 1826 auf eigene Rechnung<br />
in das Ilmengebirge im Ural. Er<br />
besuchte unter anderem die damals<br />
schon bekannten Goldlagerstätten und<br />
sammelte für die Wissenschaftler in<br />
Westeuropa Mineralien und Gesteinsproben.<br />
Er erstellt auch eine erste Karte<br />
der Region mit den Lagerstätten bzw.<br />
Gewinnungsstellen. Aus seiner Aufsammlung<br />
wurden dann neue Mineralien<br />
charakterisiert und neu beschrieben,<br />
so der Ilmenit (1827), Aeschynit-<br />
(Ce) (1828) und Monazit-(Ce) (1829)<br />
(PEKOV 1998). Ein russischer Wissenschaftler<br />
nannte MENGE deshalb den<br />
„Kolumbus des Ilmengebirges“, da er<br />
den Blick der europäischen Geowissenschaftler<br />
auf den Teil des Urals<br />
lenkte (POPOV & POPOVA 2006:14 f).<br />
In seiner Aufsammlung fand sich<br />
auch ein violett bis blau gefärbtes Mineral,<br />
welches den Nephelin im Miaskit<br />
des Ilmengebirges ersetzt; dieses<br />
nannte er Dichroit. 1828 wurden dann<br />
der von MENGE gesammelte Dichroit<br />
von A. A. KAEMMERER 39 aus St. Petersburg<br />
als Cancrinit beschrieben<br />
(POPOV & POPOVA 2006: 132). ROSE<br />
kannte aus der Berliner Sammlung<br />
Mineralien aus den Aufsammlungen<br />
von MENGE und erkannte 1839 dass<br />
der als Cancrinit bezeichnete Dichroit<br />
identisch mit Sodalith vom Vesuv und<br />
aus Grönland war. Sodalith war bereits<br />
wesentlich früher (1811) erstmals beschrieben<br />
worden und dadurch hatte<br />
dessen Namen die Priorität gegenüber<br />
Cancrinit. Der Name Cancrinit war<br />
deshalb wieder verfügbar, so dass ROSE<br />
das neue Mineral als Cancrinit beschreiben<br />
konnte (KOLESAR & TVRDÝ<br />
2006:325). ■<br />
Dank:<br />
Wir danken Herrn Prof. Dr. Hans-<br />
Gert BACHMANN, Hanau, für die<br />
Möglichkeit eine 3-Rubel-Münze fotografieren<br />
zu können. Frau Christina<br />
BECKER von der Fa. Fritz Rudolf<br />
Künker GmbH & Co. KG in Osnabrück<br />
danken wir für die Genehmigung die<br />
Platin-Rubel abbilden zu dürfen. Herrn<br />
Michael WANNER vom Historischen<br />
Forschungsverein der Deutschen aus<br />
Russland e.V. ermöglichte die Abdruckgenehmigung<br />
des Gemäldes von<br />
Georg CANCRIN. Dem C. Weise Verlag,<br />
München, stellte die Reproduktion<br />
der Kristallzeichungen zur Verfügung.<br />
Herrn Dr. Andreas FÖRSTER trug<br />
das Bildnis von Georg CANCRIN bei.<br />
Prof. Dr. Dr. Herbert PÖLLMANN,<br />
Halle und Frau Dr. Dorothèe KLEIN-<br />
SCHROT vom Mineralogischen Museum<br />
der Universität Würzburg, danken<br />
wir für Cancrinit-Proben. Prof.<br />
Dr. Martin OKRUSCH vom Institut für<br />
Geomaterialforschung der Universität<br />
Würzburg optimierte den Text.<br />
Literatur:<br />
ANTHONY, J. W., BIDEAUX, R. A., BLATH, K. W.,<br />
& NICHOLS, M.C. (1995): Silica, Silicates Vol. II<br />
Part 1 Handbook of Mineralogy. xiv + 446 p.,<br />
ohne Abb., [Mineral Data Publishing] Tucson,<br />
Arizona, USA.<br />
BACHMANN, H.-G. & RENNER, H. (1984):<br />
Nineteenth Century Platinum Coins. An early<br />
industrial use of poweder Metallurgy. Platinum<br />
Metals Review Vol. 28, No. 3, p. 126–131,<br />
4 figs., 2 tab.<br />
BECK, H. (1959): Graf Georg von Cancrin und<br />
Alexander von Humboldt. S. 71–82, ohne Abb.,<br />
in Alexander von Humvoldt-Kommission der<br />
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu<br />
Berlin [Hrsg.] (1959): Alexander von Humboldt<br />
14. 9.1769 – 6.5.1859 Gedenkschrift zur 100.<br />
Wiederkehr seines Todes. [Akademie-Verlag]<br />
Berlin.<br />
BECK, H. (2009): Alexander von Humboldts<br />
Reise durchs Baltikum nach Russland und<br />
Sibirien 1829. 6. Aufl., 256 S., 36 Abb, 3 Karten,<br />
[Edition Erdmann i. d. marixverlag GmbH]<br />
Wiesbaden.<br />
BERNARD, J. H. & HYRSL, J. (2004): Minerals<br />
and their Localities. 807 p., 1.000 photos,<br />
[Granit s.r.o.] Praha.<br />
44 MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 34. Jahrgang · 2009