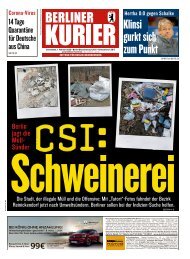Berliner Zeitung 08.11.2018
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Berliner</strong> <strong>Zeitung</strong> · N ummer 261 · D onnerstag, 8. November 2018 17 *<br />
·························································································································································································································································································<br />
Wissenschaft<br />
Ins Café mit<br />
dem Forscher<br />
von nebenan<br />
Gespräche mit den <strong>Berliner</strong><br />
Kieznerds am Sonnabend<br />
VonAnne Brüning<br />
Wissenschaftler<br />
beschäftigen<br />
sich oft mit den ganz großen<br />
Problemen: Bei ihrer Arbeit geht es<br />
zum Beispiel um die Ressourcen der<br />
Erde, um Gesundheitsprobleme<br />
weltweit und die Energie der Zukunft.<br />
Vonihren spannenden Überlegungen<br />
und Erkenntnissen bekommt<br />
man als normaler Bürger<br />
meist viel zu wenig mit. Die Aktion<br />
Kieznerds bietet die Gelegenheit, mit<br />
Wissenschaftlern aus Berlin und<br />
Potsdam mal ganz ungezwungen ins<br />
Gespräch zu kommen.<br />
Unter dem Motto „Gemeinsam<br />
retten wir die Welt!“ laden sie am<br />
Sonnabend, 10. November, in ihre<br />
Stammkneipen, in Cafés und Restaurants,umdortmit<br />
Nachbarnund<br />
Gästen über ihre Arbeit zu diskutieren.<br />
Aufeiner KarteimInternet lässt<br />
sich das nächstgelegene Lokal –oder<br />
das spannendste Thema –rasch ausfindig<br />
machen. In Wedding geht es<br />
zum Beispiel um virtuelle Realität, in<br />
Zehlendorf umQuantentechnologie<br />
und in Neukölln um Pflanzenschutzmittel<br />
im Ackerbau.<br />
Reden über das Artensterben<br />
Einer der Forscher, die sich an der<br />
Aktion beteiligen, ist der Paläontologe<br />
Richard Hofmann, Postdoc am<br />
<strong>Berliner</strong> Museum für Naturkunde.In<br />
der KneipeWernesgrüner B. in Karlshorst<br />
können Interessierte mit ihm<br />
ab 14 Uhr über das Thema „Warum<br />
gibt es so viele Tierarten und wie<br />
wird man sie wieder los?“ reden.<br />
Dem 35-Jährigen ist es ein Anliegen,<br />
mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.<br />
Zum einen, weil seine Arbeit<br />
schließlich mit öffentlichen Geldern<br />
finanziert ist. Aber auch weil er zeigen<br />
möchte,wie wichtig Paläontologie,<br />
die Wissenschaft von den Lebewesen<br />
vergangener Erdzeitalter,<br />
auch heute noch ist.<br />
„Wir sind als eine Art Briefmarkensammler<br />
verschrien, die einfach<br />
nur Fossilien horten“, sagt Hofmann.<br />
Vonden Erkenntnissen über<br />
längst vergangene Zeiten könne<br />
man aber auch heute noch profitieren<br />
–etwa wenn es um die Einordnug<br />
des Artensterbens geht, das<br />
zurzeit stattfindet. „Vor 250 Millionen<br />
Jahren zum Beispiel hat es<br />
schon einmal ein Massensterben<br />
auf unserem Planeten gegeben. 90<br />
Prozent aller Tiere verschwanden<br />
dabei“, erläutert Hofmann. In der<br />
Erdgeschichte sei es das größte Ereignis<br />
dieser Artgewesen.<br />
Was ihn umtreibt: „Die Muster<br />
dieses Massensterbens ähneln den<br />
heutigen Mustern des Artensterbens.“<br />
So hätten auch damals die für<br />
Ökosysteme so wichtigen Korallenriffe<br />
zuerst gelitten. Er möchte bei<br />
der Veranstaltung am Sonnabend<br />
deutlich machen, dass Fossilien<br />
wichtige Zeugnisse sind. „Durch sie<br />
haben wir ein Archiv, das wir gut lesen<br />
sollten“, sagt der Paläontologe.<br />
Der Kneipennachmittag im Wernesgrüner<br />
B. verspricht viele neue<br />
Erkenntnisse, die übrigen 22 Kieznerds-Veranstaltungen<br />
gewiss auch.<br />
DasProgramm findet sich im Internet unter:<br />
kieznerds.de<br />
Der Paläontologe Richard Hofmann in der<br />
House Range in Utah, USA. R. HOFMANN<br />
Viele Kliniken spezialisieren sich auf gewinnträchtige Operationen –Knie-Arthroskopien, Gefäßchirurgie, kardiologische Eingriffe. Szene aus: „Der marktgerechte Patient.<br />
VonChristina Bylow<br />
Die Diagnose ist niederschmetternd:<br />
Deutsche<br />
Krankenhäuser leiden an<br />
einem Syndrom, das aus<br />
dem Formenkreis der Zwangserkrankungen<br />
stammen könnte: fortgeschrittene<br />
Geldfixierung. Peter Hoffmann,<br />
Oberarzt für Anästhesie am<br />
Städtischen Klinikum München, sagt:<br />
„Das Geld steht im Mittelpunkt aller<br />
Gedanken.“ Einerseits werdegespart,<br />
insbesondereamPersonal und an der<br />
Zeit für den Patienten, andererseits<br />
werde mehr operiert, und zwar dort,<br />
wo es sich lohnt.<br />
2003 wurde in Krankenhäusern<br />
ein neues Abrechnungssystem eingeführt.<br />
Statt nach Liegetagen und Pflegesätzen<br />
wird seither nach Leistungen<br />
vergütet. Auf den Internetseiten<br />
des Bundesgesundheitsministeriums<br />
lesen sich die Erläuterungen zum<br />
DRG-System (siehe Kasten) plausibel:<br />
„Bei Patientinnen und Patienten<br />
mit leichten Erkrankungen sind die<br />
Vergütungen geringer als bei schweren,<br />
aufwändig zu behandelnden Erkrankungen.“<br />
Den Realitäts-Check<br />
aber besteht das DRG-System nicht.<br />
Zumindest nicht, was das Wohl des<br />
Patienten angeht. Der ist nur noch<br />
Objekt in einer auf Gewinnmaximierung<br />
gedrillten Krankenhausmaschinerie.<br />
Das jedenfalls ist die These des<br />
Dokumentarfilms „Der marktgerechte<br />
Patient“, der nun in die Kinos<br />
kommt und von den Hamburger Filmemachern<br />
Leslie Franke und Herdolor<br />
Lorenz für Veranstaltungen zur<br />
Verfügung gestellt wird. Ein „Kampagnenteam“<br />
kümmert sich darum,<br />
dass der aus Spenden (etwa von Attac,<br />
der GLS Bank und Verdi) finanzierte<br />
Film unter die Leute kommt.<br />
Hilfsmittel zur Aufklärung<br />
Seit vielen Jahren beschäftigen sich<br />
Franke und Lorenz mit dem staatlich<br />
vorangetriebenen Langzeitprojekt<br />
umfassender Privatisierungen, sei es<br />
der Bahn, sei es der Wasserversorgung.<br />
„Water Makes Money“ wurde<br />
von mehr als einer Million Zuschauern<br />
gesehen. Franke und Lorenz begreifen<br />
ihre Filme als Hilfsmittel zur<br />
Aufklärung. Siesetzen dabei vorallem<br />
auf die Überzeugungskraft der Protagonisten,<br />
wenige Grafiken und eine<br />
sparsam eingesetzte Sprecherstimme.<br />
Emotional aufgeladene Bilder<br />
vermeiden sie.<br />
„Der marktgerechte Patient“ ist in<br />
seiner betont unspektakulären Erzählweise<br />
ein Gegenentwurf zuden<br />
seichten Krankenhaus-Serien des öffentlich-rechtlichen<br />
Fernsehens.Wer<br />
den Film als demagogisches Pamphlet<br />
abtun will, der hat es in diesem<br />
Fall schwer.Denn Franke und Lorenz<br />
Kliniken als Geldmaschinen<br />
Ein Dokumentarfilm zeigt die Folgen der Kommerzialisierung der Krankenhäuser<br />
Fallpauschale: Unter diesem<br />
Begriff ist eine Formder<br />
Vergütung vonLeistungen im<br />
Gesundheitssystem bekannt,<br />
die auf dem 2003<br />
eingeführten DRG-System<br />
beruht. DRG bedeutet Diagnosis<br />
Related Groups.<br />
haben keine Nörgler befragt, die vor<br />
der Kamera über Arbeitsbelastung<br />
jammern. Die Experten, man könnte<br />
sie auch Zeugen der Anklage nennen,<br />
haben nicht nur Rang und Namen,<br />
Erfahrung und Wissen, sondern vor<br />
allem eine große Liebe zu ihren heilenden<br />
Berufen. Es sind Ärzte und<br />
Ärztinnen, Krankenschwestern und<br />
Pfleger. Meist befragt am Arbeitsplatz,<br />
bei laufendem Betrieb. In80<br />
Minuten zeichnen sie das Bild einer<br />
nicht nur latenten Gefahrensituation.<br />
Aber der Film zeigt auch Gegenstrategien,<br />
verkörpert etwa von einem<br />
gegen Berater resistenten Klinik-<br />
Geschäftsführer in Dortmund und<br />
den streikenden Schwestern und<br />
Pflegern der <strong>Berliner</strong> Charité, die<br />
2015 nicht für Lohnerhöhungen, sondernfür<br />
mehr Personal kämpften. An<br />
der politisch gesetzten Zielvorgabe,<br />
Renditen zu erwirtschaften, änderte<br />
das nichts. Der Film hingegen stellt<br />
dieses Ziel infrage und gibt jenen<br />
Stimmen Raum, die das ebenfalls tun.<br />
Den Anfang macht der Oberarzt<br />
Michael Berger in der Kinderklinik<br />
der LMU-Universitätsklinik München.<br />
Er steht am Bett eines etwa<br />
zweijährigen Kindes nach einer Lebertransplantation.<br />
Ein Jahr musste<br />
der Junge auf das Spenderorgan warten,<br />
und das lag, wie Berger ausführt,<br />
„nicht so sehr an mangelnder<br />
EIN FOLGENSCHWERES SYSTEM<br />
Vergütung: Im Gegensatz zu<br />
zeitraumbezogenen Vergütungsformen<br />
(wie tagesgleiche<br />
Pflegesätze) oder einer<br />
Vergütung einzelner Leistungen(Einzelleistungsvergütung)<br />
erfolgt die Vergütung<br />
pro Behandlungsfall.<br />
Hamburger Schwesternund Pflegerndemonstrieren für mehr Personal.<br />
Dokumentarfilm: Ein Film untersucht<br />
die für Patienten oft<br />
schädlichen Folgen des DRG-<br />
Systems: „Der marktgerechte<br />
Patient. In der Krankenhausfabrik“,<br />
Buch: HerdolorLorenz,<br />
Regie: Leslie Franke,Dokfilm,<br />
82 Minuten, Dt. 2018.<br />
SALZGEBER<br />
Spende-Bereitschaft unserer Mitbürger“,<br />
sonderndaran, dass es „sich für<br />
die Krankenhäuser nicht lohnt“. Die<br />
Kliniken, in denen die Spender sterben,<br />
seien einem „absoluten Kostendruck<br />
ausgesetzt“. Sie hätten die OP-<br />
Kapazität für solch einen Eingriff<br />
nicht,„es ist viel lukrativer,wenn man<br />
die OPsanderweitig nutzt“.<br />
DieFrage,was sich finanziell lohnt<br />
und was nicht, steht spätestens seit<br />
2003 im Hintergrund aller ärztlichen<br />
Entscheidungen. DerDirektor derselben<br />
Klinik, Christoph Klein, zieht Bilanz:<br />
„Mit der Einführung des Fallpauschalen-Systems<br />
gibt es in der<br />
Medizin Gewinner und Verlierer,und<br />
leider ist es so, dass schwerstkranke<br />
Kinder hier zur Gruppe der Verlierer<br />
gehören. Mit kranken Kindern ist es<br />
sehr schwer, Geld zu verdienen oder<br />
auch Profit zu machen.“ Bleibt der jedoch<br />
aus,hat das Konsequenzen. „Es<br />
wird verlangt, dass wir jedes Jahr<br />
mehr Geld generieren, und wenn wir<br />
das nicht tun, werden uns Stellen gestrichen“,<br />
sagt seine Kollegin Sibylle<br />
Koletzko. Mittlerweile sei es so weit<br />
gekommen, dass die medizinische<br />
Grundversorgung von Kindern nicht<br />
mehr gewährleistet sei, sagt Michael<br />
Berger.„Kinder,die vonder Schaukel<br />
fallen, die sich den Armbrechen, können<br />
wir nicht mehr adäquat versorgen.“<br />
SALZGEBER<br />
Krankenhäuser in München, Freiburg,<br />
Hamburg, Dortmund und am<br />
Ende auch in Berlin –das sind die Stationen<br />
einer Reise an die Kehrseite eines<br />
Wirtschaftssystems, das seit der<br />
Agenda 2010 immer mehr Bereiche<br />
dem Markt überlässt. Auch jene, die<br />
eigentlich der Daseinsvorsorge dienen,<br />
ein zentraler Begriff der Kritiker<br />
des DRG-Systems. Zuihnen gehört<br />
der Chirurg und Publizist Ulrich Hildebrandt.<br />
Derehemalige Chefarzt einer<br />
Uniklinik rechnet in seinem Buch<br />
„Die Krankenhausverdiener“ radikal<br />
mit dem DRG-System ab.30Euroim<br />
Schnitt Fallpauschale für einen Notfall<br />
–das, soerklärt erimFilm, führe<br />
dazu, dass viele privatisierte Krankenhäuser<br />
keine Notaufnahmen<br />
mehr betreiben. Eine kommunale<br />
Klinik ist dazu verpflichtet – und<br />
schreibtVerluste.Dasselbe gilt für Geburtsstationen.<br />
Diese Kliniken verlieren<br />
gegenüber anderen, die sich auf<br />
gewinnträchtige Operationen spezialisieren<br />
–Knie-Arthroskopien, Gefäßchirurgie,kardiologische<br />
Eingriffe.<br />
Abgelehnte Notfall-Behandlung<br />
Die Rendite-Kliniken siedeln in<br />
München gleich neben ihren ärmeren<br />
Verwandten, den kommunalen,<br />
und ziehen diesen dazu noch qualifiziertes<br />
Personal ab. Der Münchner<br />
Oberbürgermeister Dieter Reiter<br />
(SPD) weiß um die Lage des Städtischen<br />
Klinikums München, immerhin<br />
ist er dortAufsichtsratsvorsitzender.<br />
ImFilm redet er wie ein empörter<br />
Student: „Der Gesetzgeber<br />
müsste sich schon was überlegen,<br />
wenn er nicht will, dass Krankenhäuser<br />
auch zu Luxusgut verkommen.“<br />
Seine Partei, die SPD,aber hat<br />
diese Gesetzemitverantwortet.<br />
Der Geschäftsführer des 2008 gegründeten<br />
Isar Klinikums, Andreas<br />
Arbogast, bewegt sich hingegen mühelos<br />
im DRG-System. Er sagt Sätze<br />
wie: „Ich kann Prozesse schlank gestalten“<br />
oder: „Wenn ein Patient sieben<br />
statt vier Tage liegt, nutzt er die<br />
Infrastruktur ohne zusätzliche Erlöse.“<br />
Das ist die Gewinnerseite. Ob<br />
die Patienten dieser Klinik auch dazugehören,<br />
bleibt offen.<br />
In Hamburgfanden die Filmemacher<br />
Patienten, die in den seit 2004<br />
privatisierten Hamburger Asklepios-<br />
Kliniken miserabel, gar nicht oder zu<br />
spät behandelt wurden. Notfälle werden<br />
laut Logbuch, das im Film gezeigt<br />
wird, „mangels Kapazität“ häufig abgelehnt,<br />
auch ein „Polytrauma nach<br />
Motoradunfall“. Angesichts dieser<br />
Entwicklungen an DRG „herumzudoktern“,<br />
so Ingrid Greif, Betriebsratsvorsitzende<br />
des Städtischen Klinikums<br />
in München, nütze nichts.<br />
„DRG muss abgeschafft werden. Gesundheit<br />
ist Daseinsvorsorge und gehörtzurück<br />
in die öffentliche Hand.“<br />
Berlin würdigt<br />
Erfinderin der<br />
Genschere<br />
Wissenschaftspreis für<br />
Emmanuelle Charpentier<br />
Der mit 40 000 Euro dotierte<br />
<strong>Berliner</strong> Wissenschaftspreis<br />
geht in diesem Jahr an Emmanuelle<br />
Charpentier, Mit-Entdeckerin der<br />
gefeierten Genschere Crispr. Die<br />
49-jährige Mikrobiologin und Professorin<br />
aus Frankreich ist Direktorin<br />
am<strong>Berliner</strong> Max-Planck-Institut<br />
für Infektionsbiologie. Sie erhielt<br />
am Mittwochabend die Auszeichnung<br />
für ihre innovative<br />
Forschung in der Genregulation.<br />
Die Entdeckung der Schere, mit<br />
der sich Gene verändern und reparieren<br />
lassen, gilt als Jahrhundertcoup.<br />
Seitdem wurde Charpentier<br />
mit Auszeichnungen, Ehrendoktorwürden<br />
und Akademie-Mitgliedschaften<br />
überhäuft. Sie wird<br />
jedes Jahr als heiße Kandidatin für<br />
einen Nobelpreis gehandelt.<br />
Der <strong>Berliner</strong> Wissenschaftspreis<br />
würdigt in Berlin entstandene Leistungen<br />
in Wissenschaft und Forschung.<br />
Charpentier habe ein<br />
neues Kapitel in der Medizinforschung<br />
aufgeschlagen, lobte Berlins<br />
Regierender Bürgermeister Michael<br />
Müller (SPD). Sie bereite die<br />
Grundlage für zahlreiche weitere<br />
Innovationen.<br />
Mit Charpentiers Wunderwerkzeug<br />
für Gene lässt sich Erbmaterial<br />
auf vielen Arten verändern. Das<br />
bietet neue Chancen bei Pflanzen<br />
bis hin zur Humanmedizin –aber<br />
auch Risiken. Vieles von dem, was<br />
an Therapien für Krankheiten möglich<br />
sein könnte, ist in der Medizin<br />
noch Zukunftsmusik. An Machbarkeit<br />
und möglichen Folgen wird<br />
weltweit intensiv geforscht.<br />
Auch Emmanuelle Charpentier<br />
ist in der Praxis mit dabei. Sie ist<br />
Projektleiterin im Exzellenzcluster<br />
NeuroCure, das neue Wege in der<br />
Erforschung und Behandlung von<br />
Erkrankungen des Nervensystems<br />
sucht. (dpa)<br />
Kleine Menschen<br />
kommen<br />
besser voran<br />
Das trifft zumindest auf den<br />
Dschungel zu, so eine Studie<br />
I<br />
m Dschungel kommen kleine<br />
Menschen besser voran als große.<br />
Dasbestätigen Laufanalysen, die Forscher<br />
der Harvard University im<br />
Fachmagazin Proceedings Bvorstellen.<br />
Klein zu sein und in der Folge im<br />
dichten Grün effizienter auf Nahrungssuche<br />
gehen zu können, sei womöglich<br />
ein evolutionärer Vorteil für<br />
Waldbewohner gewesen.<br />
In Regenwaldgebieten gibt es<br />
mehrere indigene Völker von vergleichsweise<br />
kleinemWuchs.Die Forscher<br />
ließen etwa 30 Männer zweier<br />
Gruppen – der Batek aus Malaysia<br />
und derTsimane aus Bolivien –auf offener<br />
Fläche und durch Wald laufen.<br />
Dabei maßen sie Schrittlängen und<br />
Geschwindigkeiten der im Mittel 1,63<br />
Meter großen Männer.Während größere<br />
Individuen in offener Umgebung<br />
eher längere Schritte machten,<br />
seien in dichter Waldumgebung alle<br />
zu ähnlichen, relativ kleinen Schrittlängen<br />
gezwungen, so die Forscher.<br />
Kleinere Menschen könnten sich<br />
effizienter zwischen Büschen und<br />
Zweigen hindurchmanövrieren. Berechnungen<br />
der Forscher zufolge<br />
käme ein großgewachsener Amerikaner<br />
im Dickicht nur etwa halb so<br />
schnell voran wie ein Mann des afrikanischen<br />
Efe-Volks, das zu den<br />
kleinsten der Erde zählt. Auch Umweltfaktoren<br />
wie Hitze, Feuchtigkeit,<br />
Krankheitserreger und Nahrungsangebot<br />
könnten für die Größe eine<br />
Rolle spielen. (dpa)