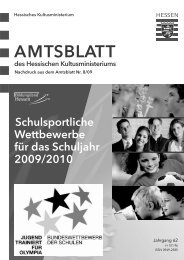abi. 8/02 - Amtsblatt des hessischen Kultusministeriums
abi. 8/02 - Amtsblatt des hessischen Kultusministeriums
abi. 8/02 - Amtsblatt des hessischen Kultusministeriums
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ABl. 8/<strong>02</strong> Bekanntmachungen und Mitteilungen <strong>des</strong> Hess. <strong>Kultusministeriums</strong> 577<br />
terricht und ein auf drei Jahre angelegtes informationstechnisches<br />
Curriculum angeboten werden. Weiterhin<br />
sollte die Förderung selbstregulierten Lernens einen integralen<br />
Bestandteil <strong>des</strong> Lehrplans darstellen. Für den<br />
Schulversuch einer dreijährigen Primarstufe schlägt er<br />
drei Grundschulen mit jeweils min<strong>des</strong>tens einer Klasse<br />
vor, wobei eine wissenschaftliche Evaluation und der<br />
Vergleich mit Kontrollschulen für eine Abschätzung <strong>des</strong><br />
Fördererfolgs notwendig sei. Die Laufzeit der wissenschaftlichen<br />
Evaluation sollte fünf Jahre umfassen, womit<br />
die komplette Grundschulzeit von drei Kohorten umfasst<br />
wäre.<br />
Sieht man von der in dieser Altersstufe noch recht<br />
problematischen Hochbegabungsprognose einmal ab, ergeben<br />
sich angesichts der oben angesprochenen<br />
Vorkommenshäufigkeit der intellektuell Hochbegabten<br />
(IQ ≥ 130) bei diesem Vorschlag beträchtliche organisatorische<br />
Probleme: Um 20 hochbegabte Kinder der<br />
ersten Jahrgangsstufe für eine Hochbegabtenklasse<br />
zu gewinnen, wäre – geht man z. B. von einer durchschnittlichen<br />
Klassengröße von 22 Schülerinnen und<br />
Schülern aus – min<strong>des</strong>tens ein Einzugsgebiet von rund<br />
45 Schulanfängerklassen erforderlich. Da aber nicht davon<br />
ausgegangen werden kann, dass jede Familie mit einem<br />
hochbegabten Grundschulkind auch eine separierende<br />
Beschulung in speziellen Klassen wünscht, wäre<br />
– bei einer angenommenen 40prozentigen Akzeptanz –<br />
von einem Einzugsgebiet von mehr als 100 Schulanfängerklassen<br />
auszugehen.<br />
Neben dem Problem der großen Anfahrtswege und Anfahrtskosten<br />
müssen auch die sich zwangsläufig ergebenden<br />
zusätzlichen psycho-physischen Belastungen für die<br />
(häufig vorzeitig einzuschulenden, d. h. besonders jungen)<br />
Schulanfängerinnen und Schulanfänger in die Überlegungen<br />
einbezogen werden. Vorab wäre weiterhin zu<br />
klären, wie mit denjenigen Schülerinnen und Schülern<br />
verfahren werden soll, bei denen sich im Verlauf der verkürzten<br />
Grundschulzeiten herausstellt, dass sie den Anforderungen<br />
dieser Spezialklassen nicht genügen.<br />
Insbesondere ist unter pädagogischen, entwicklungspsychologischen<br />
und sozialisationstheoretischen Gesichtspunkten<br />
zu bedenken, dass hochbegabten Kindern zu so<br />
frühem Zeitpunkt die für die zukünftige Lebensbewältigung<br />
zentrale Entwicklungsaufgabe <strong>des</strong> Lernens und Lebens<br />
in einer begabungsheterogenen Lernumwelt nicht<br />
vorzuenthalten ist.<br />
5. Kompetenzen von Lehrkräften<br />
Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihre Grundschularbeit<br />
nach den Grundsätzen <strong>des</strong> allgemeinen Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrages der Schule. In einer Zeit sich ständig<br />
verändernder Lebensbedingungen stehen sie einer<br />
Vielfalt individueller Ansprüche und Kindern mit sehr<br />
unterschiedlichen Entwicklungsständen gegenüber. Die<br />
Spanne der Fähigkeiten wie auch <strong>des</strong> Leistungsvermö-<br />
gens von Schülerinnen und Schülern klafft normalerweise<br />
auseinander.<br />
Die Bandbreite eines hohen Förderbedarfs reicht von<br />
Kindern mit Teilleistungsschwächen, psychomotorischen,<br />
visuellen und/oder auditiven Problemen, Konzentrationsschwierigkeiten<br />
oder anderen auffälligen Verhaltensweisen<br />
(wie z. B. Rückzugsverhalten, Ängsten, Clownerien,<br />
Hyperaktivität, Aggressionen) auf der einen<br />
Seite bis hin zu identifizierten oder auch unerkannten<br />
bzw. verkannten hochbegabten Kindern (Underachiever).<br />
Innerhalb dieser beträchtlichen Vielfalt haben auch<br />
intellektuell hochbegabte Kinder ein Anrecht auf eine<br />
professionelle, sensible und individuelle Förderung. Es<br />
wäre verhängnisvoll und pädagogisch unverantwortlich,<br />
wenn diese Kinder Unterricht und Schule nur über sich<br />
ergehen lassen müssten und dadurch im Einzelfall möglicherweise<br />
sogar psychische Schäden erlitten.<br />
Lehrkräfte sollten sich – nicht bloß in der Grundschule<br />
und nicht allein auf dem Gebiet der Hochbegabtenförderung<br />
– von dem überkommenen Denkmuster eines altershomogenen<br />
horizontalen gleichschrittigen Fortschreitens<br />
aller Schülerinnen und Schüler, das die tatsächliche<br />
Unterschiedlichkeit heterogener Klassenverbände nur<br />
höchst unzureichend wiedergibt, lösen. Lehrerinnen und<br />
Lehrer müssen vielmehr verstärkt lernen, die recht verschiedenartigen<br />
individuellen Schülerleistungen und ihre<br />
umgebenden Bedingungsgefüge in den Blick zu nehmen<br />
und zu beobachten, um die jeweiligen Schwierigkeitsgrade<br />
der Aufgabenstellungen darauf abzustimmen.<br />
Die optimale Förderung der einzelnen Schülerinnen und<br />
Schüler ist Aufgabe der gesamten schulischen Arbeit.<br />
Merkmale von intellektueller Hochbegabung sind sehr<br />
differenziert und vielschichtig, so dass eine Unterscheidung<br />
von „normal“ begabten Kindern für psychologische<br />
Laien – und damit auch für Lehrkräfte – in der Regel<br />
nicht unmittelbar augenfällig ist. Da im schulischen Alltag<br />
in der Regel keine fachwissenschaftlich durchgeführte<br />
Testdiagnostik vorliegen wird und eine solche auch<br />
nur in enger umrissenen Problem- bzw. Entscheidungssituationen<br />
angezeigt ist, sind die in einer Klasse vorhandenen<br />
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich gemeinsam<br />
nach der Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und Motivation<br />
zu beschulen.<br />
Für diejenigen Einzelfälle, in denen eine fachwissenschaftlich<br />
zu erstellende Hochbegabungsdiagnostik geboten<br />
ist oder von Elternseite der Schule vorgelegt wird,<br />
gilt: Die exakte Identifikation bzw. Diagnostik intellektuell<br />
hochbegabter Kinder muss speziell ausgebildeten<br />
und erfahrenen Diplom-Psychologinnen und -Psychologen<br />
vorbehalten bleiben. Nur sie können zielgenau entscheiden<br />
und die Diagnose „intellektuell hochbegabt“<br />
fachgerecht absichern. So streben auch die vielfältigen<br />
Fortbildungsangebote <strong>des</strong> <strong>Kultusministeriums</strong> und <strong>des</strong><br />
Hessischen Lan<strong>des</strong>instituts für Pädagogik keine Zusatzausbildung<br />
von Lehrkräften zu Diagnostikern an, sondern<br />
wollen u. a. Lehrkräfte sensibilisieren, in Frage