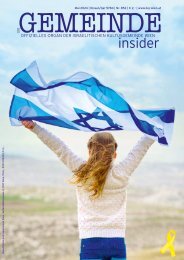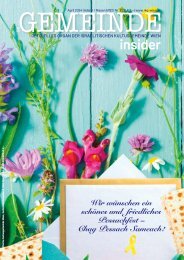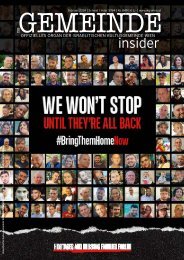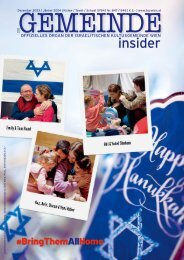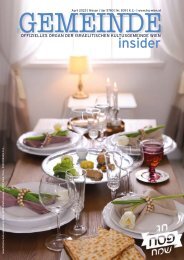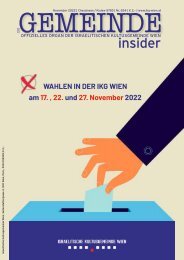Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
OBERSTEIERMARK
reits gute Erfahrungen mit Schulprojekten
gesammelt, wusste, dass man auch
fächerübergreifend viel erreichen kann,
wenn man die Jugendlichen fordert. Was
war der politisch-historische Hintergrund
in der steirischen Stadt selbst? Der Historiker
Schiestl, der einiges über das jüdische
Leben in der Region publiziert hat,
wählte bei der Eröffnung im Herbst 2019
klare Worte:
„Von der Geschichte der Judenburger
Juden zu erzählen, das heißt in erster
Linie, sich durch ein Dickicht von Legenden,
von Mythen und Vorurteilen zu
bewegen, die Jahrhunderte lang und bis
in die Gegenwart diese Geschichte verdunkelt
und bis zur Unkenntlichkeit entstellt
haben. Und es gehört wirklich zu
den bedauernswerten Kapiteln der lokalen
Geschichtsschreibung, dass sie dieser
Legendenbildung nicht nur nichts entgegengesetzt
hat – nämlich die schlichten
Fakten, die aus den Schriftquellen zu erzählen
wären –, sondern sie hat an dieser
Mythenbildung und vor allem am Verfälschen
und am Verschweigen aktiv mitgewirkt.
[…] Die Geschichte der Juden
bleibt dabei so gut wie unsichtbar, wie ein
unliebsames und […] aus der Art geschlagenes
Mitglied der Verwandtschaft, dessen
Existenz man lieber verschweigt, weil
man sich sonst unangenehmen Fragen zu
stellen hätte.“
Stadt jüdischer Gelehrsamkeit. Schiestl
erinnerte in seiner Rede an die blühende
kleine mittelalterliche jüdische Gemeinde
von Judenburg „mit einer umfassenden
religiösen Infrastruktur, mit einer Synagoge,
mit rituellem Bad, einem Spital, einem
Friedhof und anderen sozialen und
Erinnerung an
den jüdischen
Friedhof und die
Zeremonienhalle
im obersteirischen
Leoben.
religiösen Einrichtungen“. Judenburg war
auch eine Stadt jüdischer Gelehrsamkeit,
wie Pergamentfunde belegten. Geblieben
sei aber nur das Vorurteil vom jüdischen
Geldverleiher, damals eine der wenigen
ökonomischen Aktivitäten, die der Landesfürst
den Juden zugestand, bis er sie
wieder vertreiben ließ.
Und auch zu den Jahren 1938 und 1945
fand der Historiker klare Worte, nämlich
„dass bei diesem Diebeszug durch die jüdischen
Geschäfte und Häuser alles geraubt
wurde, was den neuen ‚Herrenmenschen‘
begehrenswert erschien: Möbel, Kleidungsstücke,
Motorräder, Automobile,
Teppiche, Musikinstrumente, Schmuck,
Geschirr […], ganze Privatsammlungen,
z. B. Porzellan- und Zinngeschirrsammlungen,
und Bibliotheken haben praktisch
über Nacht den Besitzer gewechselt.“
Schon im November 1938 wurde
der Gauleitung in Graz stolz gemeldet,
die Stadt sei „judenfrei“.
Darüber hinaus möge man nicht vergessen,
„dass die meisten Protagonisten
und die Profiteure dieses Raubzuges
nach 1945 als ehrenwerte Bürgerinnen
und Bürger weiterhin für das Wohl dieser
Stadt gewirkt haben und ihre Mordsgesinnung
an die folgenden Generationen
weitergeben durften.“
„Es ist wirklich einer der bitteren postumen
Siege des Nationalsozialismus, dass
er nach der Vertreibung und nach der Ermordung
der meisten jüdischen Familien
dieser Stadt auch das Wissen und die Erinnerung
an diese reiche und lebendige
jüdische Tradition ausgelöscht hat.“ Dem
solle das Denkmal und die kreative Zusammenarbeit
der Jugendlichen deutlich
Widerspruch entgegensetzen.
ERINNERUNG
AUCH IN LEOBEN
C
lemens
Neugebauer, der
Künstler, der für die Umsetzung
des Judenburger
Denkmals verantwortlich zeichnet,
hat sich nicht zum ersten
Mal mit der unrühmlichen Vergangenheit
der Obersteiermark auseinandergesetzt.
Er ist ein vielseitig kreativer Kopf: Musiker,
Komponist, Keramiker, Maler, Unternehmer.
In seiner Firma „3D Kunst“ hat er
etwa den riesigen stählernen Stier am Red-
Bull-Ring in Spielberg geplant und aufgestellt
und auch das mächtige Bühnenbild
für Verdis Aida im burgenländischen Steinbruch
St. Margarethen aus Styroporteilen
gefertigt.
In seinen Jahren als Kunsterzieher am Leobener
Gymnasium betreute er zwei historische
Projekte. Im ersten ging er mit einer
siebenten Klasse der Lebensgeschichte
des 1921 in Leoben geborenen jüdischen
Violinisten und Bratschisten Gideon Röhr
nach. Dieser hatte als Kind in Leoben an
der Musikschule seine Grundausbildung erhalten
und dann – nach der Flucht mit seinen
Eltern nach Palästina – in Israel und in
Schweden Karriere gemacht. Bei diesem
Projekt fanden die Jugendlichen heraus,
dass es bis 1938 im Haus der Musikschule
einen jüdischen Betraum gegeben hatte.
Heute erinnern daran – und an Röhr – zumindest
Wandtafeln.
In einem weiteren Projekt forschte Neugebauer
mit 18-jährigen Mädchen zum einstigen
jüdischen Friedhof in Leoben. „Er war
in einer Ecke an der Mauer des großen städtischen
Friedhofs untergebracht“, erzählt er.
„Die Nazis haben alle Grabsteine geraubt
und für den Straßenbau verwendet, die
Gräber selbst sind geblieben, man weiß nur
nicht, wer wo liegt.“ Als Erinnerung setzten
die Schülerinnen 57 Granitplatten in eine
Wiese, die Namen der hier begrabenen Jüdinnen
und Juden findet man an einer Tafel
an der Friedhofsmauer. Und auch die Umfänge
der längst abgerissenen kleinen jüdischen
Zeremonienhalle machten die Schülerinnen
mit einer Art Fundament wieder
sichtbar. Es reicht sogar über die heutige
Friedhofsmauer hinaus bis zur Straße.
wına-magazin.at
15