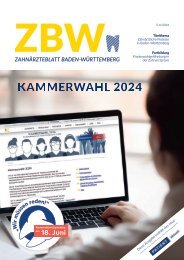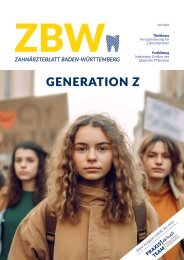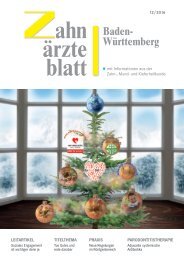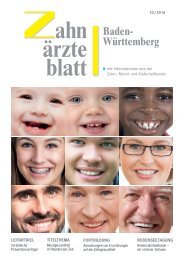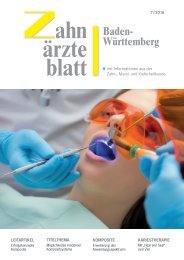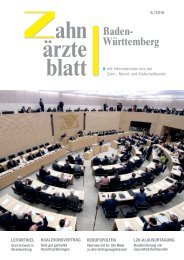… und Standespolitik wirkt doch, Kammerwahl 2020
Ausgabe 6/2020
Ausgabe 6/2020
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6/<strong>2020</strong><br />
ahn<br />
ärzte<br />
blatt<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Informationen<br />
» aus mit der Informationen Zahn-, M<strong>und</strong>- aus <strong>und</strong> der<br />
Kieferheilk<strong>und</strong>e<br />
Zahn-, M<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kieferheilk<strong>und</strong>e<br />
9.2005<br />
Leitartikel<br />
Hierarchie <strong>und</strong><br />
LEITARTIKEL<br />
Beteiligung: Der<br />
Governance-Ansatz<br />
<strong>…</strong> <strong>und</strong> <strong>Standespolitik</strong> <strong>wirkt</strong><br />
<strong>doch</strong>, <strong>Kammerwahl</strong> <strong>2020</strong><br />
Titelthema<br />
Wählermeinung/<br />
Umfrageaktion TITELTHEMA zur<br />
B<strong>und</strong>estagswahl 2005<br />
Ein Berufsstand<br />
im Wandel<br />
Zahnärztekammer<br />
Außerordentliche VV: Eine<br />
neue liberale SONDERTHEMA<br />
Berufsordnung<br />
Zahnärzte praktizieren<br />
wieder uneingeschränkt<br />
Fortbildung<br />
Zahnerhaltung durch<br />
Wurzelspitzenresektion<br />
FORTBILDUNG<br />
Störungen der<br />
Sprachentwicklung
Home Stories<br />
100 Jahre, 20 visionäre Interieurs<br />
08.02.<strong>2020</strong> – 28.02.2021<br />
#VDMHomeStories<br />
#VitraDesignMuseum<br />
www.design-museum.de<br />
Hauptförderer<br />
Vitra<br />
Design<br />
Museum
Editorial 3<br />
über 65<br />
141<br />
Zahnärzteschaft Baden-Württemberg<br />
572<br />
61 – 65<br />
221<br />
598<br />
56 – 60<br />
394<br />
978<br />
46 – 55<br />
36 – 45<br />
bis 35<br />
734<br />
432<br />
905<br />
1256<br />
990<br />
850<br />
0 300 600 900 1200 1500<br />
Frauen Männer<br />
Abbildung: IZZ, Zahlen: KZV BW<br />
Foto: Dr. Riemekasten<br />
» Titelthema. In den kommenden Wochen<br />
wählen die berufsständischen „Kammerparlamente“<br />
auf Bezirks- <strong>und</strong> Landesebene ihre<br />
Repräsentant*innen, die antreten, um die berufliche<br />
Zukunft der baden-württembergischen Zahnärzteschaft<br />
für die nächsten vier Jahre zu gestalten.<br />
In seinem Leitartikel stellt der Präsident der<br />
Landeszahnärztekammer, Dr. Torsten Tomppert,<br />
die Frage, warum <strong>Standespolitik</strong> so wichtig ist <strong>und</strong><br />
bleibt. Die letzten Wochen haben mit ihren zahlreichen<br />
Verhandlungen mit der Landesregierung, den<br />
internen Diskussionen <strong>und</strong> Beratungen, der Organisation<br />
von medizinischen Schutzmasken <strong>und</strong> damit<br />
gezielten Hilfestellungen für die Zahnärzteschaft<br />
Baden-Württembergs deutliche Antworten darauf<br />
gegeben. Die Körperschaften sind das Sprachrohr<br />
für den zahnmedizinischen Berufsstand <strong>und</strong> dieser<br />
Anspruch wurde in den vergangenen Wochen der<br />
Krisenzeit mehr als erfüllt.<br />
Dem Titelthema „Standespolitischer Nachwuchs“,<br />
kann man sich leichter nähern, betrachtet<br />
man den Wandel des zahnärztlichen Berufsbildes.<br />
Benedikt Schweizer von der KZV sieht den Strukturwandel<br />
innerhalb der Zahnärzteschaft in vollem<br />
Gange. War die Zahnmedizin jahrzehntelang ein<br />
männlich dominiertes Feld, ergreifen heute deutlich<br />
mehr Frauen den Beruf. Zudem ist das Anstellungsverhältnis<br />
im Kommen, egal ob in einer Einzelpraxis,<br />
einer BAG oder in einem MVZ. Darüber<br />
hinaus sollen zum Wintersemester <strong>2020</strong>/21 auch<br />
Änderungen im Studiengang umgesetzt werden.<br />
Wohin führt der Weg? Lesen Sie es auf den Seiten<br />
8 <strong>und</strong> 9.<br />
» Sonderthema. Wie mit jeder Krise geht die<br />
Menschheit auch mit COVID-19 unterschiedlich um.<br />
Die Zukunft ist eben nicht die Verlängerung der<br />
Vergangenheit <strong>und</strong> damit gilt es, in veränderten<br />
Situationen, neue Wege zu finden. Macht dem<br />
einen das Virus Angst, empfindet der andere die<br />
Belastung als eher gering. Dennoch lässt sich mit<br />
Sicherheit sagen, dass sich der Ablauf in nahezu<br />
jeder Praxis seither beträchtlich verändert hat:<br />
Versorgungsengpässe, ausbleibende Patienten,<br />
drohende Insolvenzen. Und dennoch verweigert die<br />
Politik den Zahnarztpraxen die dringend benötigte<br />
Hilfe in der Corona-Krise: Statt des angekündigten<br />
Rettungsschirms gibt es nur eine Liquiditätshilfe,<br />
die zu 100 Prozent zurückgezahlt werden muss.<br />
Demzufolge ist die zahnärztliche Versorgung nicht<br />
sytemrelevant. Wäre es dann nicht aber relevant,<br />
das System zu ändern?<br />
Wie haben die Zahnärzte im Land die letzten<br />
Wochen gemeistert? Wie haben Sie <strong>und</strong> Ihr Praxisteam<br />
gearbeitet? Hatten Sie genügend Schutzausrüstung?<br />
Welche Auswirkungen hatte die Corona-<br />
Verordnung der Landesregierung <strong>und</strong> Paragraf<br />
6a, der den Praxen lediglich Notfallbehandlungen<br />
gestattete, bevor das Sozialministerium Auslegungshinweise<br />
nachschob <strong>und</strong> den Paragrafen<br />
aufgehoben hat? Lesen Sie hierzu unsere Berichte<br />
direkt aus den Praxen.<br />
» Störungen der Sprachentwicklung. Zu den<br />
Aufgaben eines Zahnarztes gehört die regelmäßige<br />
Kontrolle der Gebissentwicklung in den Phasen<br />
des Milch- <strong>und</strong> Wechselgebisses. Bei diesbezüglichen<br />
Auffälligkeiten sollte eine Überweisung zu einem<br />
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ausgestellt<br />
werden, der den rechtzeitigen Beginn einer erforderlichen<br />
kieferorthopädischen Therapie einleiten<br />
kann. Häufig sind Zahn- oder Kieferfehlstellungen<br />
mit anderen Störungen im orofazialen Bereich vergesellschaftet.<br />
Hierbei steht natürlich die<br />
Entwicklung der Sprache im Vordergr<strong>und</strong>, aber<br />
auch myofunktionelle Störungen, Stimme, Haltung<br />
<strong>und</strong> das Schluckmuster. In einem Übersichtsartikel<br />
werden Störungen der Entwicklung der Sprache,<br />
sogenannte Dyslalien oder Artikulationsstörungen,<br />
genauer beleuchtet. Dr. Sandra Riemekasten von<br />
der Poliklinik für Kieferorthopädie der Universität<br />
Leipzig hat das Thema für Sie ausgearbeitet.<br />
Cornelia Schwarz<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
4<br />
Inhalt<br />
Leitartikel<br />
Berufspolitik<br />
7<br />
Dr. Torsten Tomppert<br />
<strong>…</strong> <strong>und</strong> <strong>Standespolitik</strong> <strong>wirkt</strong> <strong>doch</strong>,<br />
<strong>Kammerwahl</strong> <strong>2020</strong><br />
14<br />
Zahn-Pflege goes Generalistik<br />
Alleine schafft es keiner!<br />
Titelthema<br />
15<br />
IDZ-Hygienekostenstudie<br />
Hygienekosten in Baden-Württemberg<br />
am höchsten<br />
8<br />
Hintergr<strong>und</strong>bericht<br />
Ein Berufsstand im Wandel<br />
Sonderthema<br />
10<br />
Aktionen der zahnärztlichen Körperschaften<br />
für den zahnärztlichen Nachwuchs<br />
Fit in die Zukunft<br />
16<br />
Corona-Pandemie<br />
Stimmungsbilder aus den Praxen in<br />
Baden-Württemberg<br />
11<br />
Initiativen der Bezirke für junge Zahnärzt*innen<br />
Netzwerken mit dem Nachwuchs<br />
21<br />
Standespolitische Arbeit erfolgreich –<br />
Aufhebung von Paragraf 6a<br />
Zahnärzte praktizieren wieder<br />
uneingeschränkt<br />
12<br />
Überlegungen zur Nachfolgeregelung<br />
Eine Praxis – zwei Generationen<br />
22<br />
Engagement der Standesvertretung<br />
Aktiv in der Krise<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Inhalt 5<br />
Sonderthema<br />
Praxis<br />
36<br />
Der GOZ-Ausschuss der LZK BW informiert<br />
Zweierlei Maß<br />
24<br />
Dr. Stefan Brink<br />
BW-Datenschutzbeauftragter zu Corona-Ges<strong>und</strong>heitsdaten<br />
„Ges<strong>und</strong>heitsdaten sind besonders geschützte<br />
Informationen“<br />
37<br />
Antworten, Orientierung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
MPG-Praxisbegehung:<br />
Neue FAQ <strong>und</strong> Leitfaden-Neuversion<br />
Kultur<br />
26<br />
Nachweis von COVID-19-Infektionen<br />
Welche Corona-Antikörpertests sind präzise?<br />
39<br />
Werke der Sammlungen Frieder, Hubert<br />
<strong>und</strong> Franz Burda<br />
Meisterwerke des Expressionismus<br />
Rubrik<br />
28<br />
30<br />
31<br />
In Praxen läuft der „Normalbetrieb“ wieder an<br />
Niedergelassene Ärzte dürfen wieder den<br />
früheren Versorgungsumfang aufnehmen<br />
Bericht aus einer Schwerpunktpraxis<br />
Verantwortung übernehmen, Versorgung<br />
aufrechterhalten<br />
Fortbildung<br />
Phonetische Funktion des orofazialen Systems<br />
Störungen der Sprachentwicklung<br />
3 Editorial<br />
40 Amtliche<br />
Mitteilungen<br />
45 Personalia<br />
Internet<br />
50 Namen <strong>und</strong><br />
Nachrichten<br />
51 Zu guter Letzt/<br />
Impressum<br />
Besuchen Sie auch die ZBW-Website<br />
» www.zahnaerzteblatt.de<br />
Neben der Online-Ausgabe des ZBW gibt es zusätzliche<br />
Informationen, Fotos, weiterführende Links<br />
sowie ein ZBW-Archiv.<br />
Praxis auf einen Blick<br />
» Die aktuelle Pinnwand mit<br />
neuen FAQ <strong>und</strong> einer Leitfaden-<br />
Neuversion der MPG-Praxisbegehung<br />
finden Sie hier. Einfach Code<br />
einscannen <strong>und</strong> lesen.<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
Landeszahnärztekammer BaWü Körperschaft des Öffentlichen Rechts<br />
AKADEMIE<br />
FORTBILDUNGSANGEBOT.<br />
Lorenzstraße 7, 76135 Karlsruhe, Fon 0721 9181-200, Fax 0721 9181-222, Email: fortbildung@za-karlsruhe.de<br />
Juni <strong>2020</strong><br />
Kurs Nr. 8961/8 Punkte<br />
Die Zunge – alles was der Zahnarzt über sie wissen muss<br />
Referent: Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel<br />
Datum: 26.06.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 490 €<br />
Kurs Nr. 8971/8 Punkte<br />
Der spezielle Patient – wenn das Problem nicht nur der Zahn ist<br />
Referentin: PD Dr. Anne Wolowski, Münster<br />
Datum: 27.06.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 300 €<br />
Juli <strong>2020</strong><br />
Kurs Nr. 8987/13 Punkte<br />
Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD): pathophysiologische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, Diagnostik, Therapie<br />
Referenten: Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe<br />
PD Dr. Daniel Hellmann, Karlsruhe<br />
Datum: 17.-18.07.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 600 €<br />
Kurs Nr. 9077<br />
Röntgenkurs für die Zahnmedizinische Fachangestellte<br />
Referent: Dr. Burkhard Maager, Denzlingen<br />
Datum: 30.07.-01.08.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 550 €<br />
September <strong>2020</strong><br />
Kurs Nr. 8982/8 Punkte<br />
Parodontitis- Organismus- Intervention<br />
Referenten: Prof. Dr. Christof Dörfer, Kiel,<br />
PD Dr. Christian Graetz, Kiel<br />
Datum: 11.09.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 550 €<br />
Kurs Nr. 8989/8 Punkte<br />
Die prothetische Versorgung des CMD-Patienten<br />
Referenten: Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe,<br />
Prof. Dr. Marc Schmitter, Würzburg<br />
Datum: 18.09.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 450 €<br />
Oktober <strong>2020</strong><br />
Kurs Nr. 9067/18 Punkte<br />
Ästhetische Frontzahnrestaurationen mit Komposit<br />
Referent: Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg<br />
Datum: 09.-10.10.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 700 €<br />
Kurs Nr. 9087<br />
Die Rezeption - das Herz der Praxis!<br />
Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />
Datum: 16.10.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 180 €<br />
Kurs Nr. 9088<br />
Willkommen am Telefon - der erste Eindruck<br />
Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />
Datum: 17.10.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 180 €<br />
Kurs Nr. 8990/14 Punkte<br />
Praxisgerechte individuelle CMD-Therapie mit der modularen<br />
Rehabilitationsschiene: Arbeitskurs mit neuem Schienenkonzept<br />
Referenten: Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe<br />
PD Dr. Daniel Hellmann, Karlsruhe<br />
Datum: 23.-24.10.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 750 €<br />
Kurs Nr. 9075/9 Punkte<br />
Die hohe Schule des mechanischen Scaling - Erfolg durch eine<br />
systematische Arbeitsweise<br />
Referent: PD Dr. Christian Graetz, Kiel<br />
Datum: 24.10.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 350 €<br />
Save the Date<br />
Karlsruher Konferenz<br />
„100 Jahre Zahnmedizin – Visionen <strong>und</strong> Wege“<br />
Woher wir kommen, worauf es jetzt ankommt.<br />
Datum: 05.-07.11.<strong>2020</strong><br />
Kurs Nr. 9091/16<br />
Minimalinvasive Frontzahnästhetik mit Veneers & Co. – ein<br />
Arbeitskonzept für Zahnarzt <strong>und</strong> Zahntechniker<br />
Referent: PD Dr. Sven Rinke, M.Sc., Hanau<br />
Datum: 25.-26.09.<strong>2020</strong> Kurshonorar: 750 €
Leitartikel 7<br />
<strong>…</strong> <strong>und</strong> <strong>Standespolitik</strong> <strong>wirkt</strong> <strong>doch</strong>,<br />
<strong>Kammerwahl</strong> <strong>2020</strong><br />
Dieses Jahr ist <strong>Kammerwahl</strong>. Die 17. Kammerperiode wird am 1. Januar 2021 beginnen. In<br />
den kommenden Wochen wählen die berufsständischen „Kammerparlamente“ auf Bezirks- <strong>und</strong><br />
Landesebene ihre Repräsentant*innen, die antreten, um die berufliche Zukunft der badenwürttembergischen<br />
Zahnärzteschaft für die nächsten vier Jahre zu gestalten. Warum ist <strong>und</strong><br />
bleibt <strong>Standespolitik</strong> so wichtig? Kann <strong>Standespolitik</strong> in Corona-Zeiten <strong>und</strong> darüber hinaus<br />
überhaupt etwas bewirken? Eine Gr<strong>und</strong>voraussetzung dazu ist: Wählen <strong>und</strong> entscheiden Sie<br />
aktiv mit Ihrer Stimme – für eine starke berufliche Selbstverwaltung!<br />
In diesen schweren Wochen der Corona-Pandemie erreichen<br />
die Kammer <strong>und</strong> auch mich täglich Mails <strong>und</strong> Briefe<br />
aus der verunsicherten <strong>und</strong> besorgten Kollegenschaft<br />
mit vielen offenen, teils existenziellen Fragen. Auch verärgerte<br />
bis hin zu teils wütenden Kommentaren, die der<br />
<strong>Standespolitik</strong> eine „unerträgliche Ohnmacht <strong>und</strong> Sprachlosigkeit“<br />
gegenüber der aktuellen politischen Situation<br />
attestieren, fanden unsere Aufmerksamkeit.<br />
Die letzten Wochen waren standespolitisch betrachtet<br />
außergewöhnlich nervenzehrend <strong>und</strong> aufreibend. Im gemeinsamen<br />
Schulterschluss haben die verantwortlichen<br />
Ehrenamtsträger*innen <strong>und</strong> Vorstände von Kammer <strong>und</strong><br />
KZV in persönlichen Gesprächen <strong>und</strong> mittels zahlreicher<br />
Briefe an die ministerielle Ebene in B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Land alles<br />
getan, um die Politik auf die prekäre berufliche Situation<br />
der Kollegenschaft gezielt hinzuweisen <strong>und</strong> zügige Maßnahmen<br />
zur Verbesserung der unbefriedigenden Situation<br />
einzufordern.<br />
Die Zuspitzung der beruflichen Situation erfolgte am<br />
Gründonnerstag um 22 Uhr. Die Landesregierung erließ den<br />
§ 6a der vierten Corona-Verordnung unabgesprochen über<br />
Nacht (!), welche de facto einem Berufsverbot gleichkam.<br />
Durch die schnelle Reaktion der standespolitischen Entscheidungsträger<br />
wurden aber die über Ostern auf den Weg<br />
gebrachten Auslegungshinweise zur medizinisch notwendigen<br />
Behandlung ermöglicht. Mit der stringenten Forderung<br />
an die Landesregierung, diesen Paragrafen zurückzuziehen,<br />
trug die standespolitische Arbeit der zahnärztlichen Körperschaften<br />
nach mehreren Interventionen Früchte: Die Landesregierung<br />
nahm zum 4. Mai <strong>2020</strong> den umstrittenen § 6a<br />
aus der neuen Corona-Verordnung heraus.<br />
Zudem haben wir die aus unserer Sicht legitime, aber<br />
aus Landessicht nicht vorhandene Zugehörigkeit zur sogenannten<br />
systemrelevanten „kritischen Infrastruktur“<br />
gefordert <strong>und</strong> eine finanzielle Unterstützung angemahnt.<br />
Parallel dazu wurde die dringende Auslieferung von medizinischen<br />
Schutzmasken in Krisensitzungen mit der<br />
Landesregierung immer wieder ins Gespräch gebracht,<br />
welche von dieser je<strong>doch</strong> nicht in ausreichender Menge<br />
zur Verfügung gestellt werden konnten, sodass Masken<br />
durch die LZK <strong>und</strong> die KZV für die Kollegenschaft selbst<br />
organisiert <strong>und</strong> finanziert worden sind!<br />
Diese Beispiele zeigen, wie bedeutsam <strong>Standespolitik</strong><br />
gerade in der aktuellen Corona-Krise ist, um der Kollegenschaft<br />
gezielte Hilfestellungen <strong>und</strong> Orientierung zu<br />
geben. Die zahnärztlichen Körperschaften dienen somit<br />
als wirkungsvolles Sprachrohr für die zahlenmäßig relativ<br />
kleine Berufsgruppe mit r<strong>und</strong> 12.000 Kammermitgliedern<br />
im Land. Der Berufsstand sendet damit nach außen<br />
ein starkes Signal an die Gesellschaft. Die Zahnärzt*innen<br />
erfüllen flächendeckend ihren gesellschaftlichen Auftrag,<br />
für die Patienten*innen auch in Krisensituationen verantwortungsvoll<br />
da zu sein.<br />
Besonders in der Post-Corona-Phase werden zahlreiche<br />
standespolitische Herausforderungen auf die Kammer<br />
zukommen. Die Nachwehen der Krise werden Themen<br />
wie zum Beispiel steigende Hygienekosten, geringere<br />
Einnahmen oder die delirierenden Informationen des<br />
RKI aufbringen. Des Weiteren werden für die Zukunft<br />
der zahnärztlichen Profession <strong>und</strong> die Arbeit der berufspolitischen<br />
Selbstverwaltung gesellschaftliche Entwicklungen<br />
wie die fortschreitende Kommerzialisierung der<br />
Medizin, die Chancen <strong>und</strong> Risiken der Digitalisierung<br />
oder der steigende Einfluss Europas eine zunehmend bedeutende<br />
Rolle spielen. Für eine starke Selbstverwaltung<br />
ist ebenso eine hohe Wahlbeteiligung unabdingbar, weil<br />
dadurch eine hohe Legitimationsbasis für die späteren<br />
Entscheidungen in den zu wählenden Kammerorganen<br />
<strong>und</strong> Gremien erreicht wird. Gleichzeitig wird nach außen<br />
signalisiert, dass die Kammer eine gut funktionierende<br />
berufsständische Selbstverwaltung darstellt, die nicht nur<br />
den gesamten Berufsstand vertritt, sondern auch wichtige<br />
hoheitliche Aufgaben für den Staat <strong>und</strong> die Bevölkerung<br />
übernimmt. Damit zeigt sich, dass gelebte Freiberuflichkeit<br />
auch einen hohen Nutzen für die Gesellschaft hat.<br />
Deshalb rufe ich alle auf, von ihrem Wahlrecht aktiv<br />
Gebrauch zu machen <strong>und</strong> damit ihrer Verantwortung für<br />
einen selbst zu gestaltenden Berufsstand gerecht zu werden.<br />
Denken Sie daran: Es geht auch um Ihre berufliche<br />
Zukunft!<br />
Dr. Torsten Tomppert,<br />
Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
8<br />
Titelthema<br />
Hintergr<strong>und</strong>bericht<br />
Ein Berufsstand im Wandel<br />
Der Strukturwandel in der Zahnärzteschaft ist in vollem Gange:<br />
War die Zahnmedizin jahrzehntelang ein männlich dominiertes Feld,<br />
ergreifen heute deutlich mehr Frauen den Beruf als Männer. Das<br />
Anstellungsverhältnis ist im Kommen, egal ob in einer Einzelpraxis, einer<br />
BAG oder in einem MVZ. Darüber hinaus sollen zum Wintersemester<br />
<strong>2020</strong>/21 auch Änderungen im Studiengang umgesetzt werden. Wohin<br />
führt der Weg? Eine Darstellung der aktuellen Entwicklungen.<br />
Herausforderndes Studium. Wer<br />
in Deutschland Zahnärztin oder<br />
Zahnarzt werden möchte, muss<br />
studieren. In Baden-Württemberg<br />
ist dies an den Standorten Freiburg,<br />
Heidelberg, Tübingen <strong>und</strong><br />
Ulm möglich. Dabei werden die<br />
Weichenstellungen der zahnmedizinischen<br />
Ausbildung an den Universitäten<br />
entschieden. Seit 1955<br />
galt unverändert dieselbe zahnärztliche<br />
Approbationsordnung, erst<br />
2019 verabschiedete der B<strong>und</strong>esrat<br />
eine Verordnung zur Neuregelung<br />
der zahnärztlichen Ausbildung,<br />
deren Umsetzung in zwei Schritten<br />
beginnend mit dem Wintersemester<br />
im Herbst <strong>2020</strong> erfolgen<br />
soll. Was ändert sich nun mit der<br />
Einführung? Ursprünglich war geplant<br />
gewesen, dass Studierende<br />
der Zahnmedizin <strong>und</strong> der Humanmedizin<br />
die Vorklinik gemeinsam<br />
absolvieren. Diese Reform wird<br />
über 65<br />
61 – 65<br />
56 – 60<br />
46 – 55<br />
36 – 45<br />
bis 35<br />
141<br />
221<br />
394<br />
432<br />
572<br />
598<br />
0 300 600 900 1200 1500<br />
Frauen<br />
734<br />
Männer<br />
Zahnärzteschaft Baden-Württemberg. Verteilung Männer <strong>und</strong> Frauen in Altersgruppen.<br />
850<br />
905<br />
978<br />
990<br />
1256<br />
aber vorerst verschoben. Dafür<br />
ist geplant, dass sich das Zahlenverhältnis<br />
von Lehrenden zu Studierenden<br />
in den Praxisteilen verbessert,<br />
Ausbildungsinhalte neu<br />
gewichtet werden – beispielsweise<br />
soll der Strahlenschutz <strong>und</strong> die<br />
wissenschaftliche Kompetenz im<br />
Studium verstärkt werden – sowie<br />
mehr medizinische Unterrichtsveranstaltungen<br />
Platz finden. Fest<br />
steht: Das Studium wird herausfordernd<br />
bleiben.<br />
In einer Befragung der Uni Konstanz<br />
lagen Zahnmediziner gar auf<br />
Platz 2 der zeitintensivsten Studiengänge.<br />
Die Anforderungen an<br />
Studierende sind vielfältig: Eine<br />
Befragung unter der Professorenschaft<br />
vom Centrum für Hochschulentwicklung<br />
(CHE) ergab,<br />
dass neben einer Affinität zu Naturwissenschaften<br />
<strong>und</strong> Technik<br />
auch Sozialkompetenz, Lernbereitschaft<br />
<strong>und</strong> Belastbarkeit hilfreiche<br />
Eigenschaften sind.<br />
Der zeitliche Rahmen des Studiums<br />
bleibt in Zukunft gleich.<br />
Drei staatliche Prüfungen sind<br />
über einen Zeitraum von mindestens<br />
fünf Jahren beziehungsweise<br />
zehn Semestern angesetzt. Für die<br />
Anerkennung von Prüfungen soll<br />
zukünftig gelten, dass Absolventen<br />
einer deutschen Universität <strong>und</strong><br />
ausländische Antragsteller auf Erteilung<br />
einer Berufserlaubnis gleich<br />
behandelt werden.<br />
Steigender Frauenanteil. Beim<br />
Blick auf die Studierendenzahlen<br />
der Zahnmedizin fällt auf, dass seit<br />
den 2000er-Jahren der Anteil der<br />
Studienanfängerinnen stark angestiegen<br />
ist. Mitte der 1990er Jahre<br />
lag ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis<br />
vor, nach neuesten<br />
Zahlen beträgt der Frauenanteil bei<br />
Studienanfängern in Baden-Württemberg<br />
r<strong>und</strong> 75 Prozent. Während<br />
aktuell mit 58 Prozent noch mehr<br />
Männer in dem Beruf arbeiten, werden<br />
in wenigen Jahren die Zahnärztinnen<br />
in der Mehrheit sein. Anders<br />
formuliert: Der Zahnarzt der Zukunft<br />
ist meistens eine Zahnärztin.<br />
Und im Gegensatz zur anfänglichen<br />
Diskussion haben inzwischen viele<br />
verstanden, dass damit auch positive<br />
Veränderungen zusammenhängen<br />
<strong>und</strong> im Wandel auch Chancen<br />
liegen.<br />
Vielfalt der Berufsausübung.<br />
So wurden z. B. durch den wachsenden<br />
Frauenanteil im Beruf dringend<br />
erforderliche Änderungen<br />
bezüglich der Rahmenbedingungen<br />
bei der Berufsausübung angestoßen.<br />
Hiervon profitiert der gesamte<br />
Berufsstand. Arbeit in Teilzeit <strong>und</strong><br />
mehr Vielfalt bei den Praxisstrukturen<br />
– junge Zahnärztinnen <strong>und</strong><br />
Zahnärzte bringen neue Zielvorstellungen<br />
mit, <strong>und</strong> neben die niedergelassene<br />
Zahnärztin bzw. den niedergelassenen<br />
Zahnarzt in der selbstständigen<br />
Einzelpraxis treten in<br />
immer mehr Fällen andere Formen<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 9<br />
der Berufsausübung, etwa in größeren<br />
Praxis-Kooperationen. Hinzu<br />
kommen Teilzulassungen, häufigere<br />
Ortswechsel anstelle jahrzehntelanger<br />
Arbeit in ein <strong>und</strong> derselben<br />
Praxis oder auch Pausen aufgr<strong>und</strong><br />
von Mutterschutz <strong>und</strong> Elternzeit für<br />
Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzte.<br />
In der Niederlassung scheint insbesondere<br />
die Form der BAG oder<br />
ÜBAG attraktiv zu sein. Dies ergab<br />
auch eine von der KZV Baden-<br />
Württemberg in Auftrag gegebene<br />
forsa-Studie aus dem Vorjahr<br />
unter angestellten Zahnärztinnen<br />
<strong>und</strong> Zahnärzten: Eine überwiegende<br />
Mehrheit sprach sich hier für<br />
eine Niederlassung in einer BAG/<br />
ÜBAG gegenüber einer Einzelpraxis<br />
aus.<br />
Anstellung im Kommen. Darüber<br />
hinaus setzt sich der Trend zur<br />
Anstellung fort. Die Zahl derer, die<br />
zumindest nicht sofort eine eigene<br />
Niederlassung anstreben, steigt mit<br />
jedem Jahr. Der aktuellsten Erhebung<br />
der KZV Baden-Württemberg<br />
nach, ist im Jahr <strong>2020</strong> bereits r<strong>und</strong><br />
ein Viertel der Zahnärztinnen <strong>und</strong><br />
Zahnärzte in Anstellung tätig. Die<br />
Gründe, weswegen nach Studium<br />
<strong>und</strong> Assistenzzeit die Entscheidung<br />
für eine Arbeit in Anstellung anstatt<br />
der Selbstständigkeit fällt, sind<br />
vielfältig. Sowohl die persönliche<br />
Lebensplanung als auch die eigenen<br />
Vorstellungen <strong>und</strong> Ziele im Beruf<br />
sind damit unmittelbar verknüpft.<br />
Betrachtet man das Geschlechterverhältnis<br />
der angestellten Zahnärztinnen<br />
<strong>und</strong> Zahnärzte, wird deutlich,<br />
dass Frauen überdurchschnittlich<br />
oft in Anstellung arbeiten: Lediglich<br />
35 Prozent der angestellten<br />
Zahnärzte sind männlich, 65 Prozent<br />
sind weiblich. Die forsa-Studie<br />
unter angestellten Zahnärztinnen<br />
<strong>und</strong> Zahnärzten (2019) ergab, dass<br />
für die männlichen Befragten vor<br />
allem die Arbeit im Team <strong>und</strong> mehr<br />
Zeit für persönliche Interessen ausschlaggebend<br />
für die Anstellung<br />
sind, bei den weiblichen Befragten<br />
überwiegt der Wunsch nach Vereinbarkeit<br />
von Beruf <strong>und</strong> Familie.<br />
Zukunftsreferenten. Was bedeutet<br />
dieser Wandel für die Zahnmedizin<br />
der Zukunft? Die KZV<br />
Baden-Württemberg widmet sich<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2019<br />
<strong>2020</strong><br />
MVZ<br />
Praxisstrukturen in Baden-Württemberg. Neben die niedergelassene Zahnärztin<br />
bzw. den niedergelassenen Zahnarzt in der selbstständigen Einzelpraxis treten in immer<br />
mehr Fällen andere Formen der Berufsausübung, etwa in größeren Praxis-Kooperationen.<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
19<br />
55<br />
80<br />
133<br />
165<br />
982<br />
955<br />
925<br />
903<br />
891<br />
0 1000 2000 3000 4000 5000<br />
Berufsausübungsgemeinschaften (BAG + ÜBAG)<br />
1214<br />
771<br />
443<br />
1352<br />
874<br />
478<br />
Einzelpraxen (EP)<br />
dem Thema Zukunftsmanagement<br />
intensiv: So wurden Denkwerkstätten<br />
gegründet <strong>und</strong> mit Dr. Florentine<br />
Carow-Lippenberger eine<br />
Vorstandsreferentin für Frauen <strong>und</strong><br />
Angestellte in der Selbstverwaltung<br />
sowie mit Dr. Christian Engel ein<br />
Zukunftsreferent ernannt, um gezielt<br />
die Perspektive junger Vertreterinnen<br />
<strong>und</strong> Vertreter der Zahnärzteschaft<br />
einzubringen. „Mein Ziel<br />
ist es, Impulse zu geben, wie die<br />
Zahnheilk<strong>und</strong>e auch für die kommenden<br />
Zahnärztegenerationen attraktiv<br />
bleiben kann“, so Dr. Carow-<br />
Lippenberger. Für Dr. Engel ist es<br />
insbesondere wichtig, „eine Brücke<br />
zwischen dem Altbewährten <strong>und</strong><br />
den neuen Trends zu schlagen.“ Für<br />
die KZV Baden-Württemberg ist<br />
dabei klar, dass trotz der vielfältigen<br />
strukturellen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Veränderungen die hohe Qualität<br />
der flächendeckenden, wohnortnahen<br />
zahnärztlichen Versorgung im<br />
Land nie infrage stehen darf.<br />
Benedikt Schweizer<br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019 <strong>2020</strong><br />
weiblich<br />
1530<br />
984<br />
546<br />
männlich<br />
gesamt<br />
Entwicklung angestellte Zahnärzt*innen. Betrachtet man das Geschlechterverhältnis<br />
der angestellten Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzte, wird deutlich, dass Frauen überdurchschnittlich<br />
oft in Anstellung arbeiten.<br />
1687<br />
1077<br />
610<br />
1866<br />
1188<br />
678<br />
4152<br />
4090<br />
4061<br />
4250<br />
4208<br />
1971 2066<br />
1247<br />
724<br />
1345<br />
721<br />
Abbildung: IZZ, Zahlen: KZV BW<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
10<br />
Titelthema<br />
Aktionen der zahnärztlichen Körperschaften für den zahnärztlichen Nachwuchs<br />
Fit in die Zukunft<br />
Foto: Beck<br />
Mit „FutureNow – Junge Zahnärzte in Baden-Württemberg“ hat die<br />
Landeszahnärztekammer (LZK) im Jahr 2014 ein umfangreiches<br />
Projekt ins Leben gerufen. Es richtet sich vor allem an junge Zahnärztinnen<br />
<strong>und</strong> Zahnärzte beim Übergang vom Studium ins Berufsleben,<br />
während ihrer Assistenzzeit <strong>und</strong> zu Beginn ihrer Berufsausübung. Ziel<br />
des Projekts ist es, diesen Personenkreis auf ihre Existenzgründung<br />
<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Herausforderungen vorzubereiten <strong>und</strong> den<br />
fachlichen Austausch untereinander zu fördern. Seit dem Jahr 2015<br />
wird der Arbeitskreis als gemeinsamer Arbeitskreis – von Landeszahnärztekammer<br />
<strong>und</strong> Kassenzahnärztlicher Vereinigung – fortgeführt.<br />
Voller Einsatz. Fachschaftsvertreter der Uni Freiburg mit Vorstandsmitgliedern der<br />
BZK Freiburg.<br />
Mit verschiedenen Aktivitäten <strong>und</strong><br />
Maßnahmen werden den jungen<br />
Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzten Orientierungshilfen<br />
im Rahmen der<br />
zahnärztlichen Berufsausübung gegeben,<br />
sodass nach Möglichkeit eine<br />
optimale Unterstützung in den ersten<br />
Berufsjahren erfolgen kann.<br />
LZK-Internetangebot. Auf der<br />
Webseite der LZK finden sich unter<br />
der Rubrik „Zahnärzte Neuapprobierte<br />
<strong>und</strong> junge Zahnärzte“ verschiedene<br />
Informationsflyer, die in den unterschiedlichen<br />
Phasen der Berufsausübung<br />
als verlässliche Informationsquelle<br />
genutzt werden können. Auch<br />
stehen hier Ansprechpartner*innen<br />
mit den Kontaktdaten in den Zahnärztehäusern<br />
Freiburg, Karlsruhe,<br />
Stuttgart <strong>und</strong> Tübingen für jedwede<br />
Frage bereit. Darüber hinaus finden<br />
sich weitere Inhalte, die wichtige<br />
Themenbereiche r<strong>und</strong> um das Thema<br />
Existenzgründung beleuchten.<br />
So werden Informationen über die<br />
Formen zahnärztlicher Berufsausübung<br />
zur Verfügung gestellt <strong>und</strong> zusätzlich<br />
Infobriefe von den Themen<br />
„Erste Schritte nach dem Examen“<br />
über „Versicherungen“ bis hin zu<br />
den „Weiterbildungsmöglichkeiten“<br />
für die jungen Kammermitglieder detailliert<br />
beleuchtet. Ergänzend finden<br />
sich Checklisten für mögliche Praxisübernahmen<br />
<strong>und</strong> andere Themenbereiche,<br />
die im Rahmen der weiteren<br />
Berufsorientierung Sicherheit <strong>und</strong><br />
Verlässlichkeit geben sollen <strong>und</strong> somit<br />
bei anstehenden Entscheidungen<br />
unterstützen können.<br />
Netzwerken. Im Rahmen von<br />
dreitägigen Existenzgründer-Workshops<br />
werden gemeinsam mit jungen<br />
Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzten verschiedene<br />
Themen <strong>und</strong> unterschiedliche<br />
Wege in eine mögliche Selbstständigkeit<br />
beleuchtet. Netzwerken,<br />
Fortbildung <strong>und</strong> ein attraktives Freizeitprogramm<br />
sind der Garant für<br />
dieses Erfolgsmodell. Insbesondere<br />
Themen wie:<br />
• Vorstellung der zahnärztlichen<br />
Körperschaften,<br />
• Erste Schritte in das zahnärztliche<br />
Berufsleben,<br />
• Wandel im Bereich der zahnärztlichen<br />
Werbung,<br />
• Optimierung von Patientengesprächen<br />
<strong>und</strong><br />
• Berechnung nach BEMA <strong>und</strong><br />
GOZ, wurden in den letzten Jahren<br />
ausführlich behandelt <strong>und</strong> konnten<br />
so Impulse für die tägliche Arbeit<br />
im zahnärztlichen Berufsleben setzen.<br />
Zudem finden bereits seit einigen<br />
Jahren an den baden-württembergischen<br />
Universitäten in Freiburg <strong>und</strong><br />
Tübingen SummerDentivals bzw.<br />
Zahnikicke/Sommerfeste statt. Hier<br />
soll bereits der junge, noch studentische<br />
zahnärztliche Nachwuchs<br />
abgeholt <strong>und</strong> dabei in Erfahrung gebracht<br />
werden, welche Themen die<br />
Studierenden interessieren <strong>und</strong> wo<br />
die zahnärztlichen Körperschaften<br />
unterstützen können. Gemeinsam mit<br />
den Fachschaften <strong>und</strong> Studierenden<br />
findet somit ein regelmäßiges Netzwerken<br />
statt. Das Netzwerken wird<br />
insofern konsequent fortgeführt, als<br />
die Fachschaftsvertreter*innen auch<br />
regelmäßig bei den Sitzungen des<br />
Arbeitskreises FutureNow anwesend<br />
sind <strong>und</strong> direkt bestimmte Themen<br />
platzieren können.<br />
Regionale Aktivitäten. Verschiedene<br />
regionale Aktionen in den Bereichen<br />
Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart<br />
<strong>und</strong> Tübingen r<strong>und</strong>en das Angebot<br />
für die jungen Zahnärztinnen <strong>und</strong><br />
Zahnärzte ab. Somit wird der Kontakt<br />
an verschiedenen Orten <strong>und</strong> zu<br />
unterschiedlichen Zeiten der Berufsausübung<br />
gepflegt <strong>und</strong> weiter ausgebaut.<br />
Daran gilt es anzuknüpfen <strong>und</strong><br />
weitere Maßnahmen sowie Hilfsmittel<br />
zu entwickeln, um den zahnärztlichen<br />
Nachwuchs zielführend zu<br />
unterstützen. Thorsten Beck<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 11<br />
Initiativen der Bezirke für junge Zahnärzt*innen<br />
Netzwerken mit dem Nachwuchs<br />
Auf Bezirksebene gibt es vonseiten der zahnärztlichen Körperschaften<br />
schon seit vielen Jahren die Bemühungen, jungen Zahnärztinnen<br />
<strong>und</strong> Zahnärzten den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern <strong>und</strong> ihnen<br />
aufzuzeigen, welche Hilfestellungen ihnen von Kammer <strong>und</strong> KZV entgegen<br />
gebracht werden. Auf Landesebene fließen sämtliche Aktionen<br />
inzwischen im Arbeitskreis FutureNow zusammen. Die Angebote der<br />
zahnärztlichen Selbstverwaltungen in den Bezirken sind vielfältig <strong>und</strong><br />
dienen gleichzeitig der Kontaktaufnahme, um den zahnärztlichen Nachwuchs<br />
zu motivieren, sich an der standespolitischen Arbeit zu beteiligen.<br />
Beliebte Veranstaltung. Die Young Dentist Lounge erfreut sich als Netzwerkveranstaltung<br />
in Karlsruhe großer Beliebtheit.<br />
Bereits während des Studiums stehen<br />
den Studierenden in den vier Bezirkszahnärztekammern<br />
Freiburg, Karlsruhe,<br />
Stuttgart <strong>und</strong> Tübingen spezielle<br />
Ansprechpartner zur Verfügung,<br />
die als Bindeglied zwischen Universität<br />
<strong>und</strong> Körperschaft auftreten <strong>und</strong><br />
sich auch nach dem Studium für die<br />
Berufseinsteiger einsetzen. Als Unibeauftragte/Ansprechpartner<br />
für junge<br />
Zahnärzt*innen stehen folgende<br />
Personen bereit:<br />
• Bezirk Freiburg: Dr. Helen Schulz<br />
• Bezirk Karlsruhe: Dr. Florian Mannl<br />
• Bezirk Stuttgart: Dr. Sarah Bühler<br />
• Bezirk Tübingen: Dr. Dr. Heiner<br />
Schneider, Dr. Elmar Ludwig<br />
Sie treten regelmäßig zum Gedankenaustausch<br />
in Kontakt mit den<br />
Fachschaften <strong>und</strong> beantworten Fragen.<br />
Sie sind auch die Schnittstelle<br />
zum Arbeitskreis „FutureNow“ <strong>und</strong><br />
liefern dort Informationen für weitere<br />
zielgruppengerechte Angebote.<br />
Bezirk Freiburg. Im Zahnärztehaus<br />
Freiburg hat der Infoabend<br />
für Studierende inzwischen einen<br />
festen Platz im Kalender. Die BZK<br />
Freiburg <strong>und</strong> die KZV BW Bezirksdirektion<br />
Freiburg laden regelmäßig<br />
Studierende der Zahnmedizin im<br />
neunten Semester ein, um den Abschluss<br />
der Berufsk<strong>und</strong>evorlesungen<br />
feierlich zu begehen. Neben einem<br />
vielfältigen Informationsangebot<br />
zur Orientierung nach dem Examen<br />
bietet anschließend das gesellige<br />
Beisammensein die Möglichkeit, in<br />
einen intensiven Austausch zu treten<br />
<strong>und</strong> vom Erfahrungsschatz der Referenten<br />
der Berufsk<strong>und</strong>evorlesungen<br />
zu profitieren.<br />
Bezirk Karlsruhe. Bei den jungen<br />
Zahnärzt*innen im Bezirk Karlsruhe<br />
hat sich die „Young Dentist Lounge“<br />
in den Räumen der Akademie Karlsruhe<br />
als Netzwerkveranstaltung etabliert.<br />
Zweimal im Jahr treffen hier<br />
die Kreisvorsitzenden aus allen acht<br />
Kreisen des Bezirks mit dem zahnärztlichen<br />
Nachwuchs zusammen,<br />
um sich auszutauschen <strong>und</strong> wichtige<br />
Foto: Akademie Karlsruhe<br />
Kontakte aufzubauen. In Heidelberg<br />
hat außerdem das Get-together im<br />
Bootshaus Heidelberg mit Studierenden<br />
bzw. Absolventen der Berufsfachk<strong>und</strong>evorlesung<br />
inzwischen<br />
Tradition. Auch hier wird von allen<br />
Beteiligten ein intensives Netzwerken<br />
betrieben.<br />
Bezirk Stuttgart. Die BZK<br />
Stuttgart ist im Sommer 2019 mit<br />
einem neuen Veranstaltungsformat<br />
auf die neuen <strong>und</strong> jungen Kammermitglieder<br />
zugegangen. Im Rahmen<br />
der Sommerakademie in Ludwigsburg<br />
gab es einen „Welcome<br />
Day“, bei dem die berufspolitischen<br />
Vertreter*innen in legerer <strong>und</strong> ungezwungener<br />
Atmosphäre mit den<br />
neuen Kammermitgliedern zusammentrafen,<br />
um ihre Aufgabengebiete<br />
vorzustellen <strong>und</strong> sich anschließend<br />
kennenzulernen <strong>und</strong> auszutauschen.<br />
Bezirk Tübingen. Die standespolitische<br />
Nachwuchstagung, die<br />
die BZK Tübingen zusammen mit<br />
der KZV BW Bezirksdirektion Tübingen<br />
durchführt, gibt es schon<br />
seit mehr als 15 Jahren. Zu dieser<br />
zweitägigen Veranstaltung werden<br />
junge Zahnärzt*innen eingeladen,<br />
die sich in den ersten Jahren ihrer<br />
Praxistätigkeit befinden. Sie sollen<br />
dabei gezielt an standespolitische<br />
Themen herangeführt werden.<br />
Im Herbst 2019 verbrachten die<br />
Teilnehmer*innen die Nachwuchstagung<br />
im Biosphärengebiet Schwäbische<br />
Alb, um sich über die Aufgaben<br />
der BZK <strong>und</strong> KZV zu informieren<br />
<strong>und</strong> zu diskutieren.<br />
Sämtliche Veranstaltungen auf Bezirksebene<br />
zeigen: Sie sind wichtig,<br />
um den Berufsanfängern aufzuzeigen,<br />
welche Aufgaben die zahnärztlichen<br />
Körperschaften wahrnehmen<br />
<strong>und</strong> dass sie den Zahnärztinnen <strong>und</strong><br />
Zahnärzten in Baden-Württemberg<br />
mit Rat <strong>und</strong> Tat zur Seite stehen. Die<br />
zahnärztliche Berufsvertretung ist<br />
keine Selbstverständlichkeit, sondern<br />
lebt davon, dass sich möglichst<br />
viele daran beteiligen, gerade auch<br />
junge Menschen. Claudia Richter<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
12<br />
Titelthema<br />
Überlegungen zur Nachfolgeregelung<br />
Eine Praxis – zwei Generationen<br />
Es kann ein großes Glück sein, wenn die nächste Generation heranwächst<br />
<strong>und</strong> sich nicht nur für die privaten Neigungen der Eltern interessiert,<br />
sondern auch die berufliche Leidenschaft teilt. Es kann – aber oft müssen<br />
auch erst einmal Reibungen durchstanden werden, bevor die beiden<br />
Generationen konfliktfrei miteinander arbeiten können. Wie verhält es sich<br />
in der Praxis? Wir haben in Endingen-Königschaffhausen nachgefragt.<br />
ZBW: Die Übergabe eines Betriebs<br />
von der einen an die nächste Generation<br />
ist oft mit unterschiedlichen<br />
Emotionen verb<strong>und</strong>en.<br />
Manche Väter oder Mütter raten<br />
gar davon ab, andere wiederum<br />
sind zu begeistert <strong>und</strong> übersehen,<br />
dass Kinder gerne eigene Wege<br />
gehen würden. Wie war dies im<br />
Haus Heckle?<br />
Dr. Roland Heckle: Gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
kam Abraten nie infrage, denn in<br />
dem Moment, als klar war, dass<br />
meine Töchter auch Zahnmedizin<br />
studieren, war für mich klar, dass<br />
es sicherlich die erste Option ist,<br />
die Praxis an die Töchter zu übergeben.<br />
Ich habe sehr lange als selbstständiger<br />
Praxisinhaber gearbeitet<br />
<strong>und</strong> möchte die Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Chancen, die diese Praxisform<br />
bietet, auch meinen Töchtern<br />
ermöglichen.<br />
Sophia <strong>und</strong> Victoria waren die<br />
Assistenzzahnärztinnen Nummer<br />
13 <strong>und</strong> 14 in meiner Praxis, alle<br />
vorherigen haben sich erfolgreich<br />
selbstständig gemacht. Deshalb<br />
bin ich fest davon überzeugt,<br />
dass meine Töchter dies auch<br />
schaffen.<br />
Dr. Sophia Heckle: Ich habe<br />
meine Assistenzzeit gleich nach<br />
dem Studium in unserer Praxis<br />
sehr genossen <strong>und</strong> bin gerne<br />
geblieben. Natürlich wurden einige,<br />
in der Familie auch teils<br />
emotionale Konflikte ausgetragen,<br />
bis jeder seine Position gef<strong>und</strong>en<br />
hatte.<br />
Dr. Victoria Heckle: Ich hingegen<br />
habe meine Assistenzzeit in München,<br />
wo meine Schwester <strong>und</strong> ich<br />
auch studiert haben, verbracht.<br />
Mir ist es nicht ganz leicht gefallen,<br />
mich direkt danach für den Schritt<br />
in die väterliche Praxis einzusteigen,<br />
zu entscheiden. Am Ende hat<br />
die Verb<strong>und</strong>enheit zur Heimat <strong>und</strong><br />
zur Familie überwogen.<br />
Können Sie mir den Moment beschreiben,<br />
als klar war, dass die<br />
berufliche Zukunft in der väterlichen<br />
Zahnarztpraxis ablaufen<br />
würde?<br />
Dr. Sophia Heckle: Das war bei<br />
uns beiden weniger ein Moment,<br />
eher eine Entwicklung mit Höhen<br />
<strong>und</strong> Tiefen.<br />
Dr. Victoria Heckle: Man wächst<br />
quasi rein <strong>und</strong> irgendwann kann<br />
man es sich nicht mehr anders<br />
vorstellen.<br />
Eine oftmals Emotionen berührende<br />
Schnittstelle im Berufsleben<br />
ist die Praxisübergabe –<br />
hätten Sie sich Herr Dr. Heckle<br />
gedacht, dass Sie Ihre Praxis<br />
einmal mit Ihren Töchtern teilen?<br />
Was war das für ein Gefühl, den<br />
Behandlungsstuhl mit dem Nachwuchs<br />
zu teilen?<br />
Dr. Roland Heckle: Ja, das<br />
habe ich mir so vorgestellt.<br />
Dadurch, dass mir die Zusammenarbeit<br />
sehr viel Freude<br />
macht <strong>und</strong> meine Töchter bei<br />
unseren Patienten*innen <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter*innen sehr beliebt<br />
sind, teile ich den Behandlungsstuhl<br />
sehr gerne <strong>und</strong> gehe eigentlich<br />
nur noch ungern in die Praxis,<br />
wenn sie nicht da sind.<br />
Gab es Wechsel-Gefühle – bei<br />
beiden Parteien?<br />
Dr. Roland Heckle: Spannend <strong>und</strong><br />
herausfordernd war <strong>und</strong> ist die<br />
Übergabephase jeden Tag.<br />
Dr. Sophia Heckle: Wie bei jeder<br />
Übergabe gab <strong>und</strong> gibt es gute<br />
<strong>und</strong> weniger befriedigende Tage,<br />
letztere haben uns je<strong>doch</strong> nicht<br />
an unserer Entscheidung zweifeln<br />
lassen.<br />
Sophia <strong>und</strong> Victoria Heckle, empfanden<br />
Sie es eher als Vorteil,<br />
Tochter des Praxisinhabers zu<br />
sein? War es eher ein Einsteigen<br />
ohne Risiko? Oder ein Einsteigen<br />
mit Vorbelastungen? Oder keines<br />
von beidem?<br />
Dr. Victoria Heckle: Eigentlich<br />
eher beides. Auf der einen Seite<br />
ist es sicherlich ein Vorteil, in eine<br />
gut geführte Praxis einsteigen zu<br />
können. Auch bei unseren Patienten<br />
herrschte wahrscheinlich<br />
von Beginn an eine Art „Gr<strong>und</strong>vertrauen“.<br />
Dr. Sophia Heckle: Auf der anderen<br />
Seite muss der Weg von<br />
„Töchtern des Chefs“ bis hin zur<br />
eigenständigen Führungsposition<br />
relativ hart erarbeitet werden,<br />
bei Mitarbeiter*innen <strong>und</strong> bei<br />
Patienten*innen. („Isch dr Chef<br />
nid do?“)<br />
Wie empfanden Sie es als Vater,<br />
Herr Dr. Heckle? Wären Sie froh<br />
gewesen, die Praxis einfach irgendwann<br />
abgeben zu können<br />
oder empfinden Sie es schön, das<br />
Erbe in dieser Form weiterzureichen?<br />
Ist auch Wehmut dabei?<br />
Dr. Roland Heckle: Es macht mich<br />
glücklich, die Praxis weiterhin in<br />
guten Händen zu wissen <strong>und</strong> hoffe<br />
auf eine Anstellung in Altersteilzeit.<br />
Wie häufig wird fachlich diskutiert?<br />
Fallen diese Diskussionen<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 13<br />
Team. Dr. Roland Heckle, Dr. Sophia Heckle, Dr. Victoria Heckle (v. l.) – eine Familie – eine Praxis – eine Berufung.<br />
Foto: privat<br />
eher einvernehmlich aus, oder<br />
sind sie mitunter auch kontrovers?<br />
Dr. Roland Heckle: Ich habe bisher<br />
mit all meinen zahnärztlichen<br />
Mitarbeitern abends die Patientenfälle<br />
besprochen <strong>und</strong> gemeinsam<br />
Fortbildungen besucht.<br />
Dadurch ist eine fachliche Nähe<br />
gewährleistet. Was auch von den<br />
Vorgängern als bereichernd empf<strong>und</strong>en<br />
wurde.<br />
Dr. Victoria Heckle: Natürlich gibt<br />
es auch Bereiche, in welchen wir<br />
zum Beispiel durch die Lehre an<br />
der Universität modernere Ansätze<br />
mitgebracht haben. Wir empfinden<br />
die Diskussionen dabei<br />
als eher positiv, denn unser Vater<br />
ist immer offen für fachliche Neuerungen.<br />
Wie gelingt die Trennung<br />
zwischen Privat <strong>und</strong> Beruflichem?<br />
Wird bei privaten Treffen<br />
häufig über Frontzahnrestaurationen<br />
oder Punktwerte diskutiert?<br />
Dr. Roland Heckle: Zu Hause werden<br />
eher Fragen der Praxisführung<br />
erörtert, hier ist der räumliche<br />
Abstand zur Praxis ganz klar<br />
von Vorteil.<br />
Zahlreiche Unternehmen, die mit<br />
mehreren Generationen zusammenarbeiten,<br />
lassen sich von Mediatoren<br />
begleiten, die beispielsweise<br />
von Anfang an hinsichtlich<br />
Zuständigkeiten etc. beraten. Halten<br />
Sie dies für zielführend?<br />
Dr. Roland Heckle: In der weiteren<br />
Phase meiner Praxisübergabe halte<br />
ich es sicherlich für zielführend,<br />
professionell beraten zu werden.<br />
Dr. Sophia Heckle: Wir denken, es<br />
ist sinnvoll, eine externe Person<br />
mit einzubeziehen, die den vorherrschenden<br />
familiären Beziehungen<br />
neutral gegenübersteht.<br />
Die Übernahmeleidenschaft im<br />
Bereich Zahnarztpraxen hat sich<br />
leider gelegt. Waren vor r<strong>und</strong><br />
zehn Jahren bei einer validen,<br />
wirtschaftlich <strong>und</strong> perspektivisch<br />
interessanten Praxis etwa<br />
sechs bis acht Zahnärzte an<br />
einer Übernahme interessiert,<br />
ergeben sich heutzutage – je<br />
nach Region – nicht selten drei<br />
oder weniger Interessenten. Die<br />
Tendenz ist zudem weiter abnehmend.<br />
Wie betrachten Sie diese<br />
Entwicklung?<br />
Dr. Roland Heckle: Ich empfinde<br />
das als problematisch.<br />
Sicherlich ist die Niederlassungsfrage<br />
auch eine Geschlechterfrage<br />
zum Beispiel<br />
aufgr<strong>und</strong> der Familienplanung.<br />
Dr. Sophia Heckle: Uns liegt<br />
die Versorgung im ländlichen<br />
Raum, wo sich nicht unbedingt<br />
große Gemeinschaftspraxen<br />
oder MVZs ansiedeln würden,<br />
am Herzen. Uns ist klar, dass<br />
wir sicherlich entgegen dem aktuellen<br />
Trend handeln, indem<br />
wir uns als Frau auf dem Land<br />
niederlassen. Aber zum Glück<br />
sind wir ja zu zweit, was vieles<br />
erleichtert.<br />
Wagen wir einen gemeinsamen<br />
Blick in die Zukunft? Sehen Sie<br />
ihre berufliche Zukunft in Endingen<br />
oder sieht es Ihr privater<br />
Entwurf vor, irgendwann eine eigene<br />
Praxis an anderer Stelle zu<br />
führen?<br />
Dr. Victoria Heckle: Wir denken,<br />
dass wir unsere beruflichen Ziele<br />
in Endingen erreichen können<br />
<strong>und</strong> die Praxis zu unserer<br />
eigenen machen können – auch<br />
ohne einen Ortswechsel.<br />
Das Gespräch führte<br />
Cornelia Schwarz<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
14<br />
Berufspolitik<br />
Zahn-Pflege goes Generalistik<br />
Alleine schafft es keiner!<br />
Foto: A. Mader<br />
„Alleine schafft es keiner!“ – mit diesen Worten zitierte LZK-Präsident<br />
Dr. Torsten Tomppert seinen Referenten für Alterszahnheilk<strong>und</strong>e,<br />
Dr. Elmar Ludwig, als er Lehrkräfte der Pflegeschulen in Baden-<br />
Württemberg am 11. Februar <strong>2020</strong> begrüßte. Im Rahmen einer<br />
Informationsveranstaltung stellte die Kammer ihre neuen Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernmittel für die Pflege in Stuttgart erstmals vor.<br />
Übung. Auch viele Senioren- <strong>und</strong> Behindertenbeauftragte nahmen im Februar an der<br />
Veranstaltung teil <strong>und</strong> übten mit den Pflegepädagogen am Phantomkopf das Aus- <strong>und</strong><br />
Eingliedern von Zahnersatz.<br />
Ältere <strong>und</strong> Gebrechliche sowie<br />
Menschen mit Behinderungen haben<br />
heute mehr eigene Zähne, Implantate<br />
oder technisch aufwändigen Zahnersatz<br />
im M<strong>und</strong>. In Bezug auf Karies,<br />
Parodontitis oder Komplikationen<br />
bei Zahnersatz ist die M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit<br />
dieser Menschen allerdings bis<br />
heute nachweislich schlechter als in<br />
der Gesamtbevölkerung.<br />
Dazu erklärte Dr. Ludwig: „Natürlich<br />
müssen wir Zahnärzte uns<br />
fragen, ob wir schon genug tun <strong>und</strong><br />
ja, da ist noch Luft nach oben. Aber<br />
alle unsere Bemühungen setzen eine<br />
gute häusliche Zahn- <strong>und</strong> M<strong>und</strong>pflege<br />
voraus – sonst ist alles, was wir<br />
tun, wenig nachhaltig. Dazu müssen<br />
die heute notwendigen Kenntnisse<br />
<strong>und</strong> Kompetenzen vermittelt werden<br />
<strong>und</strong> da gibt es in der Ausbildung<br />
wie in der Weiterbildung der Pflege<br />
große Defizite. M<strong>und</strong>pflege kann<br />
sich heute nicht mehr auf Soor- <strong>und</strong><br />
Parotitisprophylaxe beschränken!<br />
Und wir müssen die Pflegekräfte<br />
vor Ort gut unterstützen: Aspiration<br />
vermeiden <strong>und</strong> ergonomisch arbeiten<br />
– das muss uns gemeinsam<br />
gelingen, denn das sind wichtige<br />
Schlüssel zum Erfolg!“<br />
Bewährt <strong>und</strong> prämiert. Baden-<br />
Württemberg hat bereits seit Jahren<br />
ein voll ausgearbeitetes Konzept<br />
mit Lehr- <strong>und</strong> Lernmitteln für die<br />
M<strong>und</strong>hygiene in der Pflegeausbildung<br />
sowie für die Weiterbildung<br />
in der Pflege entwickelt – damals in<br />
Kooperation mit der Konferenz der<br />
Altenpflegeschulen in Baden-Württemberg.<br />
Das Konzept wurde 2012<br />
im Rahmen einer Studie validiert<br />
<strong>und</strong> mit dem Wrigley-Prophylaxe-<br />
Preis prämiert. Seitdem werden die<br />
Materialien <strong>und</strong> das Konzept stetig<br />
überarbeitet <strong>und</strong> weiterentwickelt.<br />
Was ist neu? Krankenpflege,<br />
Kinderkrankenpflege <strong>und</strong> Altenpflege<br />
– diese drei Berufe gehen<br />
nach dem Pflegeberufegesetz ab<br />
diesem Jahr in der Ausbildung gemeinsame<br />
Wege. Die sogenannte<br />
generalistische Ausbildung soll einerseits<br />
den Wechsel zwischen den<br />
Berufen erleichtern. Andererseits<br />
brauchen Altenpflegekräfte heute<br />
mehr medizinisches Wissen <strong>und</strong><br />
umgekehrt brauchen Krankenpflegekräfte<br />
mehr Wissen z. B. über den<br />
Umgang mit multimorbiden bzw.<br />
demenziell erkrankten Patienten.<br />
Die Generalistik zielt zudem darauf<br />
ab, das Wissen <strong>und</strong> die Kompetenzen<br />
anhand konkreter Handlungsanlässe<br />
bzw. Lernsituationen selbstständig<br />
zu erarbeiten.<br />
Neu strukturiert. Die bisherigen<br />
Lehr- <strong>und</strong> Lernmittel für die<br />
Pflegeausbildung wurden aktuell<br />
erweitert, komplett neu strukturiert<br />
sowie Handlungsanlässe <strong>und</strong><br />
Lernsituationen formuliert. Für die<br />
Heilerziehungspflege – also in der<br />
Betreuung von Menschen mit Behinderung<br />
– hat Dr. Guido Elsäßer<br />
als Referent für Behindertenzahnheilk<strong>und</strong>e<br />
für die Kammer bereits<br />
vor Jahren ebenfalls ein Konzept<br />
erarbeitet <strong>und</strong> dafür im Jahr 2016<br />
den Gaba-Präventionspreis erhalten.<br />
Dr. Elsäßer hat seine Materialien<br />
zwischenzeitlich ebenfalls an die<br />
Ideen der Generalistik angepasst.<br />
Im Rahmen der Informationsveranstaltung<br />
stellten Dr. Ludwig<br />
<strong>und</strong> Dr. Elsäßer alle bisherigen<br />
Entwicklungen vor. Fragen <strong>und</strong><br />
konstruktive Diskussionen aus<br />
dem Auditorium am 11. Februar<br />
<strong>und</strong> im Nachgang förderten gute<br />
Ideen <strong>und</strong> Anregungen zutage, sodass<br />
die Materialien weiter verbessert<br />
werden konnten.<br />
Andrea Mader<br />
Online verfügbar<br />
Seit April <strong>2020</strong> stehen die Lehr<strong>und</strong><br />
Lernmittel nun auf einer<br />
eigenen Internet-Plattform der<br />
LZK für den Einsatz vor Ort zur<br />
Verfügung. Anfragen richten Sie<br />
bitte an Andrea Mader unter:<br />
mader@lzk-bw.de.<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Berufspolitik 15<br />
IDZ-Hygienekostenstudie<br />
Hygienekosten in Baden-Württemberg<br />
am höchsten<br />
Die baden-württembergischen Delegierten hatten bei der B<strong>und</strong>esversammlung<br />
der BZÄK 2015 die Durchführung einer Hygienekostenstudie<br />
gefordert. Am 14. April hat das mit der Durchführung der<br />
Studie beauftragte IDZ die Studie „Hygienekosten in der Zahnarztpraxis“<br />
veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass die Hygienekosten in den badenwürttembergischen<br />
Praxen b<strong>und</strong>esweit die höchsten sind. „Das muss<br />
auch bei Honorarverhandlungen Berücksichtigung finden“, fordert<br />
LZK-Vize Dr. Norbert Struß. Das ZBW hat mit dem LZK-Referenten für<br />
Praxisführung über die Ergebnisse der Studie gesprochen.<br />
ZBW: Wie würden Sie als einer<br />
der Anstoßgeber zur Durchführung<br />
einer Hygienekostenstudie<br />
die jetzt vorliegende IDZ-Studie<br />
kurz beschreiben?<br />
Dr. Struß: Die baden-württembergischen<br />
Delegierten hatten<br />
bei der B<strong>und</strong>esversammlung der<br />
BZÄK im Jahre 2015 die Durchführung<br />
einer aktuellen Hygienekostenstudie<br />
gefordert. Wir hatten<br />
seinerzeit gehofft, dass die Ergebnisse<br />
schneller vorliegen würden.<br />
Aber jetzt hat das IDZ am 14. April<br />
die Studie „Hygienekosten in der<br />
Zahnarztpraxis“ (Nicolas Frenzel<br />
Baudisch) veröffentlicht <strong>und</strong> wie<br />
sich zeigt, ist die Gesamtkostenermittlung<br />
unter Berücksichtigung<br />
regionaler Aspekte auch<br />
durchaus komplex. Hygiene ist<br />
ein zentrales Element der zahnärztlichen<br />
Berufsausübung. Viele<br />
alltägliche Praxisabläufe bergen<br />
Hygienekosten. Diese Allgegenwart<br />
macht sie zugleich zu einem<br />
schwer fassbaren <strong>und</strong> zugleich<br />
erheblichen Kostenfaktor. In dieser<br />
Untersuchung wurde versucht,<br />
die umfangreichen Hygienemaßnahmen<br />
der Zahnärzteschaft so<br />
umfassend wie möglich zu erfassen.<br />
Dazu wurden drei gesonderte<br />
Datenquellen verwendet. Zum<br />
einen wurden die hygienebedingten<br />
Tätigkeiten in Zahnarztpraxen<br />
beobachtet <strong>und</strong> im Rahmen von<br />
Zeitmessungen erfasst. Dann<br />
wurden die Geräte- <strong>und</strong> Materialkosten<br />
mittels Fragebogen in<br />
zufällig ausgewählten Zahnarztpraxen<br />
aus jedem B<strong>und</strong>esland<br />
erfasst. Und schließlich wurden<br />
Sek<strong>und</strong>ärdaten aus Quellen wie<br />
dem Statistischen B<strong>und</strong>esamt<br />
mit einbezogen. Die Einbindung<br />
dieser Daten ermöglicht auch zukünftig<br />
mit vertretbarem Aufwand<br />
die Aktualisierung der Ergebnisse.<br />
Welche Schlüsse ziehen Sie aus<br />
den vorgelegten Ergebnissen?<br />
Auch wenn die vorliegende Studie<br />
aus methodischen Gründen nicht<br />
direkt mit früheren Untersuchungen<br />
vergleichbar ist, ist dennoch<br />
deutlich geworden, dass die Hygienekosten<br />
in den Zahnarztpraxen<br />
stark gestiegen sind. Laut IDZ<br />
übersteigen sie die entsprechenden<br />
Kosten einer Hausarztpraxis<br />
um etwa das Zehnfache.<br />
Obwohl heute viele Schritte der<br />
Medizinprodukteaufbereitung maschinell<br />
durchgeführt werden, fällt<br />
der Faktor „Mensch“ mit einem<br />
Anteil der Personalkosten von ca.<br />
zwei Dritteln an den Gesamthygienekosten<br />
besonders ins Gewicht.<br />
Das ist ein Beleg für gelebte Hygiene<br />
in den Zahnarztpraxen, insbesondere,<br />
wenn man bedenkt,<br />
dass viele Untersuchungen aus<br />
dem Kranken- <strong>und</strong> Pflegebereich<br />
einen immanenten Zeitmangel<br />
<strong>und</strong> -druck belegen.<br />
Neben individuellen Praxisstrukturen<br />
haben die Standortfaktoren<br />
einen signifikanten Einfluss<br />
auf die Hygienekosten. Die Studie<br />
zeigt, dass die Hygienekosten in<br />
den baden-württembergischen<br />
Praxen b<strong>und</strong>esweit die höchsten<br />
sind. Sie betragen 95.000 Euro<br />
jährlich <strong>und</strong> liegen damit 35,7<br />
Prozent über dem B<strong>und</strong>esdurchschnitt.<br />
Das ist meines Erachtens<br />
Ausdruck für ein hohes Hygieneniveau<br />
<strong>und</strong> muss auch bei Honorarverhandlungen<br />
Berücksichtigung<br />
finden. Andrea Mader<br />
Kernaussagen der IDZ-Studie<br />
• Die Kosten für Infektionsprävention<br />
in der Zahnarztpraxis sind<br />
erheblich. Sie übersteigen die<br />
entsprechenden Kosten einer<br />
Hausarztpraxis um etwa das<br />
Zehnfache (sie erreichen das<br />
Niveau ambulant operierender<br />
Arztpraxen).<br />
• Die Hygienekosten setzen sich<br />
aus 34,5 Prozent Sachkosten<br />
<strong>und</strong> 65,5 Prozent Personalkosten<br />
zusammen.<br />
• Aus methodischen Gründen ist<br />
die Studie nicht vergleichbar mit<br />
den IDZ-Studien von 1996 <strong>und</strong><br />
2006.<br />
• B<strong>und</strong>esweit betrugen die Gesamthygienekosten<br />
je Praxis<br />
70.000 Euro (Datenerhebung<br />
2016), Einzelpraxen 65.000<br />
Euro, andere Praxisformen<br />
87.000 Euro.<br />
• In Baden-Württemberg betrugen<br />
die gemittelten Gesamthygienekosten<br />
95.000 Euro (Spanne<br />
77.000 bis 115.000) <strong>und</strong> liegen<br />
somit um 35,7 Prozent über dem<br />
B<strong>und</strong>esdurchschnitt.<br />
• Es gibt deutliche regionale Unterschiede,<br />
insbesondere ein<br />
Kostengefälle zwischen alten<br />
<strong>und</strong> neuen B<strong>und</strong>esländern.<br />
• Neben den Standortfaktoren fallen<br />
Größen- <strong>und</strong> Mengenindikatoren<br />
ins Gewicht.<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
16<br />
Sonderthema<br />
Corona-Pandemie<br />
Stimmungsbilder aus den Praxen in<br />
Baden-Württemberg<br />
Seit einigen Wochen beherrscht die Corona-Pandemie unseren Alltag. Auch auf den Praxisbetrieb hat<br />
die Coronakrise gewaltige Auswirkungen. Die ZBW-Redaktion möchte gerne die Auswirkungen der<br />
Krise auf den zahnärztlichen Praxisbetrieb beleuchten <strong>und</strong> hat einige Praxen gebeten, aus ihrem Alltag<br />
in den letzten Wochen zu berichten: Wie haben Sie die letzten Wochen gemeistert? Wie haben Sie<br />
<strong>und</strong> Ihr Praxisteam gearbeitet? Hatten Sie genügend Schutzausrüstung? Welche Auswirkungen hatte<br />
die Corona-Verordnung der Landesregierung <strong>und</strong> der unsägliche § 6a, der den Praxen lediglich<br />
Notfallbehandlungen gestattete, bevor das Sozialministerium Auslegungshinweise nachschob <strong>und</strong> den<br />
Paragrafen jetzt endlich aufgehoben hat?<br />
Dr. Yvonne Rydlewski-Feller aus Freiburg hat uns<br />
folgenden Bericht übermittelt:<br />
Die COVID-19-Pandemie hat unsere Praxis in ihrer<br />
Struktur mit Sicherheit ziemlich durchgewirbelt.<br />
Aber es gab zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Panik.<br />
Als die ersten Maßnahmen der B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesregierung<br />
bekannt wurden, haben wir zuerst unter<br />
uns Behandlern entschieden, wie jede Einzelne<br />
von uns (meine angestellte Zahnärztin, meine Ü70-<br />
Teilzeit-ZÄ <strong>und</strong> ich als hochschwangere Chefin) damit<br />
umgehen werden <strong>und</strong> sind zu dem Entschluss gekommen,<br />
dass wir weiterarbeiten möchten (mit Ausnahme<br />
der Ü70-ZÄ, die ich als risikogefährdet nicht<br />
zur Behandlung zugelassen habe). In einer Teamsitzung<br />
haben wir dann unser Team über die COVID-<br />
19-Situation <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen praxisinternen<br />
Maßnahmen informiert. Das Team hat sich<br />
daraufhin einstimmig dafür entschieden, mit uns<br />
weiterzuarbeiten. Es bestand zu keinem Zeitpunkt<br />
Unsicherheit oder Angst im Team. Alle Mitarbeiterinnen<br />
haben sich <strong>und</strong> ihren Beruf als Teil des medizinischen<br />
Systems gesehen <strong>und</strong> die sowieso sehr hohen<br />
Hygieneanforderungen in einer Zahnarztpraxis als<br />
Schutzschild vor COVID-19 empf<strong>und</strong>en.<br />
So wurden in den unterschiedlichen Bereichen<br />
unserer Praxis daraufhin auch unterschiedliche<br />
Vorkehrungen getroffen. Die Praxisverwaltung hat<br />
die von der LZK empfohlenen Hinweise umgesetzt<br />
<strong>und</strong> einen Türaushang sowie eine spezielle COVID-<br />
19-Anamnese eingeführt. Die Patienten, die zur Risikogruppe<br />
gehörten, wurden umterminiert, Telefonate<br />
mit verunsicherten Patienten geführt <strong>und</strong> die Entscheidung<br />
von Patienten, aus Angst die Behandlung<br />
nicht durchführen zu wollen, stets unterstützt <strong>und</strong><br />
diese Termine dann verschoben. Die Prophylaxeassistentinnen<br />
haben medizinisch nicht indizierte<br />
Behandlungen abgesagt <strong>und</strong> in der zahnärztlichen<br />
Behandlung haben wir antiseptische M<strong>und</strong>spülungen<br />
zur Keimreduktion, Gesichtsvisiere als Behand-<br />
Foto: privat<br />
Am Montag, dem 16.3.<strong>2020</strong> rief<br />
eine meiner Patientinnen an, dass<br />
sie positiv auf COVID-19 getestet<br />
wurde. Sie erfuhr ihr Testergebnis<br />
Samstagabend, welches ihr durch<br />
die Polizei überbracht wurde.<br />
Sofort haben wir nachgeschaut,<br />
wann die Patientin zur Behandlung da war: am Donnerstag,<br />
dem 12.03.<strong>2020</strong>. Es folgten mehrere Telefonate<br />
an den darauffolgenden Tagen. Die Patientin<br />
wohnt in einem anderen Landkreis. Das war schon<br />
problematisch: verschiedene Ges<strong>und</strong>heitsämter,<br />
verschiedene Aussagen.<br />
Schließlich „durfte“ ich meine Praxis zwei Wochen<br />
auf behördliche Anordnung schließen <strong>und</strong> ich hatte<br />
unverhofft zwei Wochen „Corona-Zwangsurlaub“.<br />
Diesen nutzte ich, um mich über COVID-19 zu inforlerschutz<br />
<strong>und</strong> vermehrte Behandlungspausen zur<br />
erhöhten Durchlüftung eingeführt. Die Patienten<br />
wurden nicht so engmaschig einbestellt, damit sich<br />
keine Wartezeiten im Wartezimmer ergaben <strong>und</strong> sich<br />
auch nicht so viele Patienten gleichzeitig in der Praxis<br />
befanden.<br />
Die Praxis lief somit ziemlich unbeeindruckt weiter,<br />
wobei sich die Patientenzahlen <strong>und</strong> auch die Praxiseinnahmen<br />
selbstverständlich von denen außerhalb<br />
der Pandemie deutlich unterschieden haben, aber an<br />
Arbeit hat es nie wirklich gemangelt. Von den Patienten<br />
haben wir ausschließlich positives Feedback<br />
bekommen. Sie waren sehr dankbar, dass wir für sie<br />
da waren <strong>und</strong> ihnen eine gewisse Struktur in dieser<br />
verunsichernden COVID-19-Situation geben konnten.<br />
Nach dieser aufregenden Zeit bin ich unheimlich<br />
stolz auf mein Team, dass wir es so unaufgeregt geschafft<br />
haben, die Praxis so gut weiter am Laufen zu<br />
halten.<br />
Aus Remseck erreichte uns der Bericht von<br />
Dr. Heike Bächler:<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 17<br />
Foto: privat<br />
Zu Beginn dieser Krise waren alle<br />
unsere Patienten verunsichert, es<br />
gab die Verschwörungs-Theoretiker,<br />
die entspannten Aufgeklärten <strong>und</strong><br />
die Verweigerer. Wir hatten alle davon.<br />
Von einer Woche auf die andere<br />
hatten wir plötzlich nichts mehr<br />
zu tun. Das Telefon klingelte nicht mehr, die Patienten<br />
kamen nicht zum vereinbarten Termin. Lediglich<br />
unsere begonnenen Behandlungen wurden zu Ende<br />
geführt. Meine PZR-Mitarbeiterinnen hatten nichts<br />
mehr zu tun <strong>und</strong> die Auszubildenden im 3. Lehrjahr<br />
keine Schule mehr. Es herrschte Stillstand, Ratlosigkeit<br />
<strong>und</strong> auch Angst. Da es zu diesem Zeitpunkt,<br />
Mitte März, noch keine haltbaren Verhaltensregeln<br />
seitens der KZV gab, waren wir auf uns alleine gestellt.<br />
Wir beschlossen auf Notfallbehandlung in der<br />
Praxis umzustellen <strong>und</strong> darüber hinaus telefonische<br />
Erreichbarkeit den ganzen Tag. Unsere Praxiskapazität<br />
wurde von 100 Prozent auf 5 Prozent zwangsweimieren<br />
<strong>und</strong> privat nutzte ich die Zeit, um z. B. meine<br />
im Keller über 25 Jahre schlummernde Trompete<br />
zum Leben zu erwecken <strong>und</strong> die Nachbarn zu „erfreuen“.<br />
Auch hatte ich endlich einmal Zeit, mit den<br />
Nachbarn Gespräche zu führen.<br />
Seit Januar ist das Zentrallager meines Dentaldepots<br />
überfordert. Es war wie Weihnachten <strong>und</strong><br />
Geburtstag zusammen, als ich im April eine große<br />
Lieferung Handschuhe bekam. Leider wurde mir im<br />
April meine im Januar erfolgte Bestellung von M<strong>und</strong>-<br />
Nasen-Schutz ersatzlos gestrichen.<br />
Inzwischen habe ich über einen Chinahandel FFP2-<br />
Masken bekommen. Die bei einem Supermarkt Ende<br />
März bestellten FFP3-Masken hängen noch an der<br />
holländischen Grenze (oder wo auch immer) fest.<br />
Meine Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> ich behandeln inzwischen<br />
mit FFP2-Masken <strong>und</strong> tragen zusätzlich über<br />
Schutzbrillen ein Schutzschild.<br />
Das Wartezimmer war zwischenzeitlich einige Wochen<br />
das „Spiel- <strong>und</strong> Lernzimmer“ für die Kinder einer<br />
Mitarbeiterin, welche jetzt in der „Notbetreuung“<br />
sind.<br />
Die Patienten lesen die Krankenversichertenkarte<br />
selbständig ein <strong>und</strong> desinfizieren nach Eintreten <strong>und</strong><br />
vor dem Verlassen der Praxis die Hände. Sie werden,<br />
wenn möglich, direkt ins Behandlungszimmer<br />
gesetzt. Im Wartezimmer wartet, wenn überhaupt,<br />
nur ein Patient oder eine Familie.<br />
Da wir in unserer Zahnarztpraxis schon immer einen<br />
hohen Hygienestandard vorweisen, bzw. bisher<br />
schon alle Patienten so behandelt haben, als wären<br />
sie „hochinfektiös“, hat sich nicht so viel für uns verändert.<br />
Der Gesprächsstoff mit den Patienten hat<br />
sich verändert.<br />
Wir hoffen sehr, dass es bald Schutzausrüstung zu<br />
„vor Coronazeit“-vernünftigen Preisen gibt.<br />
Praxismanagerin Jutta Barsch berichtet aus der Praxis<br />
Dr. Ulf Barsch in Bietigheim-Bissingen:<br />
se zurückgefahren. Alle geplanten Termine haben wir<br />
bis Anfang Mai verschoben. Manche Patienten, die<br />
zu uns kamen, da sie Beschwerden oder dergleichen<br />
hatten, behandelten uns als wären wir giftig, totale<br />
Ablehnung, als wenn wir die Krankheitsüberbringer<br />
wären.<br />
Wir hatten jeden Montag Krisen-Teambesprechung<br />
<strong>und</strong> planten dann die Arbeitstage durch. Unsere Azubis<br />
durften bei uns im Büro lernen, da sie zuhause<br />
keine Ruhe hatten, da beide jüngere Geschwister<br />
haben. Wir lernten zusammen <strong>und</strong> versuchten auch<br />
diese Aufgabe zu meistern.<br />
Unsere Materialbestände sind meistens gut gefüllt,<br />
sodass wir nicht in die Notlage kamen, keine<br />
Schutzausrüstung mehr zu haben. Lediglich die<br />
FFP2-Masken waren nicht zu bekommen, was aber<br />
nicht besonders schlimm war, denn es kamen ja eh<br />
keine Patienten. Wir bestellten 100 FFP2-Masken zu<br />
900 Euro bei unserem Großhändler <strong>und</strong> bekamen<br />
diese auch recht zügig geliefert. Wir bestellten kontinuierlich<br />
unsere Schutzausrüstung nach, da sich die<br />
Lieferzeiten auf ungewisse Zeit hinauszögerten. Es<br />
gibt Material u. a. Händedesinfektion, das bis heute<br />
im Rückstand ist. Wir hatten aber immer genügend<br />
Toilettenpapier zu Verfügung.<br />
Wir bekamen tägliche Mails von der Kammer <strong>und</strong><br />
der KZV, wie wir uns verhalten sollen, was nicht<br />
immer beruhigend oder gar aussagefähig war. Der<br />
Höhepunkt war dann Ostern mit dem Hinweis des<br />
Berufsverbotes. Ich denke, dies ist auch der Gr<strong>und</strong>,<br />
warum die Patienten so verunsichert sind. Unsere<br />
Termin-Patienten werden alle angerufen <strong>und</strong> persönlich<br />
aufgeklärt, über die Notwendigkeit <strong>und</strong> ob die<br />
Behandlung stattfinden soll.<br />
Unsere Praxis wurde Corona-tauglich umfunktioniert,<br />
die Patienten müssen zuerst Hände waschen<br />
<strong>und</strong> desinfizieren, bevor sie im Wartezimmer mit ihrem<br />
M<strong>und</strong>schutz Platz nehmen. Des Weiteren müssen<br />
sie uns einen Fragebogen ausfüllen, damit wir<br />
ihren Ges<strong>und</strong>heitszustand einschätzen können. Die<br />
Rezeption wurde mit einer Plexiglasscheibe abgetrennt.<br />
Händeschütteln zur Begrüßung <strong>und</strong> Verabschiedung<br />
wurde gleich abgeschafft. Das Tragen des<br />
M<strong>und</strong>-Nasen-Schutz für die Mitarbeiter ist mittlerweile<br />
auch im Rezeptionsbereich Pflicht, im Behandlungszimmer<br />
wurde dies schon vor einigen Wochen<br />
eingeführt. Mittlerweile kommen die ersten Patienten<br />
in die Praxis, die eine COVID-19 Erkrankung<br />
überstanden haben, negativ getestet sind <strong>und</strong> eine<br />
Behandlung brauchen.<br />
Nach jeder überstandenen Woche bin ich sehr<br />
froh, dass wir alle ges<strong>und</strong> geblieben sind <strong>und</strong> dass<br />
wir die Woche geschafft haben. Die große Unsicherheit<br />
wie alles weitergeht, bestimmt unseren Alltag<br />
<strong>und</strong> die Sorgen darüber. Dies wird sicherlich ein<br />
schwieriges Jahr <strong>und</strong> ich hoffe wir werden es ges<strong>und</strong><br />
überstehen.<br />
Ich werde ein Corona-Tagebuch schreiben, um alle<br />
Ereignisse <strong>und</strong> Eindrücke festzuhalten, die mich in<br />
diesen Wochen umgeben. Es ist wie eine Irrfahrt, die<br />
keinen Ausstieg hat <strong>und</strong> kein Ende in Sicht. Eine un-<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
18<br />
Sonderthema<br />
Foto: privat<br />
beschreibliche Situation, die alles von einem fordert<br />
<strong>und</strong> einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich hoffe<br />
sehr, dass unsere Patienten diesen Einsatz schätzen<br />
<strong>und</strong> wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.<br />
Und einen sehr ausführlichen Bericht übermittelte uns<br />
Dr. Peter Fuchs aus Neckarsulm:<br />
Als wir am 27. Januar dieses Jahres<br />
erfuhren, dass ein Mann aus Bayern<br />
sich als erster bekannter Fall in<br />
Deutschland infiziert hat, war das<br />
Coronavirus noch immer ziemlich<br />
weit weg. Wir waren alle ges<strong>und</strong>,<br />
niemand von uns aus der Praxis oder<br />
Angehörige waren in China <strong>und</strong> „die Gefahr für die<br />
Ges<strong>und</strong>heit der Menschen in Deutschland durch die<br />
neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung<br />
des RKI weiterhin gering“, so unser B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsminister<br />
Jens Spahn in diesen Tagen.<br />
Wir sind eine Praxis mit einem Hauptstandort mit<br />
fünf Behandlungszimmern <strong>und</strong> einer Zweigpraxis mit<br />
zwei Behandlungszimmern. Außer KFO bieten wir alle<br />
zahnärztlichen Leistungen in unserer Praxis an. Zum<br />
Team gehören 25 Mitarbeiterinnen.<br />
Der Praxisbetrieb lief ganz normal weiter, auch als<br />
im Februar klar war, dass das Coronavirus weltweite<br />
Auswirkungen hat. Die bisherigen Maßnahmen betrafen<br />
nur den internationalen Reiseverkehr. Vonseiten<br />
unserer Patienten war das Virus in Bezug auf zahnärztliche<br />
Behandlungen zu dieser Zeit kein Thema.<br />
Ges<strong>und</strong>heitsminister Jens Spahn erklärte am 26.<br />
Februar: „Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie<br />
in Deutschland“. In diesen Tagen wird klar, dass<br />
es weltweit <strong>und</strong> natürlich auch in Deutschland einen<br />
Mangel an persönlicher Schutzausrüstung gibt.<br />
Der inzwischen eingerichtete Corona-Krisenstab<br />
beschließt eine zentrale Beschaffung durch das B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsministerium.<br />
Nun haben wir in unserem<br />
Warenwirtschaftssystem nachgesehen, wie lange<br />
unser Vorrat wohl reichen wird. Sicher hatten wir auch<br />
Glück, dass wir bei Bestellungen von länger haltbaren<br />
Dingen immer ein paar Monate im Voraus planen. Von<br />
dieser Seite gab es bei uns keine Probleme. Bei normalem<br />
Praxisbetrieb sollte unser Vorrat vier bis fünf<br />
Monate reichen. Corona hat uns, zumindest in dieser<br />
Hinsicht, zeitlich nicht auf dem falschen Fuß erwischt.<br />
Wir hatten am Wochenende vom 7./8. März Notdienst<br />
<strong>und</strong> versorgten 50 Patienten. Das ist für unsere<br />
Praxis ein normaler Notdienst. Trotz der Empfehlungen<br />
aus der Politik, größere Veranstaltungen abzusagen,<br />
fanden bis einschließlich 13. März alle von uns<br />
angebotenen Behandlungen statt.<br />
Als am 13. März von allen B<strong>und</strong>esländern die Schließung<br />
der Schulen <strong>und</strong> Kitas beschlossen wurde, ging<br />
es ziemlich schnell. Am Montag, den 16. März standen<br />
bei uns die Telefone nicht mehr still. Sehr viele<br />
Patienten sagten ihre Termine für die kommende Woche<br />
ab. Auf einen Schlag hatten wir in dieser Woche<br />
nur noch ein Patientenaufkommen von ca. 50 Prozent<br />
des sonst üblichen Umfangs. In dieser Woche haben<br />
wir von uns aus einige geplante aber aufschiebbare<br />
Behandlungen bei besonders gefährdeten Menschen<br />
abgesagt.<br />
Bei unserer bisher letzten Teambesprechung, bei<br />
der noch alle Teammitglieder anwesend waren, am<br />
17. März, haben wir das Vorgehen <strong>und</strong> unsere Maßnahmen<br />
für die kommenden Wochen beschlossen.<br />
Wie viele Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen auch, haben wir<br />
das Team in Gruppen aufgeteilt, die sich nicht mehr<br />
begegnen. Zu den 25 Mitarbeiterinnen zählen drei angestellte<br />
Zahnärztinnen sowie zwei Vorbereitungsassistentinnen.<br />
Wir haben drei Behandlungsteams (1x<br />
ZÄ/ZA, 2x ZFA, 1x Rezeption/Verwaltung) gebildet.<br />
In unserer Hauptpraxis haben wir seither eine Pufferzeit<br />
in der Mittagspause. Durch die stark gesunkenen<br />
Patientenzahlen <strong>und</strong> unser Ziel, so wenige Personen,<br />
wie möglich, gleichzeitig in der Praxis zu haben,<br />
waren wir gezwungen, Mitarbeiterinnen „nach Hause<br />
zu schicken“. Dies gelang im März durch Überst<strong>und</strong>enabbau<br />
<strong>und</strong> Urlaub. Teilweise konnten wir die „freie<br />
Zeit“ für aufgeschobene Dinge nutzen: Arbeitsanweisungen<br />
aktualisieren, Inventur der Verbrauchsmaterialien.<br />
„Teilweise“ deshalb, weil wir die Größe der<br />
Teams klein halten wollen <strong>und</strong> die in der Praxis Anwesenden<br />
mit der Betreuung der Patienten ausgelastet<br />
waren. Wo es ging, zum Beispiel im QM, konnten wir<br />
einige Aufgaben ins Homeoffice auslagern. Trotzdem<br />
mussten wir ab dem 1. April Kurzarbeit beantragen.<br />
Als Praxisinhaber war ich sehr froh, dass alle getroffenen<br />
Maßnahmen, die letztendlich in Lohneinbußen<br />
münden, vom gesamten Team getragen wurden. Ich<br />
konnte <strong>und</strong> kann bis heute auf die Loyalität des Teams<br />
bauen.<br />
Da wir aktuell keine Präsenz-Praxis-Teambesprechungen<br />
durchführen können, gibt es neben den<br />
Teambriefings bei uns im sehr kleinen Kreis, analog<br />
zu Kammer KOMPAKT, eine Praxis-R<strong>und</strong>mail. So halten<br />
wir die Mitarbeiterinnen, die zu Hause sind, auf<br />
dem Laufenden. Kurz vor der Coronakrise wollten wir<br />
die Schichtpläne über eine Smartphone-App organisieren.<br />
Die Krise hat uns jetzt einen Strich durch die<br />
Rechnung gemacht. Jetzt müssen die Schichtpläne<br />
eben noch über Telefon oder SMS verteilt werden.<br />
Die Arbeitsbelastung für unser Verwaltungsteam ist<br />
seither immens: Zuerst mussten die durchzuführenden<br />
Behandlungen terminlich koordiniert <strong>und</strong> parallel<br />
dazu die Behandlungsteams zusammengestellt werden.<br />
Das bedeutete von da an: Alle Patienten müssen<br />
angerufen werden. Üblicherweise erinnern wir seit einigen<br />
Monaten unsere Patienten per SMS oder E-Mail<br />
an ihre Termine.<br />
In dieser Situation war unserer Meinung nach die<br />
Kommunikation am Telefon erforderlicher denn je.<br />
Vonseiten der Patienten gab es sehr viel Verständnis<br />
<strong>und</strong> positive Rückmeldungen für die durchgeführten<br />
Änderungen.<br />
Unsere Patientenzahlen nahmen nach dem Verhängen<br />
der Ausgangs- oder Kontaktsperren natürlich weiter<br />
ab. Wir erhielten auch sehr kurzfristige Absagen.<br />
Auffallend war, dass unsere Patienten offensichtlich<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 19<br />
häufig das Wochenende abgewartet haben <strong>und</strong> dann<br />
entschieden, ob sie Termine wahrnehmen. Wir haben<br />
versucht, uns auf dieses Verhalten möglichst gut einzustellen,<br />
was vom gesamten Team eine unheimliche<br />
Flexibilität verlangte.<br />
Im Gegensatz zu manchen anderen Praxen waren<br />
wir der Meinung, dass sämtliche notwendigen zahnärztlichen<br />
Behandlungen bei vermutet ges<strong>und</strong>en Patienten<br />
durchgeführt werden können. Dazu gehört bei<br />
uns auch die Professionelle Zahnreinigung als notwendige<br />
Behandlung. Diese Auffassung habe ich in enger<br />
Abstimmung mit Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen geteilt.<br />
Für an COVID-19 erkrankte Patienten wurden von<br />
der Kammer <strong>und</strong> der KZV Notfallzentren eingerichtet.<br />
Schon immer legen wir großen Wert darauf, dass wir<br />
„Fachärzte“ für Zahnheilk<strong>und</strong>e sind. Unser Beruf birgt<br />
wie auch viele andere Berufe, gewisse Risiken bei seiner<br />
Ausübung. Das war schon immer so. Vor Corona<br />
gab es HIV, Hepatitis, Grippe <strong>und</strong> viele andere Erreger.<br />
Ich bin sicher, dass die Zahnärzteschaft in den vergangenen<br />
Jahrzehnten ordentliche Hygienestrukturen<br />
in den Praxen aufgebaut hat. Diese Strukturen haben<br />
meiner Ansicht nach erfolgreich dafür gesorgt, dass<br />
unter zahnärztlichem Praxispersonal keine erhöhten<br />
Infektionszahlen, nicht nur bei Corona, vorlagen bzw.<br />
vorliegen. Aktuell fühle ich mich in unserer Praxis <strong>und</strong><br />
zu Hause am wohlsten. An diesen Orten weiß ich sehr<br />
genau, wie Hygiene betrieben wird.<br />
Den Ansatz, zum Beispiel die PZR während der<br />
Coronakrise als nicht notwendig <strong>und</strong> aufschiebbar<br />
zu bewerten oder gar deren Durchführung zu untersagen,<br />
halte ich im medizinischen Sinne als auch berufsethisch<br />
für sehr fragwürdig. Ich meine, auch die<br />
PZR gehört zu unserem Sicherstellungsauftrag, um die<br />
Entstehung parodontaler Erkrankungen zu verhindern<br />
oder bei bestehender bzw. bereits behandelter PAR<br />
eine Verschlechterung zu vermeiden.<br />
Wir haben gegenüber Politik <strong>und</strong> Kostenträgern jahrelang<br />
dafür gekämpft <strong>und</strong> werden das auch weiter tun<br />
müssen, dass die PZR eine medizinisch notwendige,<br />
wissenschaftlich f<strong>und</strong>ierte Leistung ist.<br />
Die im Bereich von Social Media vielleicht etwas<br />
vorschnell geposteten Forderungen nach behördlich<br />
verordneten Praxisschließungen wegen fehlender<br />
Schutzausrüstung, höchster Infektionsgefahr <strong>und</strong> fehlender<br />
Unterstützung durch wen auch immer, waren<br />
im Sinne der Zahnheilk<strong>und</strong>e sicher etwas kontraproduktiv.<br />
Wir werden diesen Posts in den kommenden<br />
Jahren, so glaube ich, immer mal wieder unangenehm<br />
begegnen, sei es in Vertragsverhandlungen oder bei<br />
der Positionierung der Zahnheilk<strong>und</strong>e als Fachdisziplin<br />
der Medizin.<br />
Ich glaube, dass diese Meinungsäußerungen ihren<br />
Beitrag zum unsäglichen § 6a der Corona-Verordnung<br />
der Landesregierung geleistet haben. Schlimm, dass<br />
die Politik vor dem Erlass dieser Verordnung keinen<br />
„zahnärztlichen Rat“ eingeholt hat. Schlimm auch,<br />
aber zu erwarten war, dass Sozialminister Manfred<br />
Lucha trotz intensiver Verhandlungen mit Dr. Ute Maier<br />
<strong>und</strong> Dr. Torsten Tomppert über die Osterfeiertage<br />
den § 6a nicht gestrichen hat.<br />
Die nachgeschobene gemeinsame Presseerklärung<br />
hat von unseren Patienten niemand gelesen.<br />
Nach dem Osterwochenende gab es unter den Patienten<br />
eine große Unsicherheit. Wir bekamen Anfragen,<br />
ob es denn strafbar sei, zur Behandlung z. B.<br />
dem Legen einer Füllung, in der Praxis zu erscheinen.<br />
Glücklicherweise hat sich diese Situation mit Wirkung<br />
vom 4. Mai durch Streichung des § 6a wieder geklärt.<br />
Wie die meisten Menschen <strong>und</strong> Branchen trifft auch<br />
uns die Coronakrise in jeglicher Hinsicht sehr hart.<br />
Ohne finanzielle Einbußen geht das natürlich nicht.<br />
Umsätze gingen verloren. Teilweise werden wir diese<br />
sicher nachholen können. Die notwendige prothetische<br />
Versorgung, die Erneuerung der insuffizienten<br />
Füllung oder die Entfernung des teilretinierten 8ers<br />
müssen „abgearbeitet“ werden. Vermutlich werden<br />
wir unsere Urlaubspläne für dieses Jahr – nicht nur<br />
wegen Corona – ändern müssen. Schön, wenn man<br />
besonders in bisher ungekannten Krisenzeiten, ein<br />
motiviertes <strong>und</strong> loyales Team hat!<br />
Vonseiten unserer Standesvertretung auf Landes<strong>und</strong><br />
Bezirksebene, der Landeszahnärztekammer <strong>und</strong><br />
dem Vorstand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung<br />
Baden-Württemberg, haben sich mein Team <strong>und</strong> ich<br />
jederzeit gut informiert <strong>und</strong> unterstützt gefühlt. Es<br />
ist mir vollkommen klar, dass auch eine Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg keine Möglichkeiten<br />
hat, auf dem leergefegten Weltmarkt Schutzausrüstungen<br />
zu bekommen. Das Päckchen mit 20<br />
M<strong>und</strong>schutzen war sicher eine symbolische Geste<br />
der Unterstützung. Aber nachdem wir unser „Schulchinesisch“<br />
aufgefrischt haben, konnten wir auch die<br />
Gebrauchsanweisung lesen. – Das soll aber ein Witz<br />
sein.<br />
In solchen Zeiten ist auch Kollegialität gefragt. Ein<br />
schönes Beispiel hierfür ist eine Heilbronner kieferorthopädische<br />
Praxis, die ganz spontan ihre 3D-Drucker<br />
zur Produktion von einfachen Gesichtsvisieren verwendet.<br />
Eine kostenlose Gr<strong>und</strong>ausstattung wurde an<br />
die Kollegenschaft versandt. Auf Nachfrage gibt es<br />
weitere Exemplare auf Spendenbasis.<br />
Der Informationsfluss über Kammer KOMPAKT<br />
klappt sehr gut. Die Website gibt einen schnellen<br />
Überblick über die Lage. Informationen zu Verordnungen,<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> mögliche Unterstützungen<br />
können sehr einfach <strong>und</strong> schnell abgerufen werden.<br />
Ich finde, unsere Standesvertretung macht einen sehr<br />
guten Job! Ich bin sehr gespannt, welche (finanzielle)<br />
Unterstützungen tatsächlich zum Tragen kommen.<br />
Am Montag, den 4. Mai, nach Streichung des § 6a,<br />
wurde in vielen Medien berichtet, dass nun auch<br />
Zahnärzte wieder alle Leistungen anbieten dürfen.<br />
Das war meiner Ansicht eine etwas unglückliche Formulierung,<br />
erweckte sie <strong>doch</strong> den Anschein, dass alle<br />
Praxen, die während der Gültigkeit von § 6a geöffnet<br />
hatten, sich im Bereich einer Grauzone bewegten.<br />
Sei´s drum. Unter veränderten Bedingungen geht<br />
es, so glaube ich, hin zu einer neuen „Normalität“ in<br />
der Gesellschaft <strong>und</strong> auch in unseren Praxen.<br />
Ich habe aber keine Zweifel, daran, dass die Zahnärzteschaft<br />
gut aufgestellt ist.<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
20<br />
Sonderthema<br />
Foto: privat<br />
Mit herzlichen Grüßen übermittelten Katja <strong>und</strong> Dr. Harald<br />
Remsch aus Langenau mit dem gesamten Praxisteam ihren<br />
Stimmungsbericht:<br />
Auch uns hat die Coronakrise,<br />
wie alle Menschen<br />
auf der Welt, überrollt. Wir<br />
waren in Sorge um die Ges<strong>und</strong>heit<br />
unserer Angehörigen,<br />
waren aber auch in<br />
Sorge um unsere Praxis.<br />
Wie geht es <strong>und</strong> geht es überhaupt weiter in der Coronakrise<br />
für uns?<br />
An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön<br />
an die LZK BW sagen, für den unermüdlichen Einsatz<br />
<strong>und</strong> die sehr interessanten <strong>und</strong> informativen R<strong>und</strong>briefe,<br />
die wir so zuverlässig <strong>und</strong> immer sehr zeitnah zu<br />
den aktuellen Themen bekommen haben. Auch an Sonn<strong>und</strong><br />
Feiertagen haben wir die R<strong>und</strong>briefe von der LZK BW<br />
bekommen.<br />
Als ich noch in Panik im Kreis gelaufen bin durch die<br />
Wohnung, war mein Mann im Büro verschw<strong>und</strong>en. Nach<br />
einiger Zeit kam er <strong>und</strong> zeigte mir die R<strong>und</strong>briefe der LZK,<br />
aus welchen wir herauslesen konnten, wie der Arbeitstag<br />
am Montag für uns weitergeht nach dem Aufkommen der<br />
Coronakrise.<br />
Wir erstellten am Wochenende einen Chat in Whats-<br />
App mit unserem Team <strong>und</strong> haben all diese R<strong>und</strong>briefe<br />
mit zusätzlichen Informationen zur Umsetzung in unserer<br />
Praxis an unser Team geschickt. So konnten wir uns<br />
austauschen <strong>und</strong> auch unser Team wusste, dass wir auf<br />
f<strong>und</strong>iertes Wissen der LZK zugreifen, die sich bei allen<br />
wichtigen Institutionen informierte, was in der Krise von<br />
uns als Zahnarztpraxis erwartet wird. Die R<strong>und</strong>briefe<br />
haben wir jedes Mal in den Chat geschickt, so wussten<br />
auch unsere Mitarbeiterinnen, was jeweils am nächsten<br />
Tag auf uns zu kommt.<br />
Durch diese R<strong>und</strong>briefe hatten wir immer einen Rückhalt<br />
<strong>und</strong> konnten durchatmen, trotz aller Umstände, die<br />
so eine Pandemie mit sich bringt, so fühlten wir uns getragen<br />
von unserer LZK BW, der wir zugehörig sind.<br />
Wir wurden auch informiert, wie Kurzarbeit vor sich<br />
geht, wo wir unsere finanziellen Hilfen beantragen können,<br />
wo wir Schutzausrüstung beziehen können, wenn es<br />
knapp wird.<br />
Wenn man die R<strong>und</strong>briefe aufmerksam gelesen hatte,<br />
blieb keine Frage mehr offen. Mein Mann <strong>und</strong> ich fragten<br />
uns, wo <strong>und</strong> wie die LZK das nur in so kurzer Zeit<br />
<strong>und</strong> wie schon erwähnt, auch am Wochenende auf die<br />
Beine gestellt hat. Wir fühlten uns keine Sek<strong>und</strong>e alleine<br />
gelassen.<br />
Die Pressemitteilung traf uns auch nicht wie ein Schlag<br />
ins Gesicht, denn schon am Karfreitag <strong>und</strong> Ostermontag<br />
kam das schriftliche Dementi im R<strong>und</strong>brief sowie die<br />
Information, dass gegen den § 6a Einspruch eingelegt<br />
wurde. So konnte ich am Dienstag den Patienten, die angerufen<br />
haben, fachlich kompetent antworten, was wir<br />
im Moment behandeln dürfen <strong>und</strong> was nicht.<br />
Ein Vorteil unserer Praxis war für mich, dass wir die<br />
Begehung des Regierungspräsidiums im Juli 2019 hatten,<br />
denn so haben wir uns als Praxis nochmals bestärkt gesehen,<br />
alles richtig zu machen im Hygiene- <strong>und</strong> Aufbereitungsbereich.<br />
Ebenso war ich als Hygienebeauftragte<br />
der Praxis im Oktober 2019 bei einem einwöchigen<br />
Hygienelehrgang, der mir <strong>und</strong> unserer Praxis das Hintergr<strong>und</strong>wissen<br />
nochmals sehr tiefgründig <strong>und</strong> intensiv<br />
vermittelt hat, wie die Viren, Bakterien <strong>und</strong> Sporen in unserem<br />
Aufbereitungsvorgang abgetötet werden, was wir<br />
immer, auch unabhängig von COVID-19, aufgr<strong>und</strong> des<br />
Aerosolnebels zu beachten haben.<br />
Die Validierung der Hygienekette, die wir regelmäßig<br />
durchführen, gibt auch in einer solchen Zeit die Sicherheit,<br />
dass wir das Bestmöglichste zum Schutze unserer<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> unserer Patienten umsetzen.<br />
Wenn man bei der Validierung einmal zuschaut (was<br />
ich persönlich immer mache <strong>und</strong> dem Validierer Löcher<br />
in den Bauch frage) <strong>und</strong> dann sieht, was der Validierer<br />
da an mitgebrachten kontaminierten Instrumenten mit<br />
eingetrocknetem Blut etc. mitbringt <strong>und</strong> in den Thermo<br />
packt, dann kann man sich auch sicher sein in seiner Hygienekette<br />
als Praxisbetreiber, wenn die Validierung erfolgreich<br />
ist. So kann man den Patienten auch mit gutem<br />
Gewissen mitteilen, dass man auch in einer Pandemie<br />
die Viren <strong>und</strong> sonstigen Erreger mit unserem Aufbereitungssystem<br />
erfolgreich <strong>und</strong> nachweislich abgetötet hat,<br />
da eine nicht erfolgreiche Charge vom Programm gar<br />
nicht freigegeben wird <strong>und</strong> somit nicht in Umlauf kommt.<br />
Ich informierte die Patienten in der Pandemie bei Anrufen<br />
bezüglich eines Termins auch über unsere Aufbereitungsprogramme,<br />
die wir in der Zahnarztpraxis haben,<br />
die jeden Aufbereitungsschritt im Thermo <strong>und</strong> Melag aufzeichnen,<br />
dokumentieren <strong>und</strong> grafisch darstellen, damit<br />
sichergestellt ist, dass die Zyklen <strong>und</strong> Haltezeiten korrekt<br />
ablaufen. Das sind Dinge, die die Patienten gerade in der<br />
Zeit interessieren <strong>und</strong> über diese Informationen gibt man<br />
den Patienten die Sicherheit auch in dieser Zeit gut aufgehoben<br />
zu sein in einer Zahnarztpraxis.<br />
Das bedurfte in der Anfangszeit sehr viel Aufklärung<br />
<strong>und</strong> ich war ca. die ersten fünf Wochen damit beschäftigt,<br />
die Patienten aufzuklären, wie wir in dieser Zeit arbeiten<br />
<strong>und</strong> uns als Team <strong>und</strong> die Patienten schützen <strong>und</strong><br />
was der aktuelle Stand der Anforderungen an eine Zahnarztpraxis<br />
in der Pandemie ist, die wir ja immer aktuell<br />
aus den R<strong>und</strong>briefen der LZK entnehmen konnten.<br />
Abschließend möchte ich nochmals sagen, dass mein<br />
Mann <strong>und</strong> ich sowie das gesamte Team uns in den für alle<br />
Menschen turbulenten Zeiten extrem gut unterstützt <strong>und</strong><br />
aufgefangen gefühlt haben <strong>und</strong> fühlen von der LZK BW.<br />
Man hat in jedem R<strong>und</strong>brief gespürt, wie sich die LZK für<br />
die Interessen, Ängste <strong>und</strong> Fragen der Zahnärzte/innen<br />
eingesetzt hat.<br />
Wahrscheinlich benötigen alle Mitarbeiter der LZK jetzt<br />
erst einmal etwas Erholung, denn so strukturiert <strong>und</strong> informativ<br />
wie dort in den letzten Wochen gearbeitet wurde<br />
in einer nicht alltäglichen Situation, war da wohl nicht<br />
mehr viel Freizeit übrig.<br />
Wir bedanken uns bei den Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzten<br />
für ihre authentischen Berichte <strong>und</strong> dass sie ihre<br />
Sorgen <strong>und</strong> Einschätzungen mit uns geteilt haben!<br />
Die Stimmungsbilder holte Andrea Mader ein<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 21<br />
Standespolitische Arbeit erfolgreich – Aufhebung von Paragraf 6a<br />
Zahnärzte praktizieren wieder uneingeschränkt<br />
Kurz vor Ostern wurde das Behandlungsspektrum der Zahnärzteschaft<br />
durch Paragraf 6a der Corona-Verordnung der Landesregierung<br />
Baden-Württemberg auf akute <strong>und</strong> Notfallbehandlungen reduziert.<br />
Nach wochenlangen Bemühungen <strong>und</strong> Interventionen seitens der<br />
Kammer <strong>und</strong> der KZV wurden die Vorgaben schließlich drei Wochen<br />
nach ihrem Erscheinen am 4. Mai <strong>2020</strong> vollständig aufgehoben.<br />
Eigentlich sollten die Vorgaben, die<br />
während der Osterfeiertage im Sozialministerium<br />
in Paragraf 6a Niederschlag<br />
fanden, bis 15. Juni <strong>2020</strong><br />
gelten – soweit sie nicht aufgr<strong>und</strong> der<br />
Entwicklungen hätten vorher aufgehoben<br />
werden können oder gegebenenfalls<br />
sogar noch verlängert werden<br />
müssen. Da KZV <strong>und</strong> Kammer aufgr<strong>und</strong><br />
dieser Verordnung unabsehbare<br />
Folgen auf die Zahnärzteschaft zukommen<br />
sahen, fanden seit Karfreitag<br />
regelmäßige Gespräche zwischen<br />
den Körperschaften <strong>und</strong> dem Ges<strong>und</strong>heitsministerium<br />
statt. Noch vor<br />
Ende der Osterfeiertage erfolgte ein<br />
erstes Einlenken, indem das Ministerium<br />
„Auslegungshinweise“ zur Einschränkung<br />
zahnärztlicher Behandlungen<br />
erarbeitete, wie die Regierung<br />
am 13. April mitteilte.<br />
Nur akute Notfälle. Diese besagten,<br />
dass „bei der zahnärztlichen Versorgung<br />
von Patientinnen <strong>und</strong> Patienten<br />
in den Fachgebieten Oralchirurgie,<br />
Zahn-, M<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kieferheilk<strong>und</strong>e<br />
<strong>und</strong> Kieferorthopädie [...] nur akute<br />
Erkrankungen oder Schmerzzustände<br />
[Notfälle] behandelt werden [dürfen].<br />
Andere als Notfallbehandlungen sind<br />
auf einen Zeitpunkt nach dem Außerkrafttreten<br />
dieser Verordnung zu verschieben“,<br />
so die Corona-Verordnung.<br />
Zwar wurde damit das absolute<br />
Berufsverbot wieder aufgehoben,<br />
<strong>doch</strong> für zahlreiche Praxen im Land<br />
bedeuteten diese Einschränkungen<br />
eine Flut an Terminabsagen <strong>und</strong> eine<br />
große Verunsicherung sowohl bei<br />
den Patient*innen, als auch bei den<br />
Zahnärzt*innen selbst. Beide Körperschaften<br />
betrachteten diese Regelung<br />
von Beginn an als unverhältnismäßigen<br />
Eingriff in die gr<strong>und</strong>gesetzlich<br />
geschützte Berufsausübungsfreiheit<br />
der Zahnärzteschaft <strong>und</strong> forderten<br />
deshalb ihre Streichung. Den mündlichen<br />
Verhandlungen folgte ein gemeinsames<br />
Schreiben an Ministerpräsident<br />
Kretschmann <strong>und</strong> Sozialminister<br />
Lucha. Darin bekräftigten Dr.<br />
Ute Maier <strong>und</strong> Dr. Torsten Tomppert<br />
erneut, dass die Zahnärzt*innen in<br />
Baden-Württemberg zu den systemrelevanten<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufen zählen.<br />
Gerade in Zahnarztpraxen werden<br />
schon immer strenge Hygienevorschriften<br />
angewandt, die zu einem<br />
entsprechend hohen Schutzniveau bei<br />
der zahnärztlichen Behandlung beitragen,<br />
<strong>und</strong> zwar unabhängig von der<br />
derzeitigen Situation.<br />
Erfolgreiche <strong>Standespolitik</strong>. Bemühungen,<br />
die Erfolg zeigten: Sechs<br />
Wochen vor der geplanten Aufhebung<br />
des Paragrafen 6a änderte die Landesregierung<br />
ihre Rechtsverordnung über<br />
infektionsschützende Maßnahmen<br />
gegen die Ausbreitung des Coronavirus<br />
erneut, <strong>und</strong> hob die Bestimmungen,<br />
die zahnärztliche Behandlungen<br />
bis dato eingeschränkt hatten, auf.<br />
Damit bestehen seitdem keine Behandlungsbeschränkungen<br />
mehr.<br />
Gewisse Sorgen bleiben. Die<br />
Sorgen der zahnmedizinischen Familie<br />
sind damit je<strong>doch</strong> nicht vom Tisch,<br />
denn die Versorgungsstrukturen-<br />
Schutzverordnung, die das ursprüngliche<br />
Sozialschutzpaket für Zahnarztpraxen<br />
auf einen reinen Kredit reduziert,<br />
wird sich unmittelbar auf die<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsplätze auswirken.<br />
Die Gesamtvergütungen für<br />
Zahnärzte in diesem Jahr sollen auf 90<br />
Prozent der 2019 erfolgten Zahlungen<br />
festgeschrieben werden. Einzelleistungen<br />
werden weiterhin nach den für<br />
<strong>2020</strong> bereits vereinbarten Kriterien<br />
vergütet. Sollte es aufgr<strong>und</strong> von Nachholeffekten<br />
bei aufgeschobenen Leistungen<br />
wie etwa Zahnersatz kommen,<br />
müssen die Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigungen die von den Krankenkassen<br />
zu viel gezahlte Vergütung in<br />
den Jahren 2021 <strong>und</strong> 2022 vollständig<br />
ausgleichen. Der Referentenentwurf<br />
hingegen sah vor, dass die Zahnärzte<br />
30 Prozent möglicher Überzahlungen<br />
behalten dürfen. Aufgenommen wurde<br />
auch ein Passus, nachdem alle Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigungen „im<br />
Benehmen mit den Landesverbänden<br />
der Krankenkassen <strong>und</strong> den Ersatzkassen“<br />
im Honorarverteilungsmaßstab<br />
abweichende Regelungen in den<br />
Jahren <strong>2020</strong> bis 2022 vorsehen können.<br />
Schwerpunktpraxen. Bereits in<br />
der Anfangsphase der Pandemie wurden<br />
durch Bemühungen der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung mehrere<br />
Schwerpunktpraxen eingerichtet. Patienten,<br />
die an COVID-19 erkrankt<br />
sind oder sich in Quarantäne befinden,<br />
werden dort behandelt. Die Liste<br />
der infrage kommenden Universitätskliniken,<br />
Kliniken <strong>und</strong> Praxen wird<br />
regelmäßig aktualisiert <strong>und</strong> findet sich<br />
auf den Internetseiten der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Baden-<br />
Württemberg <strong>und</strong> der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg.<br />
Oberstes Gebot: M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit.<br />
Nicht zuletzt in Zeiten der Corona-<br />
Pandemie gilt, dass eine gute M<strong>und</strong>hygiene<br />
zum Schutz vor Krankheiten<br />
beitragen kann. Darauf wies<br />
auch die Deutsche Gesellschaft für<br />
Zahn-, M<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kieferheilk<strong>und</strong>e<br />
(DGZMK) hin. „Prävention stärkt die<br />
Immunkompetenz am Entstehungsort<br />
der Virusinfektion <strong>und</strong> hilft über diese<br />
Fitmacherfunktion, sie zu vermeiden<br />
oder ihren Verlauf abzumildern“, betont<br />
der Präsident der DGZMK, Prof.<br />
Dr. Roland Frankenberger. Für die Patienten<br />
sei es wichtig, sich immunologisch<br />
bestmöglich gegen COVID-19<br />
zu wappnen. Dies schließe eine konsequente<br />
M<strong>und</strong>hygiene mit ein.<br />
Cornelia Schwarz<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
22<br />
Sonderthema<br />
Engagement der Standesvertretung<br />
Aktiv in der Krise<br />
Foto: A. Mader<br />
Die Corona-Pandemie bestimmt seit Wochen unseren Alltag. Auch<br />
für die Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzte im Land brachte sie erhebliche<br />
Einschnitte. Neben dem völlig überraschenden <strong>und</strong> unnötigen „Ostergeschenk“<br />
der Landesregierung, der Corona-Verordnung, mussten die<br />
Zahnärzteschaft <strong>und</strong> die beiden zahnärztlichen Körperschaften noch<br />
viele andere Herausforderungen bewältigen. Stetes Ziel von KZV BW<br />
<strong>und</strong> LZK BW: Die Interessen des Berufsstandes in der Politik zu vertreten,<br />
aber auch die Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen zu entlasten <strong>und</strong> in der<br />
gegenwärtigen Krise zu unterstützen <strong>und</strong> zu schützen. Dazu gehört<br />
auch die permanente Kommunikation nach innen <strong>und</strong> nach außen. Wie<br />
sieht das Engagement der Körperschaften im Detail aus?<br />
Atemschutzmasken. Landeszahnärztekammer <strong>und</strong> Kassenzahnärztliche Vereinigung<br />
haben ein weiteres <strong>und</strong> letztes Kontingent an FFP2/KN95 Atemschutzmasken<br />
auf dem freien Markt beschafft.<br />
Kämpfen für Berufsfreiheit. Der<br />
Gründonnerstag dieses Jahres war<br />
für die Berufsfreiheit der Zahnärzteschaft<br />
in Baden-Württemberg ein<br />
schwarzer Tag: Die völlig überraschende<br />
Einführung des § 6a der<br />
vierten Corona-Verordnung reduzierte<br />
die zahnärztliche Versorgung<br />
auf akute Erkrankungen <strong>und</strong> Notfälle.<br />
In konsensualen Gesprächen<br />
mit Sozialminister Lucha über die<br />
Osterfeiertage konnten Dr. Ute<br />
Maier, Vorsitzende des Vorstandes<br />
der KZV BW, <strong>und</strong> Dr. Torsten<br />
Tomppert, Präsident der LZK BW,<br />
erreichen, dass durch ministerielle<br />
Auslegungshinweise medizinisch<br />
notwendige zahnärztliche Behandlungen<br />
weiter durchgeführt werden<br />
konnten. In einem zweiten Schritt<br />
wurde dann das standespolitische<br />
Ziel – die Aufhebung von § 6a –<br />
erreicht. „Nachdem auch die ausreichende<br />
Ausstattung der Zahnarztpraxen<br />
mit der in der Corona-<br />
Krise unverzichtbaren persönlichen<br />
Schutzausrüstung mittlerweile sichergestellt<br />
ist, können wir die Einschränkungen<br />
für zahnärztliche Behandlungen<br />
wieder aufheben. Ich<br />
bedanke mich bei allen Akteuren<br />
für die konstruktive <strong>und</strong> vertrauensvolle<br />
Zusammenarbeit in schwierigen<br />
Zeiten“, sagte Ges<strong>und</strong>heitsminister<br />
Lucha. Seit dem 4. Mai sind<br />
zahnärztliche Behandlungen daher<br />
wieder ohne Einschränkung möglich.<br />
Unterstützung für Praxisalltag.<br />
Große Unsicherheit herrschte auch<br />
in den Praxen: Wie komme ich an<br />
die dringend benötigte Schutzausrüstung?<br />
Wer liefert Atemschutzmasken?<br />
Können Zahnarztpraxen<br />
die Soforthilfe des Landes beantragen?<br />
Kann ich für meine Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter in<br />
der Praxis Kurzarbeit beantragen?<br />
Wer kann bei Liquiditätsengpässen<br />
aushelfen? Zur Beantwortung von<br />
Fragen wie diesen stehen in der<br />
LZK-Geschäftsstelle die Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter aus den<br />
Abteilungen Praxisführung, Recht<br />
<strong>und</strong> Finanzbuchhaltung telefonisch<br />
<strong>und</strong> für E-Mail-Anfragen zur Verfügung.<br />
Bei der KZV BW wurde<br />
eine Hotline eingerichtet, über<br />
die Mitarbeiter der KZV BW <strong>und</strong><br />
der Landesbeirat den Praxen, aber<br />
auch an COVID-19 erkrankten Patienten,<br />
beratend zur Seite standen<br />
<strong>und</strong> weiterhin stehen. Vielfältige<br />
Informationen wurden zudem auf<br />
den jeweiligen Webseiten beider<br />
Körperschaften zur Verfügung gestellt,<br />
u. a. auch eine FAQ-Liste auf<br />
der Website der KZV BW <strong>und</strong> eine<br />
Übersicht über die Schwerpunktpraxen<br />
<strong>und</strong> Corona-Ambulanzen<br />
für die Behandlung von COVID-<br />
19-Erkrankten. Die LZK BW hat<br />
auf ihrer Webseite einen neuen Bereich<br />
unter Zahnärzte – Praxisführung<br />
– Coronavirus eingerichtet <strong>und</strong><br />
sukzessive Informationen zum Umgang<br />
mit COVID-19 in der Praxis,<br />
zu arbeitsrechtlichen Problemstellungen,<br />
behördlichen Maßnahmen<br />
<strong>und</strong> finanziellen Hilfen erarbeitet.<br />
Beide Webseiten werden regelmäßig<br />
aktualisiert <strong>und</strong> überarbeitet.<br />
Interessen vertreten. Regelmäßig<br />
werden aktuelle Entwicklungen<br />
<strong>und</strong> neue Informationen an die Kollegenschaft,<br />
aber auch an Patientinnen<br />
<strong>und</strong> Patienten in Baden-Württemberg<br />
kommuniziert <strong>und</strong> dabei<br />
verschiedene Kanäle wie R<strong>und</strong>-<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 23<br />
schreiben, Ges<strong>und</strong>heitstelegramm<br />
<strong>und</strong> KammerKOMPAKT genutzt.<br />
Über die Social-Media-Kanäle<br />
kommunizierten die Körperschaften<br />
das Angebot der Schwerpunktpraxen<br />
ebenso wie den politischen<br />
Erfolg der Abschaffung des § 6a<br />
der Corona-Verordnung. Um der<br />
durch die Corona-Verordnung<br />
<strong>und</strong> den damit zusammenhängenden<br />
Presseveröffentlichungen<br />
entstandenen Verunsicherung bei<br />
den Patientinnen <strong>und</strong> Patienten<br />
entgegenzuwirken, schaltete das<br />
Informationszentrum Zahn- <strong>und</strong><br />
M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit (IZZ) nahezu flächendeckend<br />
in den Gemeindeblättern<br />
Baden-Württembergs eine Anzeige,<br />
die deutlich zum Ausdruck<br />
brachte, dass alle medizinisch<br />
notwendigen zahnärztlichen Behandlungen<br />
auch trotz Corona-Verordnung<br />
erbracht werden dürfen.<br />
Verschiedene Presseinformationen<br />
wurden von der LZK BW <strong>und</strong> der<br />
KZV BW gemeinsam herausgegeben,<br />
so beispielsweise auch die<br />
Meldung zur vollständigen Streichung<br />
von § 6a der Corona-Verordnung,<br />
die an sämtliche Medien<br />
des Landes versendet <strong>und</strong> vielfach<br />
abgedruckt wurde. Auch Ministerpräsident<br />
Winfried Kretschmann<br />
war Adressat mehrerer Briefe der<br />
Körperschaften. So forderten Dr.<br />
Ute Maier <strong>und</strong> Dr. Torsten Tomppert<br />
unter anderem die Aufhebung<br />
des § 6a der Corona-Verordnung,<br />
die Notbetreuung von Kindern für<br />
Angehörige zahnmedizinischer Berufe<br />
<strong>und</strong> einen Schutzschirm für<br />
die Zahnärzteschaft.<br />
Schwerpunktpraxen. Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage einer Abfrage der KZV<br />
BW konnte Mitte April ein Netz mit<br />
Schwerpunktpraxen eingerichtet<br />
werden. Zuvor hatten sich LZK BW<br />
<strong>und</strong> KZV BW bereits für die Einrichtung<br />
von Klinikambulanzen für<br />
COVID-19-Erkrankte eingesetzt.<br />
Für Corona-Patienten wird so eine<br />
zahnmedizinische Versorgung im<br />
Notfall gewährleistet <strong>und</strong> die Zahnarztpraxen<br />
gleichzeitig entlastet,<br />
da Patienten, die positiv auf CO-<br />
VID-19 getestet oder in Quarantäne<br />
sind, so ausschließlich in speziellen<br />
Zentren behandelt <strong>und</strong> an diese<br />
weiterverwiesen werden können.<br />
24 Standorte in Baden-Württemberg<br />
sind Teil des Netzwerks, darunter<br />
mit den Universitätskliniken<br />
Freiburg <strong>und</strong> Tübingen wie auch<br />
dem Katharinenhospital Stuttgart<br />
<strong>und</strong> dem Städtischen Klinikum<br />
Karlsruhe vier Klinikambulanzen.<br />
„Wir können somit für COVID-<br />
19-Erkrankte flächendeckend eine<br />
zahnmedizinische Notfallversorgung<br />
gewährleisten, die den besonderen<br />
Anforderungen dieser Patientinnen<br />
<strong>und</strong> Patienten gerecht wird“,<br />
so Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsitzende<br />
der KZV BW. Die Übersicht<br />
der teilnehmenden Praxen ist unter<br />
https://bit.ly/2WszzY9 einsehbar.<br />
Atemschutzmasken beschafft.<br />
Die Schutzausrüstung war seit Beginn<br />
der Pandemie ein knappes Gut<br />
<strong>und</strong> die Versorgungslage durch die<br />
weltweite Nachfrage extrem angespannt.<br />
Um die Versorgung in den<br />
baden-württembergischen Praxen<br />
zu gewährleisten, haben sich die<br />
Körperschaften entschlossen, FFP<br />
2/KN95-Atemschutzmasken auf<br />
dem freien Markt zu beschaffen <strong>und</strong><br />
an die Praxen zu verteilen. Ebenso<br />
wurden Gesichtsvisiere <strong>und</strong> FFP2-<br />
Masken an notdiensthabende Praxen<br />
<strong>und</strong> Desinfektionsmittel an die<br />
Sicherstellungspraxen versendet.<br />
Einsatz für die Existenz. Eine<br />
Blitz-Umfrage durch die KZV BW<br />
ergab, dass im April <strong>2020</strong> die KCH-<br />
Honorarumsätze im Vergleich zum<br />
Vorjahresmonat um durchschnittlich<br />
43,2 Prozent zurückgegangen sind.<br />
Am häufigsten wurde ein Rückgang<br />
zwischen 50 <strong>und</strong> 60 Prozent<br />
angegeben. Umso ernüchternder ist<br />
der Umstand, dass trotz intensiver<br />
Bemühungen auf den unterschiedlichen<br />
politischen Ebenen die Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung<br />
(COVID-19-VSt-SchutzV)<br />
schlussendlich – im Gegensatz zum<br />
ursprünglichen Entwurf – lediglich<br />
Kredite für die Zahnarztpraxen<br />
statt echter Hilfen vorsieht. Dr. Ute<br />
Maier stellte hierzu klar: „Unter<br />
sehr widrigen Umständen stehen<br />
wir wie alle im Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
seit dem ersten Tag der Pandemie<br />
in unseren Praxen <strong>und</strong> sorgen für<br />
eine bestmögliche Versorgung der<br />
Patientinnen <strong>und</strong> Patienten. Der<br />
Umstand, dass viele Kolleginnen<br />
<strong>und</strong> Kollegen existenzgefährdende<br />
Umsatzeinbußen haben, wird vonseiten<br />
der Politik einfach vom Tisch<br />
gefegt“. Im gleichen Schritt kündigte<br />
die KZV BW eine Taskforce an,<br />
die Lösungen beschreiben soll, wie<br />
mit diesen Beschlüssen umzugehen<br />
ist. „Die Politik würdigt in keinster<br />
Weise unsere Systemrelevanz <strong>und</strong><br />
unsere wirtschaftliche Bedeutung.<br />
Wir stellen knapp eine halbe Million<br />
Arbeitsplätze in Deutschland.“<br />
Mit diesen Worten drückt LZK-<br />
Präsident Dr. Torsten Tomppert sein<br />
Missfallen über die am 4. Mai <strong>2020</strong><br />
vom B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit<br />
erlassene COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung<br />
aus.<br />
Andrea Mader &<br />
Benedikt Schweizer<br />
Anzeige<br />
Was Hänschen nicht lernt <strong>…</strong><br />
<strong>…</strong> lernt Hans wirklich nimmermehr?<br />
Weltweit gehen mehr als 200 Millionen Kinder nicht zu Schule. Das muss<br />
nicht sein! Deshalb fördert terre des hommes Schulprojekte <strong>und</strong> sorgt für<br />
die Ausbildung von Jungen <strong>und</strong> Mädchen. Weltweit.<br />
Unterstützen Sie unsere Arbeit<br />
mit Ihrer Spende. Danke.<br />
© Rene Fietzek<br />
www.tdh.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
24<br />
Sonderthema<br />
BW-Datenschutzbeauftragter Dr. Stefan Brink zu Corona-Ges<strong>und</strong>heitsdaten<br />
„Ges<strong>und</strong>heitsdaten sind besonders<br />
geschützte Informationen“<br />
In vielen Debatten über die Bewältigung der gegenwärtigen<br />
Krise spielt auch Datenschutz eine Rolle. Nicht nur bei der Frage nach<br />
einer geeigneten App zur Kontaktverfolgung, auch bei alltäglichen<br />
Fragen der Praxisführung taucht das Thema immer wieder auf.<br />
Welche Daten dürfen erhoben, gespeichert oder an Ges<strong>und</strong>heitsämter<br />
weitergegeben werden? Die KZV Baden-Württemberg wandte<br />
sich mit diesen Fragen an Dr. Stefan Brink, der seit 2017<br />
Landesbeauftragter für Datenschutz <strong>und</strong> Informationsfreiheit (LFDI)<br />
in Baden-Württemberg ist.<br />
ZBW: Herr Dr. Brink, eine<br />
Verarbeitung von Ges<strong>und</strong>heitsdaten<br />
ist gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nur restriktiv möglich.<br />
Zur Eindämmung der<br />
Corona-Pandemie können<br />
aber datenschutzkonform<br />
Daten erhoben <strong>und</strong> verwendet<br />
werden. Dabei<br />
ist der Gr<strong>und</strong>satz der Verhältnismäßigkeit<br />
<strong>und</strong> der<br />
gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lage<br />
stets zu beachten. Was<br />
bedeutet das in der Zahnarztpraxis<br />
im Hinblick auf<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdaten der Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter?<br />
Dr. Stefan Brink: Ges<strong>und</strong>heitsdaten<br />
sind besonders<br />
sensible <strong>und</strong> daher<br />
Foto: LfDI BW/Jan Potente<br />
besonders geschützte<br />
Informationen. Es bedarf<br />
stets einer besonderen<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage für ihre<br />
Verarbeitung, insbesondere<br />
also für ihre Erhebung<br />
<strong>und</strong> Übermittlung. Bei einem begründeten<br />
Verdacht auf Infektion<br />
von Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
einer Zahnarztpraxis mit<br />
einer ansteckenden Krankheit –<br />
also auch mit dem neuartigen<br />
Coronavirus – kann es zum<br />
Schutz von weiteren Mitarbeitenden,<br />
aber auch zum Schutz der<br />
Patienten erforderlich sein, diesen<br />
Verdacht abzuklären, um –<br />
darauf aufbauend – reagieren zu<br />
Gr<strong>und</strong>lage. „Im Mittelpunkt vieler Datenverarbeitungen<br />
seitens der Arbeitgeber allgemein <strong>und</strong> im Ges<strong>und</strong>heitsbereich<br />
im Besonderen steht derzeit das Infektionsschutzgesetz<br />
(IfSG).“<br />
können. Hierzu kann der Arbeitgeber<br />
den infektionsverdächtigen<br />
Mitarbeitenden vorübergehend<br />
freistellen <strong>und</strong> auch das<br />
Ges<strong>und</strong>heitsamt einschalten,<br />
wenn er Infektionen in der Praxis<br />
befürchtet. Im Mittelpunkt vieler<br />
Datenverarbeitungen seitens der<br />
Arbeitgeber allgemein <strong>und</strong> im<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbereich im Besonderen<br />
steht derzeit das Infektionsschutzgesetz<br />
(IfSG). Hinsichtlich<br />
sämtlicher dieser Datenverarbeitungen<br />
muss aber auch in technischer<br />
Hinsicht ein hohes Schutzniveau<br />
gewährleistet sein.<br />
Und in Bezug auf Patienten? Wie<br />
ist es datenschutzrechtlich zu bewerten,<br />
wenn Patient*innen zur<br />
Klärung des Infektionsrisikos, anders<br />
als sonst üblich, um erweiterte<br />
Angaben <strong>und</strong> Informationen<br />
gebeten werden?<br />
In Bezug auf Patienten gilt<br />
dasselbe: Auch deren Ges<strong>und</strong>heitsdaten<br />
– ebenso<br />
wie die aller sonstigen<br />
Betroffenen – sind besonders<br />
geschützt <strong>und</strong> dürfen<br />
nur auf einer tragfähigen<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> in<br />
sonstiger Weise verarbeitet<br />
werden. Soweit es<br />
Zahnärztinnen <strong>und</strong> Zahnärzten,<br />
etwa aus (zahn‐)<br />
medizinischen oder epidemiologischen<br />
Gründen<br />
sachgerecht oder angezeigt<br />
scheint, von ihren Patienten<br />
„erweiterte Angaben<br />
<strong>und</strong> Informationen als<br />
üblich“ zu erbitten, müssen<br />
sie in datenschutzrechtlicher<br />
Hinsicht u. a.<br />
prüfen, ob sie eine entsprechende<br />
Erhebungsbefugnis<br />
haben. Falls keine<br />
der Voraussetzungen einer<br />
„einwilligungslosen“ Erhebungsbefugnis<br />
vorliegt,<br />
kann der Zahnarzt seine Patienten<br />
um eine datenschutzrechtliche<br />
Einwilligung bitten. Diese<br />
bedarf nicht der Schriftform <strong>und</strong><br />
kann beispielsweise auch mündlich<br />
erteilt werden. Der Zahnarzt<br />
muss die Einwilligung allerdings<br />
nachweisen können, etwa gegenüber<br />
einem Gericht oder einer Datenschutzaufsichtsbehörde.<br />
Der<br />
Nachweis kann nicht nur durch<br />
die Vorlage einer schriftlichen Ein‐<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 25<br />
willigung, sondern beispielsweise<br />
auch durch einen entsprechenden<br />
aussagekräftigen Vermerk<br />
in der Patientenakte geführt werden.<br />
Was ist einer Praxis angeraten,<br />
die den konkreten Verdacht hat,<br />
dass ein Patient mit Corona infiziert<br />
ist? Darf ich hier Meldungen<br />
an dritte, beispielsweise das<br />
Ges<strong>und</strong>heitsamt, weitergeben?<br />
Wie verhält es sich mit einem Datenaustausch<br />
beispielsweise zwischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsämtern <strong>und</strong><br />
Polizeibehörden?<br />
Einer Praxis ist mit Blick auf datenschutzrechtliche<br />
Aspekte u. a.<br />
anzuraten, insbesondere auch die<br />
einschlägigen Vorschriften des<br />
Infektionsschutzgesetzes (IfSG)<br />
zu beachten. Danach besteht bei<br />
Verdacht einer solchen Erkrankung<br />
für Meldungen an Ges<strong>und</strong>heitsämter<br />
nicht nur eine Meldebefugnis,<br />
sondern sogar eine<br />
Meldepflicht. Welche Daten dabei<br />
gemeldet werden müssen ergibt<br />
sich aus § 9 IfSG. Danach müssen<br />
Zahnärzte <strong>und</strong> andere Meldepflichtige<br />
diese Daten allerdings<br />
nur melden „soweit vorliegend“;<br />
sie sind somit nach diesen infektionsschutzrechtlichen<br />
Vorschriften<br />
also nicht verpflichtet, vor<br />
Erstattung ihrer (in der Regel wohl<br />
eilbedürftigen) Meldung bei ihnen<br />
nicht vorliegende Daten erst noch<br />
aufwändig zu erheben.<br />
Auch der Datenaustausch zwischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsämtern <strong>und</strong><br />
Polizeibehörden darf nur im datenschutzrechtlich<br />
zulässigen<br />
Rahmen stattfinden. Das Innen<strong>und</strong><br />
das Sozialministerium haben<br />
zur näheren Ausgestaltung der<br />
Datenverarbeitung in diesen Fällen<br />
eine Rechtsverordnung (ab<br />
dem 4. Mai <strong>2020</strong> in Kraft) zur<br />
Verarbeitung personenbezogener<br />
Daten zwischen Ges<strong>und</strong>heitsbehörden,<br />
Ortspolizeibehörden <strong>und</strong><br />
Polizeivollzugsdienst aus Gründen<br />
des Infektionsschutzes (Corona-<br />
Verordnung Datenverarbeitung)<br />
erlassen.<br />
Was ist Ihre Haltung zur Diskussion<br />
um die Corona Tracking-App?<br />
Ist der nun eingeschlagene Weg<br />
der dezentralen Speicherung<br />
ein guter Kompromiss zwischen<br />
Datenschutz <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz?<br />
Aus datenschutzrechtlicher Sicht<br />
ist der dezentrale Abgleich, ob<br />
man mit jemandem, der erkrankt<br />
ist, im Inkubationszeitraum Kontakt<br />
hatte, sicherlich einer zentralen<br />
Zusammenführung der Daten<br />
vorzuziehen. Kritisch an der dezentralen<br />
Variante wird gesehen,<br />
dass er mehr „Einsatz“ von der<br />
Bevölkerung verlangt. Nicht nur<br />
der Neu-Infizierte muss seine Erkrankung<br />
aktiv melden, auch alle<br />
anderen Nutzer*innen der App<br />
müssen regelmäßig selbst abgleichen,<br />
ob die in ihrem Smartphone<br />
hinterlegten Codes mit einem<br />
der als infiziert gemeldeten Codes<br />
übereinstimmt. Aus unserer Sicht<br />
sollte man in erster Linie auf das<br />
Verantwortungsbewusstsein der<br />
Bürger*innen setzen, welche die<br />
App ja ganz bewusst nutzen möchten,<br />
um sich selbst <strong>und</strong> andere zu<br />
schützen. Aus unserer Sicht problematisch<br />
sind die immer wieder<br />
neu aufkommenden Vorstöße,<br />
die freiwillige Nutzung der App<br />
auszuhebeln, indem man an deren<br />
Nutzung bestimmte Vorteile<br />
knüpft, wie beispielsweise Restaurantbesuch<br />
oder Reisefreiheit.<br />
Freiheit darf nicht als Privileg oder<br />
als Belohnung für Wohlverhalten<br />
verstanden werden, Freiwilligkeit<br />
muss freiwillig bleiben. Das gilt<br />
besonders für die Corona-App.<br />
Vielen Dank für dieses Gespräch!<br />
Info<br />
Die Fragen stellte<br />
Benedikt Schweizer<br />
Fragen r<strong>und</strong> um das Thema<br />
Datenschutz <strong>und</strong> Infektionsschutzgesetz<br />
werden auch in<br />
den FAQ des LFDI Baden-Württemberg<br />
beantwortet:<br />
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/<br />
faq-corona/.<br />
Anzeige<br />
Hausaufgaben machen. Ein Wunsch,<br />
den wir Millionen Kindern erfüllen.<br />
Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten.<br />
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver wirk lichen konnte,<br />
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
26<br />
Sonderthema<br />
Nachweis von COVID-19-Infektionen<br />
Welche Corona-Antikörpertests sind präzise?<br />
Foto: Roche<br />
Je länger die Corona-Pandemie andauert, desto wichtiger sind Erkenntnisse<br />
darüber, wie weit das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) in<br />
Deutschland tatsächlich verbreitet ist bzw. wie viele Menschen schon<br />
eine COVID-19-Infektion durchgemacht haben. Während man sich<br />
bei akuten Coronavirus-Infektionen auf den direkten Nachweis des<br />
Virus in Rachenabstrichen konzentriert, sollen Antikörpertests<br />
herausfinden, ob das Immunsystem bereits mit dem Erreger fertig<br />
geworden ist. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Antikörpertests<br />
auf dem Markt, <strong>doch</strong> nicht alle Testverfahren sind tatsächlich aussagekräftig.<br />
Ein Überblick.<br />
Nachweis. Im Verlauf der Corona-Pandemie gewinnt die Testung von Antikörpern<br />
gegen SARS-CoV-2 zunehmend an Bedeutung, um Aussagen über den Immunstatus<br />
der Bevölkerung treffen zu können.<br />
Da die Symptome einer COVID-<br />
19-Infektion vielfältig sind <strong>und</strong><br />
manche Infektionen sogar symptomlos<br />
verlaufen können, ist es<br />
möglich, dass viele Menschen<br />
diese Infektion schon hinter sich<br />
haben, ohne es zu wissen. Um<br />
besser einschätzen zu können,<br />
wie groß die Durchseuchung der<br />
Bevölkerung mit dem neuartigen<br />
Coronavirus tatsächlich ist, können<br />
Antikörpertests dabei eine<br />
gute Hilfe sein. Insbesondere für<br />
Ärzte, Zahnärzte <strong>und</strong> Pflegepersonal<br />
wäre es im Hinblick auf<br />
ihre Berufsausübung beruhigend<br />
zu wissen, ob bei ihnen eine Immunität<br />
besteht.<br />
Gr<strong>und</strong>lagen. Virologen gehen<br />
davon aus, dass die Corona-Pandemie<br />
erst dann zu Ende ist, wenn<br />
60 bis 70 Prozent der Bevölkerung<br />
eine Infektion durchgemacht haben.<br />
Erste Studien haben gezeigt,<br />
dass Menschen nach durchlaufener<br />
SARS-CoV-2-Infektion spezifische<br />
Antikörper entwickeln, die<br />
man aber erst nach einer gewissen<br />
Zeit im Blut nachweisen kann.<br />
Bei den Tests liegt das Augenmerk<br />
auf drei Klassen von Antikörpern:<br />
Das Immunglobulin A<br />
(IgA) zeigt ca. zwei Wochen nach<br />
Beginn der Erkrankung, ob die<br />
Person Antikörper gebildet hat.<br />
Das Immunglobulin G (IgG) kann<br />
erst nach etwa drei Wochen im Blut<br />
nachgewiesen werden. Bei den<br />
Corona-Antikörper-Schnelltests<br />
konzentriert man sich auch auf das<br />
Immunglobulin M (IgM). Dieses<br />
Immunglobulin ist die früheste<br />
Immunantwort des Immunsystems<br />
<strong>und</strong> zeigt die akute Infektionsphase<br />
einer Krankheit an.<br />
Der Corona-Antikörpertest,<br />
auch Serologietest genannt, funktioniert<br />
folgendermaßen: Auf eine<br />
Testplatte, die mit Bruchstücken<br />
des neuen Coronavirus präpariert<br />
ist, wird das zu untersuchende<br />
Blut aufgetragen. Enthält das Blut<br />
Antikörper, so verbinden sie sich<br />
mit den Virus-Bruchstücken. Die<br />
Verbindung kann anschließend<br />
mit einem Farbmarker dargestellt<br />
werden. Diese Art von Testverfahren<br />
nennt man ELISA (Enzyme-<br />
Linked Immunosorbent Assay).<br />
Sicherheit. Besonders wichtig<br />
ist, dass der Corona-Antikörpertest<br />
zuverlässig funktioniert. Er sollte<br />
im Idealfall nur auf Antikörper<br />
gegen SARS-CoV-2 anschlagen,<br />
aber keine Kreuzreaktion mit anderen<br />
ähnlichen, aber harmlosen<br />
Coronaviren-Antikörpern zeigen.<br />
Diese sogenannten falsch-positiven<br />
Bef<strong>und</strong>e würden dazu führen,<br />
dass sich die untersuchten Personen<br />
fälschlicherweise für immun<br />
halten, sich durch unvorsichtiges<br />
Verhalten anstecken <strong>und</strong> das Virus<br />
weiterverbreiten. Somit sind zwei<br />
Kriterien bei einem Antikörpertest<br />
entscheidend: die Spezifität <strong>und</strong><br />
die Sensitivität. Die Spezifität gibt<br />
an, wie viel Prozent ges<strong>und</strong>e Personen<br />
der Test auch tatsächlich als<br />
ges<strong>und</strong> erkennt. Die Sensitivität<br />
gibt schließlich an, wie viel Prozent<br />
der Antikörperträger tatsächlich erkannt<br />
werden. Je höher beide Werte<br />
sind, desto sicherer ist das Testergebnis.<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 27<br />
Bandbreite. In Apotheken <strong>und</strong> im<br />
Internet gibt es bereits seit einigen<br />
Wochen verschiedene Corona-Antikörper-Schnelltests.<br />
Sie eignen sich<br />
je<strong>doch</strong> nur bedingt zum Nachweis einer<br />
COVID-19-Infektion, da sie oft<br />
eine hohe Fehlerquote haben <strong>und</strong> sowohl<br />
falsch-positive als auch falschnegative<br />
Ergebnisse liefern können.<br />
Problematisch ist außerdem, dass die<br />
Hersteller ihre Tests selbst zertifizieren<br />
dürfen, weil sie als Medizinprodukte<br />
niedrigen Risikos eingestuft<br />
sind. Somit gilt eine Validierung der<br />
Tests als nicht gesichert. Zunehmend<br />
werden auch Fälschungen verkauft,<br />
vor denen bereits die WHO warnte.<br />
Auch das Robert Koch-Institut<br />
(RKI) lehnt eine alleinige Corona-<br />
Diagnostik mithilfe von Antikörper-<br />
Schnelltests ab. Bei einem Verdacht<br />
auf eine COVID-19-Infektion sollen<br />
die amtlich empfohlenen Testverfahren<br />
zum Nachweis von SARS-CoV-2<br />
durchgeführt werden.<br />
Durchbruch. Anfang Mai <strong>2020</strong><br />
verkündete der Pharmakonzern<br />
Roche, dass der eigens entwickelte<br />
„Elecsys-Anti-SARS-CoV-<br />
2-Antikörpertest“ von der USamerikanischen<br />
Food and Drug<br />
Administration (FDA) eine Genehmigung<br />
zur Verwendung in<br />
Notfallsituationen (Emergency<br />
Use Authorization EUA) erhalten<br />
habe. Damit kann der Test in Ländern,<br />
in denen die CE-Kennzeichnung<br />
anerkannt wird, also auch in<br />
allen EU-Ländern, zum Einsatz<br />
kommen. Laut Pressemitteilung<br />
von Roche hat dieser Corona-<br />
Antikörpertest 14 Tage nach einer<br />
bestätigten Infektion mittels PCR<br />
eine Spezifität von mehr als 99,8<br />
Prozent <strong>und</strong> eine Sensitivität von<br />
100 Prozent. Das wäre die bislang<br />
niedrigste Fehlerquote unter allen<br />
auf dem Markt angebotenen Tests.<br />
In Deutschland wird der Test ab<br />
Mitte Mai verfügbar sein <strong>und</strong> auf<br />
speziellen immunologischen Analysegeräten<br />
von Roche durchgeführt.<br />
Diese Roche-Geräte sind<br />
weltweit nahezu flächendeckend<br />
installiert, somit kann die Testung<br />
fast überall durchgeführt werden.<br />
B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsminister Jens<br />
Spahn betrachtet diesen Corona-<br />
Antikörpertest als „eine wichtige<br />
neue Wegmarke im Kampf gegen<br />
Unterstützung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unterstützt die<br />
Investitionen der Firma Roche am Standort Penzberg, um besser gegen Corona gewappnet<br />
zu sein.<br />
das Virus“. Er hat mit Roche bereits<br />
die Lieferung von drei Millionen<br />
Corona-Antikörpertests<br />
alleine im Monat Mai vereinbart.<br />
Für die kommenden Monate sind<br />
je fünf Millionen Tests zur Auslieferung<br />
nach Deutschland bestellt.<br />
Auch wenn sich laut Spahn<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich jeder testen lassen<br />
kann, wird noch beraten, welchen<br />
Personen der Test primär<br />
zur Verfügung stehen soll. Zu den<br />
Kosten des Tests hat sich Roche<br />
noch nicht konkret ausgedrückt<br />
<strong>und</strong> sie mit „weniger als mehrere<br />
h<strong>und</strong>ert Euro“ beziffert. Es muss<br />
außerdem festgelegt werden, für<br />
welche Menschen die gesetzliche<br />
Krankenversicherung die Kosten<br />
übernimmt.<br />
Um die Tests in großen Chargen<br />
produzieren zu können, wird<br />
die Firma Roche im bayerischen<br />
Penzberg die Produktionskapazität<br />
der biochemischen Anlagen<br />
ausbauen <strong>und</strong> zudem in ein neues<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungszentrum<br />
investieren. Ministerpräsident<br />
Markus Söder hat bereits<br />
zugesagt, dass sich Bayern mit 40<br />
Millionen Euro an den Baumaßnahmen<br />
in Penzberg beteiligen<br />
wird.<br />
Immunität. Noch ist unklar, wie<br />
robust <strong>und</strong> dauerhaft der Immunstatus<br />
gegen Corona ist <strong>und</strong> ob es<br />
von Mensch zu Mensch möglicherweise<br />
Unterschiede gibt. Laut<br />
RKI deuten die Erfahrungen mit<br />
anderen Coronavirus-Erkrankungen<br />
wie SARS oder MERS darauf<br />
hin, dass die Immunität gegen das<br />
neuartige Coronavirus bis zu drei<br />
Jahre anhalten könne.<br />
Mithilfe der Corona-Antikörpertests<br />
können Aussagen über<br />
den Immunstatus der Bevölkerung<br />
getroffen <strong>und</strong> daraus abgeleitet<br />
werden, wann die Pandemie allmählich<br />
abflaut. Die Ergebnisse<br />
könnten wichtige Entscheidungen<br />
über Eindämmungsmaßnahmen<br />
gegen Corona oder die Lockerung<br />
beeinflussen. Durch Testung des<br />
Personals könnten Kliniken gezielt<br />
Ärzte <strong>und</strong> Pflegende mit positivem<br />
Antikörper-Test für die Betreuung<br />
von Patienten mit COVID-19 abstellen.<br />
Mit einem Antikörper-Test<br />
können aber auch rekonvaleszente<br />
Personen ermittelt werden, deren<br />
Serum zur Behandlung einer aktiven<br />
Infektion geeignet wäre.<br />
Das RKI hat bereits verschiedene<br />
b<strong>und</strong>esweite Antikörper-<br />
Studien begonnen, um Verlauf <strong>und</strong><br />
Schwere der Pandemie genauer abschätzen<br />
<strong>und</strong> die Wirksamkeit der<br />
getroffenen Maßnahmen besser bewerten<br />
zu können. Erste Ergebnisse<br />
werden im Juni <strong>2020</strong> erwartet.<br />
Claudia Richter<br />
Foto: Roche/Huber<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
28<br />
Sonderthema<br />
In Praxen läuft der „Normalbetrieb“ wieder an<br />
Niedergelassene Ärzte dürfen wieder den<br />
früheren Versorgungsumfang aufnehmen<br />
Foto: S. Rücker<br />
Nachdem aufgr<strong>und</strong> der Corona-Pandemie in den Arztpraxen<br />
verschiebbare Patientenkontakte zu unterlassen waren <strong>und</strong> die<br />
Zahnärzte zeitweise nur Notfälle behandeln durften, fahren die<br />
Praxen nun den Regelbetrieb wieder hoch, wie auch im Raum<br />
Vaihingen zu spüren ist. – Ein Bericht der Vaihinger Kreiszeitung<br />
vom 12. Mai.<br />
Behandlung in vollem Umfang. „Teilweise wissen die Patienten noch nicht, dass wir<br />
wieder in vollem Umfang behandeln dürfen“, stellt Dr. Udo Lenke fest.<br />
Die Praxen der niedergelassenen<br />
Ärzte <strong>und</strong> Psychotherapeuten können<br />
ab sofort wieder schrittweise<br />
den bisherigen Versorgungsumfang<br />
aufnehmen, allerdings unter strengen<br />
Hygieneanforderungen, heißt<br />
es hierzu in einer Pressemitteilung<br />
der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
Baden-Württemberg (KVBW).<br />
„Wir freuen uns, dass die Patientinnen<br />
<strong>und</strong> Patienten wieder Behandlungen<br />
in Anspruch nehmen<br />
können, die aufgr<strong>und</strong> der Corona-Pandemie<br />
verschoben werden<br />
mussten“, wird der Vorstandsvorsitzende<br />
der KVBW, Dr. Norbert<br />
Metke, zitiert. In den Praxen werde<br />
der Betrieb aber weiterhin teilweise<br />
eingeschränkt bleiben müssen.<br />
Beispielsweise müssen die Praxen<br />
ihr Terminmanagement anpassen,<br />
damit sich immer nur wenige Patienten<br />
in den Praxisräumen aufhalten.<br />
Metke verwies auf strenge<br />
Hygieneanforderungen. „Wir<br />
haben bis Ende der letzten Woche<br />
400 .000 Masken an unsere Mitglieder<br />
verteilt <strong>und</strong> weit über eine Million<br />
M<strong>und</strong>-Nasenschutztücher <strong>und</strong><br />
weiteres Material. Gut die Hälfte<br />
davon haben wir selbst beschafft.<br />
Die Versorgung mit Schutzausrüstung<br />
ist eine Voraussetzung dafür,<br />
dass unsere Mitglieder wieder stärker<br />
in den Praxen tätig werden können.<br />
Das gilt für die eigene, insbesondere<br />
aber auch für die Sicherheit<br />
der Patienten.“<br />
Schutz der Praxen. Wichtig sei,<br />
so Metke, dass die Patienten selbst<br />
zum Schutz der Praxen beitragen.<br />
„Patienten, die ärztliche Hilfe in<br />
Anspruch nehmen, vereinbaren bitte<br />
telefonisch einen Termin in den<br />
Praxen. Wichtig ist ferner, dass die<br />
Patienten eine M<strong>und</strong>-Nasen-Bedeckung<br />
auch beim Besuch in den<br />
Arztpraxen tragen“, so der KVBW-<br />
Vorstandsvorsitzende Metke.<br />
Angebot der Fachärzte. Dass die<br />
Patienten Untersuchungen durch die<br />
Ärzte wieder mehr wahrnehmen, berichtet<br />
beispielsweise Sandra Klett,<br />
Praxismanagerin des Vaihinger Vaisana<br />
Ärztehauses. Es habe noch im<br />
April aufgr<strong>und</strong> der Corona-Ereignisse<br />
sehr viele Terminabsagen von<br />
den Patienten bei den Fachärzten gegeben,<br />
zum Beispiel im Zusammenhang<br />
mit Herzuntersuchungen oder<br />
Magen- beziehungsweise Darmspiegelungen.<br />
Dies sei nun im Mai nicht<br />
mehr der Fall.<br />
Seit 27. April sei der Regelbetrieb<br />
unter den Auflagen der Hygienebestimmungen<br />
wieder möglich, sagt<br />
Klett. Zu diesen Bestimmungen<br />
zählen unter anderem bei Patienten,<br />
Ärzten <strong>und</strong> Mitarbeitern das Tragen<br />
von M<strong>und</strong>-Nasen-Schutz sowie<br />
die Händedesinfektion, ebenso die<br />
Einhaltung erforderlicher Abstände<br />
im Wartebereich. Der Betrieb laufe<br />
unter den Auflagen natürlich ein<br />
wenig eingeschränkt, sagt Klett. Infektpatienten<br />
werden zudem in der<br />
zeitlich <strong>und</strong> räumlich separierten<br />
COVID-Sprechst<strong>und</strong>e behandelt.<br />
Zahnarztpraxen. Auch<br />
bei den Zahnärzten im Ländle<br />
darf wieder ohne Einschränkung<br />
– unter Beachtung der<br />
Hygienemaßnahmen – praktiziert<br />
werden. In der siebten Änderung<br />
der Corona-Verordnung des Landes<br />
heißt es: „Zahnärzte dürfen wieder<br />
uneingeschränkt praktizieren.“ Am<br />
9. April habe die Landesregierung<br />
veröffentlicht, dass bei der zahnärztlichen<br />
Versorgung von Patienten<br />
nur noch akute Erkrankungen<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Sonderthema 29<br />
<strong>und</strong> Notfälle behandelt werden dürfen<br />
<strong>und</strong> alle anderen Behandlungen<br />
zu verschieben seien, berichtet die<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg auf ihrer Homepage.<br />
Wenige Tage später sei es aufgr<strong>und</strong><br />
von Gesprächen zwischen<br />
der zahnärztlichen Körperschaft<br />
<strong>und</strong> der Führung des Sozialministeriums<br />
zur Konkretisierung gekommen:<br />
Danach konnten medizinisch<br />
notwendige zahnärztliche Behandlungen,<br />
insbesondere solche zur<br />
Vermeidung einer Verschlechterung<br />
des Ges<strong>und</strong>heitszustands im Falle<br />
chronischer Zahnerkrankungen,<br />
weiterhin durchgeführt werden.<br />
Nun sind also wieder alle Behandlungen,<br />
auch die Professionelle<br />
Zahnreinigung <strong>und</strong> Prophylaxe,<br />
möglich. „Ich begrüße die Klarstellung“,<br />
sagt der Vaihinger Zahnarzt<br />
Dr. Udo Lenke, Ehrenpräsident der<br />
Landeszahnärztekammer. Notwendig<br />
seien ja eigentlich immer alle<br />
Zahnbehandlungen. Die Patienten<br />
müssten keine Angst davor haben,<br />
in die Praxis zu kommen. „Weil<br />
die Sicherheitsmaßnahmen in den<br />
Zahnarztpraxen schon immer sehr<br />
gut waren <strong>und</strong> durch die Corona-<br />
Pandemie erweitert wurden“, führt<br />
Lenke aus. So gebe es zum Beispiel<br />
einen aufgestockten Fragebogen für<br />
jeden Patienten, „um Risikofälle<br />
auszusortieren“.<br />
Behandlung in vollem Umfang.<br />
Inzwischen kämen schon wieder<br />
mehr Patienten, „aber teilweise<br />
wissen die Patienten noch nicht,<br />
dass wir wieder in vollem Umfang<br />
behandeln dürfen“, stellt der Zahnmediziner<br />
in seiner Praxis fest. Die<br />
allgemeinen Hygienemaßnahmen<br />
halte man natürlich – sofern möglich<br />
– ein. „Die Abstandsregelung<br />
geht leider nicht, weil wir ja nicht<br />
per Homeoffice behandeln können“,<br />
verdeutlicht Lenke. Zur neuesten<br />
Entwicklung meint der Vaihinger<br />
Zahnarzt: „Natürlich arbeiten<br />
wir gerne <strong>und</strong> sind auch gerne<br />
für unsere Patienten da.“ Bei der<br />
Gelegenheit muss er einen großen<br />
Dank an die Mitarbeiter loswerden.<br />
Diese kümmerten sich um die Patienten<br />
<strong>und</strong> die Abläufe <strong>und</strong> seien<br />
eine ganz große Stütze für die Praxis,<br />
„speziell auch jetzt in Corona-<br />
Zeiten“. Eine Anmeldung beim<br />
Zahnarzt sollte, wie auch bei den<br />
Kollegen der Haus- <strong>und</strong> Facharztpraxen,<br />
auf jeden Fall telefonisch<br />
erfolgen. Dann könne auch geregelt<br />
werden, ob im Falle eines Zahnarztbesuchs<br />
die Praxis oder der Corona-<br />
Stützpunkt im Stuttgarter Katharinenhospital<br />
zuständig sei.<br />
Sabine Rücker<br />
Nachdruck mit fre<strong>und</strong>licher Genehmigung der Vaihinger Kreiszeitung<br />
Anzeige<br />
„Man muss Glück<br />
teilen, um es zu<br />
multiplizieren.“<br />
Marie von Ebner-Eschenbach<br />
2017/1<br />
Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)<br />
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00<br />
BIC GENO DE M1 GLS<br />
www.sos-kinderdoerfer.de<br />
SOSKD_Anzeige_IM1_Erdkugel_148x105_sw_neu_RZ.indd 1 12.06.17 11:37<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
30<br />
Sonderthema<br />
Bericht aus einer Schwerpunktpraxis<br />
Verantwortung übernehmen, Versorgung<br />
aufrechterhalten<br />
Zahnschmerzen nehmen keine Rücksicht auf die Coronakrise. Auch<br />
Personen, die selbst an COVID-19 erkrankt sind, können zahnmedizinische<br />
Notfälle darstellen, die trotz bestehender Infektionsrisiken akut<br />
<strong>und</strong> dringend zahnärztlich behandelt werden müssen. Die Kassenzahnärztliche<br />
Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) hat daher für<br />
die Notfallversorgung von COVID-19-Infizierten bzw. in Quarantäne befindlichen<br />
Patienten flächendeckend ein Netz von Klinikambulanzen <strong>und</strong><br />
Schwerpunktpraxen organisiert. Doch wie funktioniert die zahnärztliche<br />
Behandlung dieser Patient*innen in der Praxis <strong>und</strong> welche Erfahrungen<br />
gibt es bisher? Dr. Christian Pfau aus Rottweil gibt Auskunft darüber.<br />
Für die zahnärztliche Versorgung ist<br />
es eine doppelte Herausforderung:<br />
Einerseits schließt eine lückenlose<br />
Versorgung die Notfallbehandlung<br />
von an COVID-19 erkrankten<br />
bzw. in Quarantäne befindlichen<br />
Personen ein. Andererseits hat<br />
der ges<strong>und</strong>heitliche Schutz von<br />
Zahnärzt*innen, Zahnmedizinischen<br />
Fachangestellten sowie den<br />
anderen Patient*innen höchste Priorität.<br />
Dies soll mit dem Netz von<br />
Klinikambulanzen <strong>und</strong> Schwerpunktpraxen<br />
bestmöglich gewährleistet<br />
werden. Insgesamt stehen<br />
landesweit 20 Zahnarztpraxen für<br />
das Netzwerk der Schwerpunktpraxen<br />
zur Verfügung. Ergänzend dazu<br />
haben die Unikliniken Freiburg <strong>und</strong><br />
Tübingen sowie das Katharinenhospital<br />
in Stuttgart <strong>und</strong> das Städtische<br />
Klinikum Karlsruhe sogenannte<br />
Corona-Ambulanzen eingerichtet.<br />
Erfahrungen. Dr. Christian Pfau<br />
ist Inhaber der Praxis Rottweil<br />
Zahnärzte (MVZ) Dr. Pfau & Kollegen,<br />
die zu den Schwerpunktpraxen<br />
gehört. Seiner Auskunft nach<br />
halten sich die Fälle von Corona-infizierten<br />
Patient*innen bislang sehr<br />
in Grenzen, deren Versorgung läuft<br />
hingegen problemlos. Die Kontaktaufnahme<br />
funktioniere gut, bislang<br />
habe es keine Fälle gegeben, in denen<br />
betroffene Patient*innen unangekündigt<br />
in der Praxis aufgetaucht<br />
seien. Auch wenn das Netzwerk<br />
von Schwerpunktpraxen gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
für bestätigte COVID-19-Fälle<br />
vorgesehen war, würden in diesem<br />
Rahmen auch Patienten ohne positives<br />
Testergebnis behandelt. „Wer<br />
Halsschmerzen oder andere Symptome<br />
bekommt, begibt sich vorsorglich<br />
in Quarantäne. Bei akuten<br />
Zahnschmerzen kann man aber oft<br />
nicht so lange warten, bis ein Testergebnis<br />
vorliegt“, erläutert Praxisinhaber<br />
Dr. Christian Pfau.<br />
Praxisalltag. Während sich die<br />
Praxis um die Versorgung dieser<br />
speziellen Zielgruppe kümmert,<br />
wird nach dem Einbruch im April<br />
gleichzeitig auch der Normalbetrieb<br />
wieder hochgefahren – unter<br />
den Hygienebedingungen entsprechend<br />
der RKI-Empfehlungen.<br />
Die Patient*innen kommen langsam<br />
wieder zurück, so Dr. Pfau:<br />
„Wir haben gut zu tun <strong>und</strong> unsere<br />
eigenen Patienten sind sehr froh,<br />
dass wir für sie zur Verfügung<br />
stehen.“ Das Nebeneinander von<br />
Praxisalltag <strong>und</strong> dem Betrieb als<br />
Schwerpunktpraxis lässt sich gut<br />
organisieren. „Ich mache damit keine<br />
Werbung, aber jede*r Patient*in<br />
sollte mit akuten Schmerzen eine<br />
Anlaufstation haben“, betont Dr.<br />
Pfau. Einerseits übernehme die Praxis<br />
bewusst Verantwortung in einer<br />
schwierigen Zeit, damit nicht eine<br />
Gruppe durch das Netz der Versorgung<br />
fällt. Andererseits soll vermieden<br />
werden, dass die eigenen<br />
Patienten wegbleiben, weil sie sich<br />
unbegründet einem höheren Infektionsrisiko<br />
ausgesetzt sehen. Und<br />
wie sieht es mit dem Praxispersonal<br />
<strong>und</strong> deren Bereitschaft aus? „Ich<br />
habe das offen kommuniziert“, betont<br />
Dr. Pfau. Wer nicht in diesem<br />
Rahmen behandeln möchte, habe<br />
sich melden können <strong>und</strong> werde hier<br />
nicht eingesetzt. Alle Kolleg*innen<br />
in der Praxis <strong>und</strong> genügend Angestellte<br />
erklärten sich je<strong>doch</strong> sofort<br />
bereit, für diese Behandlungen zur<br />
Verfügung zu stehen.<br />
Schutzmaßnahmen. Dass die<br />
Sicherheit aller Beteiligten in dieser<br />
Praxis höchste Priorität hat, zeigt<br />
sich an dem Konzept der Praxisorganisation<br />
von Dr. Pfau & Kollegen.<br />
Reguläre Behandlungen <strong>und</strong><br />
die Versorgung der von Corona<br />
betroffenen Patient*innen erfolgen<br />
räumlich <strong>und</strong> zeitlich getrennt. Potenziell<br />
an COVID-19-Erkrankte<br />
werden nur abends an drei Tagen in<br />
der Woche behandelt. In dringenden<br />
Fällen kann an andere Schwerpunktpraxen<br />
vermittelt werden. Die<br />
konsequente Trennung der Patientengruppen<br />
sei wichtig, um die Abläufe<br />
zu vereinfachen <strong>und</strong> Risiken<br />
zu senken. Beispielsweise müsse<br />
man so nicht ständig die spezielle<br />
Schutzkleidung für die Behandlung<br />
von Risikopatienten aus- <strong>und</strong> wieder<br />
anziehen.<br />
Das Problem mangelnder Schutzausrüstung<br />
konnte ebenfalls gelöst<br />
werden. Die Bestände, die zu Beginn<br />
der Coronakrise noch vorrätig<br />
waren, seien angesichts der riesigen<br />
Nachfrage schnell sehr knapp<br />
geworden. Die Ausrüstung, die die<br />
Praxis zwischenzeitlich von der<br />
KZV erhalten habe, sei bei dem bisherigen<br />
Aufkommen an Patienten<br />
aber völlig ausreichend. Eine reguläre<br />
Behandlung ist also möglich,<br />
der Schutz der beteiligten Personen<br />
bleibt gewährleistet.<br />
Dr. Holger Simon-Denoix<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Fortbildung 31<br />
Phonetische Funktion des orofazialen Systems<br />
Störungen der Sprachentwicklung<br />
Zu den Aufgaben eines Zahnarztes gehört die regelmäßige Kontrolle der Gebissentwicklung in den<br />
Phasen des Milch- <strong>und</strong> Wechselgebisses. Bei diesbezüglichen Auffälligkeiten sollte eine Überweisung zu<br />
einem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ausgestellt werden, welcher den rechtzeitigen Beginn <strong>und</strong><br />
die erforderliche kieferorthopädische Therapie einleiten kann. Häufig sind Zahn- oder Kieferfehlstellungen<br />
mit anderen Störungen im orofazialen Bereich vergesellschaftet. Hierbei steht natürlich die<br />
Entwicklung der Sprache im Vordergr<strong>und</strong>, aber auch der Blick auf myofunktionelle Störungen, Stimme,<br />
Haltung <strong>und</strong> das Schluckmuster. In diesem Übersichtsartikel werden Störungen der Entwicklung<br />
der Sprache, sogenannte Dyslalien oder Artikulationsstörungen, genauer beleuchtet. Sämtliche<br />
Bezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.<br />
Physiologische Sprachentwicklung. Fehlstellungen<br />
der Zähne <strong>und</strong> des Kiefers können mit Beeinträchtigungen<br />
der Sprachentwicklung <strong>und</strong> damit<br />
Auswirkungen auf die Lautbildung assoziiert sein.<br />
Die Erkenntnis, ob eine solche Störung vorliegt,<br />
verlangt Kenntnisse über Gr<strong>und</strong>züge der kindlichen<br />
Sprachentwicklung. Daher werden im Folgenden<br />
Etappen der kindlichen Sprachentwicklung in Kurzform<br />
dargestellt. Als vorsprachliche Fähigkeiten im<br />
Rahmen der sogenannten zwei Lallphasen bis ca. zum<br />
12. Lebensmonat treten zunächst schreiende <strong>und</strong> gurrende<br />
Laute auf, welche vom Lachen abgelöst werden,<br />
auch Gurgel-, Schmatz- <strong>und</strong> Vokallaute werden<br />
produziert. In dieser Entwicklungsphase wird die<br />
Umwelt im Wesentlichen über den Tastsinn erschlossen.<br />
Diese Taktilität fördert insgesamt die Motorik<br />
des heranwachsenden Kindes.<br />
Im späteren Verlauf, der sog. 2. Lallphase (6. bis<br />
12. Monat), nähert sich die Lautgebung der eigentlichen<br />
Muttersprache an, was darauf schließen lässt,<br />
dass hier das Hören eine wesentliche Rolle spielt.<br />
Auffällig sind sogenannte Lallmonologe, d.h. die<br />
Produktion von muttersprachlichen Silben <strong>und</strong> Silbenketten<br />
(„dada“, „baba“). Außerdem können auch<br />
die Nachahmung von Geräuschen <strong>und</strong> die Produktion<br />
erster Wörter, wie z. B. „Mama“, „nein“, „wau-wau“,<br />
beobachtet werden.<br />
Bis zum 2. Lebensjahr bilden sich bilabiale Laute,<br />
wie z. B. /m/, /b/, /d/ <strong>und</strong> der Wortschatz beginnt sich<br />
zu etablieren, sodass erste Worte gesprochen werden<br />
können. Ein aktiver Wortschatz von ca. fünfzig Wörtern<br />
wird aufgebaut.<br />
Bezeichnend ist ebenso, dass Kinder nun sogenannte<br />
Einwortsätze nutzen, um sich zu verständigen, zum<br />
Beispiel: „Ball“. Dies entwickelt sich am Anfang des<br />
2. Lebensjahres zu Zwei- <strong>und</strong> selten auch Dreiwortsätzen.<br />
Im dritten Lebensjahr umfasst der Wortschatz<br />
circa 450 Worte <strong>und</strong> einfache Aufforderungen werden<br />
verstanden. Mit vollendetem vierten Lebensjahr sollten<br />
alle Laute bis auf das /s/ <strong>und</strong> /sch/ korrekt ausgesprochen<br />
werden <strong>und</strong> komplexere Mehrfachaufgaben<br />
werden nun verstanden. Außer dem S-Laut werden<br />
bis zum Alter von fünf Jahren üblicherweise alle Laute<br />
korrekt ausgesprochen.<br />
Abb. 1<br />
Abb. 2<br />
Apikale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />
S. 270.<br />
Dorsale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />
S. 269).<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
32<br />
Fortbildung<br />
Abb. 3<br />
Aussprache. Nicht normgerechte Aussprache des /sch/.<br />
Artikulation. Der Begriff „Artikulation“ meint<br />
die Formung der Sprachlaute im Vokaltrakt, wobei<br />
die Laute durch die Bewegung der Artikulationsorgane<br />
zu den Artikulationsorten entstehen. Artikulationsorgane<br />
im Vokaltrakt, also bewegliche<br />
Elemente, sind hierbei Lippen (labia), Unterkiefer<br />
(mandibula), Zunge (lingua), Gaumensegel (velum),<br />
Rachen (pharynx). Als Artikulationsorte werden<br />
Bereiche im Ansatzraum bezeichnet, auf die sich die<br />
Artikulationsorgane zubewegen können: Lippen (labial),<br />
Zähne (dental), Zahndamm (alveolar), weicher<br />
Gaumen (velar), harter Gaumen (palatal), Gaumenzäpfchen<br />
(uvular), Rachen (pharyngeal), Kehlkopf<br />
(laryngeal).<br />
Artikulationsstörungen. Derartige Störungen liegen<br />
vor, wenn es signifikante zeitliche <strong>und</strong> inhaltliche<br />
Abweichungen von der Altersnorm nach unten gibt.<br />
Dabei kann die Sprachentwicklung isoliert oder im<br />
Zusammenhang mit weiteren Störungen bzw. Primärerkrankungen<br />
auftreten <strong>und</strong> zur Beeinträchtigung<br />
der Entwicklung des Kindes führen. Beispiele hierfür<br />
sind Intelligenzminderungen, Hörstörungen, andere<br />
Sinnesbehinderungen, Entwicklungsstörungen (z. B.<br />
Autismus oder auch Syndrome).<br />
So ist es beispielsweise bei fehlender akustischer<br />
Rückkopplung im Rahmen einer Hörminderung nicht<br />
selten der Fall, dass Sibilanten wie /s/ oder /sch/<br />
häufig <strong>und</strong>eutlich <strong>und</strong> verwaschen ausgesprochen<br />
werden. Bei Spaltbildungen im Gaumen (submukösen<br />
Gaumenspalten) stehen die Bildung von velaren<br />
Laute (/g/, /k/, /ng/, /r/) <strong>und</strong> ein offenes Näseln im<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Anamnestisch kann hierbei schon eine<br />
erste Information erlangt werden, zum Beispiel beim<br />
Erfragen eines späten Sprachbeginnes, langsamen<br />
Spracherwerbs oder anderen Komorbiditäten.<br />
S-Laut. Störungen der Artikulation sind phonetische<br />
Störungen. Die häufigsten Artikulationsstörungen<br />
in der deutschen Sprache sind Fehlbildung der<br />
S- <strong>und</strong> Zischlaute. Dabei ist der S-Laut ein sogenannter<br />
Frikativ, also ein Reibelaut/Engelaut. Hierbei entsteht<br />
die Lautbildung dadurch, dass die Luft durch<br />
eine Enge entweicht. Zu unterscheiden sind die apikale<br />
<strong>und</strong> die dorsale Bildungsweise des S-Lautes. Bei<br />
der apikalen Bildungsweise bewegt sich die Zungenspitze<br />
in Richtung der oberen Schneidezähne, welche<br />
je<strong>doch</strong> nicht berührt werden (regio Papilla incisiva).<br />
Es drängt sich der Phonationsstrom durch die entstandene<br />
Öffnung.<br />
Bei der dorsalen Bildungsweise des S-Lautes liegt<br />
die Zungenspitze an Innenkante der Unterzahnreihe.<br />
Der anteriore Anteil der Zunge wölbt sich zu den palatinalen<br />
Flächen der oberen Frontzähne <strong>und</strong> deren<br />
Zahndamm, wodurch eine Enge gebildet wird. Außerdem<br />
sind die seitlichen Zungenränder angehoben<br />
<strong>und</strong> liegen so an den palatinalen Flächen der oberen<br />
Seitenzähne. Die Zungenoberfläche wird dadurch zu<br />
einer Längsrinne geformt, wo der Luftstrom entweichen<br />
kann.<br />
Ursachen <strong>und</strong> Symptome. Patienten mit Artikulationsstörungen<br />
sind nicht in der Lage den motorischen<br />
Vorgang der Lautbildung korrekt auszuführen. Das<br />
heißt, die Fähigkeit, einen Laut korrekt zu bilden, ist<br />
nicht gegeben. Dabei kann es sich unter Umständen<br />
auch um die Lautbildungsstörung eines oder mehrerer<br />
Laute handeln, die dann nicht der Normphonetik<br />
unserer Muttersprache entsprechen. Ursachen können<br />
sowohl organischer (z. B. audiogene oder kraniofaziale<br />
Anomalien) als auch funktioneller Natur sein.<br />
Im Falle der Fehlbildung der S- <strong>und</strong> Zischlaute sprechen<br />
wir von einem Sigmatismus (umgangssprachlich<br />
oft als „Lispeln“ bezeichnet). Hierbei fällt vor allem<br />
die interdentale oder laterale Bildungsweise akustisch<br />
auf.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich unterscheidet man verschiedene Formen<br />
des Sigmatismus. Die Unterscheidung liegt hier<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Fortbildung 33<br />
vorrangig in der Positionierung der Zunge <strong>und</strong> dem<br />
Entweichen des gebildeten Luftstromes. Die gängigsten<br />
Sigmatismen werden im Folgenden aufgezählt.<br />
Sigmatismus interdentalis: Hier wird die Spitze<br />
der Zunge nach vorne vorgestreckt, zwischen die<br />
geöffneten Zahnreihen. Wahrzunehmen ist dabei ein<br />
eher flächiges <strong>und</strong> stumpfes Reibegeräusch. Dieses<br />
ist akustisch sehr deutlich wahrzunehmen. Auch visuell<br />
ist er deutlich erkennbar.<br />
Sigmatismus addentalis: Bei dieser Auffälligkeit<br />
wird die Enge nicht wie üblich an den Alveolen<br />
gebildet, sondern an den Zähnen. Es erfolgt ein eher<br />
fächerförmiges Entweichen des Luftstromes über den<br />
vorderen Zungenrücken. Akustisch ist ein stumpfes,<br />
gar flächiges /s/ wahrzunehmen, welches mit dem<br />
englischen stimmlosen /th/ verglichen werden kann.<br />
Sigmatismus lateralis: Hier entweicht der Luftstrom<br />
an den Zahnrändern, das heißt im lateralen<br />
Bereich. Akustisch klingt es, also würde mit viel<br />
Speichel gesprochen werden, also eher „schlürfend“.<br />
Sigmatismus stridens: Als scharfes, zischendes<br />
<strong>und</strong>/oder pfeifendes Geräusch wahrzunehmen entsteht<br />
diese Form durch einen zu kräftigen Luftstrom<br />
bei der S-Lautbildung. Die nicht normgerechte Aussprache<br />
des /sch/ wird dabei als Schetismus bezeichnet.<br />
Therapieansätze. Sprachentwicklungsstörungen<br />
sollten von einem Sprachtherapeuten abgeklärt werden.<br />
Eine fachärztliche Untersuchung kann durch einen<br />
Phoniater <strong>und</strong> Pädaudiologen oder durch einen<br />
HNO-Arzt erfolgen. Im Fokus stehen hierbei der Ausschluss<br />
einer Hörstörung, einer lavierten/submukösen<br />
Gaumenspalte <strong>und</strong> die Beurteilung der adenoiden Vegetation.<br />
Außerdem ist es wichtig zu ermitteln, ob der<br />
Laut motorisch gebildet oder aber nicht in seiner Lautumgebung<br />
korrekt wiedergegeben werden kann <strong>und</strong><br />
durch einen anderen Laut ersetzt wird.<br />
Seit dem 1.7.2017 ist die Heilmittelverordnung<br />
durch Zahnärzte in eigener Richtlinie geregelt (z. B.<br />
www.kzbv.de). Laut diesem Katalog ist zum Beispiel<br />
eine Sprech- <strong>und</strong> Sprachtherapie bei Störungen des<br />
Sprechens (SPZ, z. B. durch Zahn- <strong>und</strong> Kieferfehlstellungen)<br />
möglich. Erstverordnungen dürfen über<br />
zehn Sitzungen ausgeschrieben werden. Diese sind bis<br />
zu dreimal wöchentlich durchzuführen, jeweils über<br />
30 oder 45 Minuten. Für eine Folgeverordnung sind<br />
nochmals zehn Sitzungen verschreibbar. In der Regel<br />
sollten zur Behebung der Auffälligkeit nicht mehr als<br />
30 Einheiten notwendig sein.<br />
Abb. 4<br />
Distalbiss seitliche Ansicht.<br />
Kieferorthopädisch- logopädische Auffälligkeiten.<br />
Häufige Kombinationen aus kieferorthopädisch <strong>und</strong><br />
sprachlichen Auffälligkeiten werden im Folgenden<br />
dargestellt. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen,<br />
dass hier nur regelmäßig auftretende Zusammenhänge<br />
dargestellt werden, die keinesfalls bei jedem<br />
Patienten zutreffen müssen.<br />
Distalbiss. Die vergrößerte sagittale Stufe, welche<br />
nicht selten mit einer mandibulären Retrognathie einhergeht,<br />
ist eine sehr häufig auftretende Zahnfehlstellung.<br />
Dabei ist in habitueller Okklusion ein deutlich<br />
vergrößerter Overjet zu erkennen. Neben der genetischen<br />
Komponente spielen auch Habits <strong>und</strong> Parafunktionen<br />
(Daumenlutschen, Lippeneinlagerung o. ä.)<br />
eine große Rolle. Eine Kombination mit protrudierten<br />
Frontzähnen sowie ein (potenziell) inkompetenter<br />
Lippenschluss zeigen sich in gesteigerter Häufigkeit.<br />
Der am häufigsten anzutreffende Sigmatismus ist<br />
hier der Sigmatismus addentalis. Hierbei stößt die<br />
Zunge bei der Lautbildung an die Unterkieferschneidezähne<br />
<strong>und</strong> das /s/ wird an den Zähnen gebildet. Als<br />
Nebenbef<strong>und</strong> bei fehlendem Lippenkontakt gibt es<br />
Auffälligkeiten bei der Bildung der Labiallaute (/b/,<br />
/p/, /m/).<br />
Im Rahmen einer Therapie mittels kieferorthopädischer<br />
Geräte gilt es hier, die sagittale Stufe zu verringern<br />
<strong>und</strong> eine stabile <strong>und</strong> funktionelle Okklusion zu<br />
schaffen. Oft ist es vorher notwendig, den Oberkiefer<br />
transversal nachzuentwickeln <strong>und</strong> die Frontzähne im<br />
Oberkiefer aufzurichten. Eine sagittale Nachentwicklung<br />
des Unterkiefers erfolgt häufig mittels funktionskieferorthopädischen<br />
Geräten, kann aber mit festsitzenden<br />
kieferorthopädischen Behandlungsmitteln<br />
therapiert werden.<br />
Auf die Abgewöhnung bestehender Habits, zum<br />
Beispiel das Lippenbeißen, muss konsequent geachtet<br />
werden. Erforderlich ist dann zusätzlich auch eine logopädische<br />
Begleittherapie (Übungen zur Zungenmotorik,<br />
Lippenmotorik/Verbesserung des Lippenschlusses,<br />
Abgewöhnung bestehender Habits, Korrektur<br />
Schluckmuster etc.).<br />
Offener Biss. Als offenen Biss bezeichnet man eine<br />
Zahn- oder Kieferfehllage, bei welcher kein Kontakt<br />
von Zähnen im Front- <strong>und</strong>/oder Seitenzahngebiet bei<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
34<br />
Fortbildung<br />
Abb. 5 Abb. 6<br />
Skelettal offener Biss. Ansicht von frontal.<br />
Skelettal offener Biss. Seitliche Ansicht.<br />
habitueller Okklusion besteht. Dabei ist der Zahnwechsel<br />
als solcher ausgenommen. Der offene Biss<br />
kann sowohl genetisch als auch umweltbedingt bzw.<br />
habituell vorkommen, in seltenen Fällen auch rachitisch<br />
bedingt sein. Bei den Therapieansätzen muss<br />
festgestellt werden, ob ein vertikales Wachstumsmuster<br />
des Gesichtsskelettes besteht. In diesem Fall spricht<br />
man von einem skelettal-offenem Biss. Bei vorrangig<br />
neutralem Wachstumsmuster mit habitueller Ätiologie,<br />
wie zum Beispiel bei infantilem Schluckmuster<br />
oder exzessivem Gebrauch von Schnullern oder auch<br />
beim Fingerlutschen, handelt es sich um einen dentoalveolär-offenen<br />
Biss.<br />
Hierbei hilft schon ein extraoraler Eindruck, denn<br />
bei dem vorwiegend erblich bedingten offenen Biss ist<br />
meist eine vergrößerte Untergesichtshöhe charakteristisch.<br />
Häufig auftretende artikulatorische Auffälligkeiten<br />
in Kombination mit einem offenen Biss sind der<br />
Sigmatismus interdentalis bzw. eine interdentale Bildungsweise<br />
des /sch/ <strong>und</strong>/oder /ch/. Auch ein lateraler<br />
Sigmatismus sowie die laterale Bildungsweise des<br />
/sch/ sind keine Seltenheit.<br />
Häufig findet man ebenso eine interdentale Bildungsweise<br />
der Laute /l/, /d/, /t/ <strong>und</strong> /n/. Therapeutisch<br />
gesehen liegt die Priorität bei einem dentoalveoläroffenen<br />
Biss in der Ursachenbeseitigung, das heißt<br />
der Umstellung des infantilen Schluckmusters, bei<br />
welchem die Zunge tausendfach am Tag (also beim<br />
Schluckakt) zwischen die Zahnreihen der Front gepresst<br />
wird, sodass der offene Biss persistieren kann.<br />
Nicht selten entsteht bereits beim Abstellen des infantilen<br />
Schluckens bereits eine Besserung der Bisssituation.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird der Schluss des offenen<br />
Bisses angestrebt.<br />
Im Rahmen des skelettal-offenen Bisses kann es auf<br />
gr<strong>und</strong> von ungünstigen Wachstumsverläufen erforderlich<br />
sein, den strukturell-offenen Biss durch eine Operation<br />
im Rahmen der kombiniert kieferorthopädischkieferchirurgischen<br />
Behandlung zu schließen. Inhalte<br />
einer logopädischen Begleittherapie sollten beispielsweise<br />
die Abgewöhnung von Habits, die Regulierung<br />
der Zungen, Wangen- <strong>und</strong> Lippenmuskulatur, aber<br />
auch ganzkörperliche Übungen zur Verbesserung der<br />
Körperstatik sein. Beim habituell bedingten offenem<br />
Biss ist es teilweise auch sinnvoll, eine logopädische<br />
Behandlung voranzusetzen, um ggf. die Eigenregulierung<br />
des Körpers zum Schluss des offenen Bisses zu<br />
fördern.<br />
Kraniofaziale Anomalien. Kraniofaziale Anomalien<br />
sind anlagebedingte oder erworbene Fehlbildungen,<br />
welche einer interdisziplinären Behandlung bedürfen.<br />
Hierbei spielen Anomalien wie Lippen-, Kiefer- <strong>und</strong><br />
Gaumenspaltbildungen oder auch Syndrome, wie<br />
z. B. das Goldenhar-Syndrom oder Morbus Crouzon<br />
etc., eine Rolle. Die Rehabilitation dieser Patienten ist<br />
nicht selten eine Herausforderung für die Behandler.<br />
Stets bedarf es eines umfassenden therapeutischen Behandlungskonzeptes.<br />
Beispielhaft soll sich hier dem Thema der Lippen-,<br />
Kiefer- <strong>und</strong> Gaumenspalten zugewandt werden.<br />
Im Laufe des Wachstums werden meist eine<br />
maxilläre Hypoplasie unter anderem durch den Narbenzug<br />
im Oberkiefer <strong>und</strong> ggf. auftretende Nichtanlagen<br />
oberer seitlicher Schneidezähne deutlich. In<br />
der Folge entsteht oft eine progene Verzahnung der<br />
Frontzähne.<br />
Die kieferorthopädische Behandlung dieser Patienten<br />
beginnt, neben dem präoperativen Einsatz von<br />
M<strong>und</strong>-Nasen-Trennplatten im Säuglingsalter, häufig<br />
schon in der ersten Phase des Wechselgebisses mit<br />
dem Versuch der transversalen Weitung <strong>und</strong> sagittalen<br />
Nachentwicklung des Oberkiefers sowie einer Überstellung<br />
der Frontzähne.<br />
Häufige sprachliche Auffälligkeiten beim Vorliegen<br />
einer Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte sind die sogenannte<br />
Rhinophonie oder Rhinolalie (umgangssprachlich<br />
auch unter Näseln bekannt). Hierbei tritt zu viel<br />
oder zu wenig Luft bei der Stimmbildung/beim Sprechen<br />
über die Nase aus. Treten durch diese Einschränkungen<br />
auch Lautfehlbildungen auf, wird dies als Rhi-<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Fortbildung 35<br />
Abb. 7 Abb. 8<br />
Abbildungen: Dr. Riemekasten<br />
Linksseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Seitliche Ansicht.<br />
Aufsicht. Linksseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, Aufsichtsaufnahme.<br />
nolalie bezeichnet. Bei kraniofazialen Anomalien ist<br />
aber auch eine Abklärung der Hörstörung unbedingt<br />
anzuraten.<br />
Betrachtet man die Artikulation, so ist ein Sigmatismus<br />
addentalis bei progener Verzahnung häufig. Ein<br />
Schetismus ergänzt nicht selten dieses Bild. Auch sind<br />
oft die nasalen Laute (/m/, /n/, /ng/) oder velaren Laute<br />
auffällig. Bei Vorliegen von Lippenspalten ist der Lippenkontakt<br />
der Labiallaute /b/, /p/, /m/ <strong>und</strong> der Vokale<br />
wie /o/, /u/ oft nur eingeschränkt oder nicht möglich.<br />
Logopädische/sprachtherapeutische Intervention ist<br />
hier unbedingt anzuraten, wobei die Myofunktion aktiviert<br />
werden muss, die Stimmfunktion verbessert <strong>und</strong><br />
die Artikulation, wenn möglich, korrigiert werden sollte.<br />
Zusammenfassung. Im Rahmen des Zahnwechsels<br />
sollte ein Zahnarzt regelmäßig auch die Zahn<strong>und</strong><br />
Kieferstellung kontrollieren. Abweichungen von<br />
der normalen Gebissentwicklung sollten notiert <strong>und</strong><br />
bei auffälligen Unregelmäßigkeiten <strong>und</strong> progredienten<br />
Veränderungen dem Kieferorthopäden vorgestellt<br />
werden, welcher den optimalen Behandlungszeitpunkt<br />
individuell bestimmen kann.<br />
Zudem können eine Überprüfung der Sprachbildung<br />
unter Kenntnis der kindlichen Sprachentwicklung<br />
<strong>und</strong> die Beurteilung einer myofunktionellen Störung<br />
durchgeführt werden. Wichtige Anhaltspunkte bieten<br />
hierbei die Lautbildung, der Schluckvorgang oder<br />
noch vorhandene Habits. Eine sorgfältige Anamnese<br />
bildet dabei stets die Gr<strong>und</strong>lage.<br />
Falls sprachliche Normabweichungen auffallen,<br />
sollte eine Überweisung <strong>und</strong> Rezeptierung für die entsprechende<br />
Fachdisziplin erfolgen.<br />
Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.<br />
zahnaerzteblatt.de oder kann beim IZZ bestellt<br />
werden unter Tel: 0711/222966-14 oder E-Mail:<br />
info@zahnaerzteblatt.de.<br />
Dr. Sandra Riemekasten<br />
Poliklinik für Kieferorthopädie,<br />
Universität Leipzig<br />
Poliklinik für Kieferorthopädie,<br />
Universität Leipzig<br />
Dr. Sandra Riemekasten<br />
Anzeige<br />
Ihr neueR ArbeitsPLATZ<br />
WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN DEN BEREICHEN<br />
MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.<br />
Unsere Teams sind in r<strong>und</strong> 60 Ländern im Einsatz. Werden Sie ein Teil davon!<br />
Informieren Sie sich online: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten<br />
© Fathema Murtaza<br />
Träger des Friedensnobelpreises<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
36<br />
Praxis<br />
Der GOZ-Ausschuss der LZK BW informiert<br />
Zweierlei Maß<br />
„Nach langer Durststrecke sollen Anwälte 10 Prozent mehr Geld<br />
bekommen“ titelt die FAZ am 15.04.<strong>2020</strong>.<br />
Die Präsidentin des Deutschen<br />
Anwaltvereins (DAV) Edith Kindermann<br />
verweist auf den langen<br />
Zeitraum von sieben Jahren seit<br />
der letzten Erhöhung, in der die<br />
Tariflöhne um fast 19 Prozent gestiegen<br />
seien, ohne dass sich bei<br />
der Anwaltsvergütung etwas getan<br />
hätte. Und weiter: „Die Fraktionen<br />
in B<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Länderparlamenten<br />
signalisieren schon seit<br />
langer Zeit, dass sie eine Gebührenanpassung<br />
befürworten. Auch<br />
im B<strong>und</strong>esjustizministerium hält<br />
man die Forderungen der Anwälte<br />
für berechtigt“.<br />
Seit dem 14. Februar <strong>2020</strong> gilt<br />
auch die neue GO-Tierarzt. Für<br />
eine wirtschaftliche Praxisführung<br />
wird der 2-fache Satz angesehen.<br />
Die Extraktion eines<br />
Zahnes beim H<strong>und</strong> wird dann mit<br />
51,30 Euro bemessen.<br />
Zahnärztliche Realität. Davon<br />
können die Zahnärzte seit<br />
1988 nur träumen. Angesichts des<br />
Kostendrucks <strong>und</strong> der sich verändernden<br />
Nachfrage nach zahnärztlichen<br />
Leistungen in einer<br />
Zeit des wirtschaftlichen Wandels<br />
während <strong>und</strong> nach der Corona-<br />
Pandemie auf Anhebung des<br />
GOZ-Punktwerts zu warten, stellt<br />
für die zahnärztlichen Praxen auf<br />
absehbare Zeit immer noch keine<br />
Lösung dar.<br />
Novellierung der GOZ. Zuletzt<br />
war 2012 mit der Novellierung<br />
der GOZ ein Anlass gegeben,<br />
dem jahrelangen Drängen<br />
der Zahnärzte nachzugeben, <strong>und</strong><br />
den Punktwert anzuheben. Das<br />
Ges<strong>und</strong>heitsministerium richtete<br />
je<strong>doch</strong> sein Augenmerk nicht auf<br />
die Anpassung der Gebührenhöhe<br />
an die allgemeine Preisentwicklung,<br />
sondern auf die globalen<br />
Ausgaben der Kostenerstatter <strong>und</strong><br />
befand, dass das zahnärztliche<br />
Honorar auch ohne Anhebung des<br />
Punktwertes „durch Mengen- <strong>und</strong><br />
Struktureffekte“ gestiegen sei.<br />
Aus Sicht der Zahnärzte kommt<br />
der Verordnungsgeber schon lange<br />
nicht mehr seiner gesetzlichen<br />
Pflicht, einen fairen Ausgleich<br />
zwischen den Interessen von Ärzten<br />
<strong>und</strong> Patienten herbeizuführen,<br />
nach.<br />
Gerichtsverfahren. Bereits<br />
zur Jahrtausendwende klagten<br />
die Zahnärzte vor dem B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
gegen die<br />
fehlende Punktwertanpassung.<br />
Damals wurde die Verfassungsbeschwerde<br />
nicht zur Entscheidung<br />
angenommen <strong>und</strong> das Gericht<br />
beschied, „Eine Verletzung von<br />
Gr<strong>und</strong>rechten <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>rechtsgleichen<br />
Rechten ist nicht ersichtlich,<br />
solange der Beschwerdeführer<br />
von den Gestaltungsmöglichkeiten,<br />
die ihm die GOZ<br />
eröffnet, keinen Gebrauch macht“<br />
(BVerfG, 1 BvR 2311/00 vom<br />
13.2.2001).<br />
Die Richter legten den Finger<br />
in die W<strong>und</strong>e: Die Mehrzahl der<br />
Zahnärzte scheut den Konflikt<br />
mit ihren Patienten, denn nicht<br />
allein die Anhebung des Punktwertes,<br />
auch die Wahl des Steigerungsfaktors<br />
<strong>und</strong> die abweichende<br />
Vereinbarung des zahnärztlichen<br />
Honorars nach § 2 Abs. 1 <strong>und</strong> 2<br />
sind Stellschrauben zum Erzielen<br />
gerechter Honorare. Allerdings<br />
bergen die beiden letzteren ein<br />
erhebliches Konfliktpotenzial gegenüber<br />
der Anhebung des Punktwerts<br />
bei der Rechnungslegung,<br />
<strong>und</strong> selbst heute noch liegt der<br />
durchschnittliche Steigerungsfaktor<br />
über alle Leistungen bei knapp<br />
2,5.<br />
Nach dem Willen des Verordnungsgebers<br />
bildet „der 2,3fache<br />
Gebührensatz die nach Schwierigkeit<br />
<strong>und</strong> Zeitaufwand durchschnittliche<br />
Leistung ab“ <strong>und</strong> für<br />
ihre Bemessung mittels der im<br />
§ 5 Absatz 2 GOZ genannten Kriterien<br />
sind enge Grenze gezogen.<br />
Mit Steigerungsfaktoren unter 3,6<br />
fällt es den Zahnärzten heute immer<br />
schwerer, noch ein gerechtes<br />
Honorar zu generieren.<br />
Entscheidung. Das sehen<br />
auch die Richter in Karlsruhe.<br />
In der letzten Entscheidung hierzu<br />
(BVerfG, 1 BvR 1437/02 vom<br />
25.10.2004) räumen sie ein, „dass<br />
die Gebührenmarge bei Zahnärzten<br />
besonders schmal ist“. Für<br />
überdurchschnittliche Fälle stehe<br />
nur der Rahmen zwischen 2,4<br />
<strong>und</strong> 3,5 zur Verfügung, „weil ein<br />
Absinken unter die Honorierung,<br />
die auch die gesetzliche Krankenversicherung<br />
zur Verfügung stellt,<br />
wohl kaum noch als angemessen<br />
zu bezeichnen ist“.<br />
Letztlich sei diese „schmale<br />
Marge“ je<strong>doch</strong> unbeachtlich, weil<br />
der Zahnarzt eine abweichende<br />
Vereinbarung treffen kann, die<br />
nur den Formalia des § 2 entsprechen<br />
muss. Ausdrücklich bekräftigen<br />
sie, dass das Gr<strong>und</strong>recht aus<br />
Artikel 12 Absatz 1 Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
auch die Freiheit umfasst, „das<br />
Entgelt für berufliche Leistungen<br />
selbst festzusetzen oder mit<br />
denen, die an diesen Leistungen<br />
interessiert sind, auszuhandeln“.<br />
Fazit. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong><br />
sollten die Zahnärzte keine Mühe<br />
scheuen, von ihrem verfassungsrechtlich<br />
garantierten Recht auf<br />
eine gerechte Bezahlung für ihre<br />
Leistungen Gebrauch zu machen!<br />
Autorenteam des<br />
GOZ-Ausschusses der<br />
Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Praxis 37<br />
Antworten, Orientierung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
MPG-Praxisbegehung:<br />
Neue FAQ <strong>und</strong> Leitfaden-Neuversion<br />
Foto: AdobeStock/Gajus<br />
Die anlassunabhängigen Regelüberwachungen der<br />
Aufbereitung von Medizinprodukten in Zahnarztpraxen<br />
werfen unterschiedlichste Fragen auf. Wie z. B.: „Welche<br />
Hygiene-Qualitätssicherungsdokumente sind wirklich<br />
notwendig <strong>und</strong> wie müssen diese aufgebaut sein?“,<br />
„Welche Qualifikation benötigen die Mitarbeiter/innen<br />
für die Aufbereitung <strong>und</strong> Freigabe von Medizinprodukten?“<br />
<strong>und</strong> “Welche Anforderungen werden an den Aufbereitungsraum<br />
gestellt bzw. was ist bei der Bereichstrennung<br />
zu beachten?“ Ein neuer Fragen- <strong>und</strong> Antwortkatalog<br />
<strong>und</strong> eine Neuversion des Leitfadens des Landes<br />
Baden-Württemberg bieten die optimale Orientierung<br />
<strong>und</strong> schaffen Klarheit bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.<br />
Leitfaden. Im Oktober 2019 ist der überarbeitete<br />
„Leitfaden des Landes Baden-Württemberg zur hygienischen<br />
Aufbereitung von Medizinprodukten“ (Version 3,<br />
gültig ab 16.10.2019) veröffentlicht worden. Dieser gibt<br />
einen Überblick über die aktuell gültigen Anforderungen<br />
sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur hygienischen<br />
Aufbereitung von Medizinprodukten.<br />
FAQ. In Zusammenarbeit mit der Landeszahnärztekammer<br />
<strong>und</strong> den Regierungspräsidien unter dem Dach<br />
des Sozialministeriums sind im „Arbeitskreis Aufbereitung<br />
zahnärztlicher Instrumente“ (AKAZI) Fragen <strong>und</strong><br />
Antworten zur Aufbereitung von Medizinprodukten in<br />
Bereich Zahnheilk<strong>und</strong>e (FAQ-Endfassung 16.10.2019)<br />
erarbeitet worden.<br />
Inhalt Leitfaden. Um eine Übersicht im „Leitfaden<br />
des Landes Baden-Württemberg“ zu erhalten, werden<br />
einzelne Kapitel beispielhaft aufgeführt: 1. Rechtliche<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, 2. Qualitätsmanagement, 4. Personenqualifikation,<br />
5. Raum- <strong>und</strong> Zonenkonzept, 6. Schutzausrüstung<br />
<strong>und</strong> Personalhygiene, 7. Risikobewertung <strong>und</strong><br />
Einstufung von Medizinprodukten, 8. Herstellerangaben,<br />
9. Verfahrensvalidierung, 11. Manuelle Reinigung<br />
<strong>und</strong> Ultraschallreinigung, 12. Chemische Desinfektion,<br />
13. Maschinelle Reinigung <strong>und</strong> Desinfektion, 14. Reinigungs-<br />
<strong>und</strong> Funktionskontrolle, Pflege, 15. Sterilgutverpackung<br />
<strong>und</strong> Kennzeichnung, 16. Sterilisation, 17.<br />
Sterilgutfreigabe, 18. Lagerung, 23. Hinweise zu Übertragungsinstrumenten<br />
(z. B. Hand- <strong>und</strong> Winkelstücke),<br />
24. Hinweise zu wasserführenden Systemen <strong>und</strong> Behandlungseinheiten.<br />
Inhalt FAQ. Der im AKAZI erstellte Katalog umfasst einige<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>und</strong> häufig aus den Praxen gestellte<br />
Fragen r<strong>und</strong> um die Praxisbegehung <strong>und</strong> die Aufbereitung<br />
von Medizinprodukten. Die FAQ sollen einem ersten<br />
Überblick <strong>und</strong> einer ersten Information dienen. Die<br />
Vielzahl der individuell in der Inspektionspraxis anfallenden<br />
Aspekte können sie nicht abdecken.<br />
PRAXIS-Handbuch. Die Neuversion des Leitfadens<br />
<strong>und</strong> den neuen Fragen- <strong>und</strong> Antwortkatalog finden Sie<br />
im PRAXIS-Handbuch auf der Homepage der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg unter https://<br />
lzk-bw.de wie folgt: „ZAHNÄRZTE“ >>> unter der Rubrik<br />
„Praxisführung“ auf das „PRAXIS-Handbuch“ >>><br />
nochmal auf „PRAXIS-Handbuch“ >>> Schaltfläche „5.<br />
Praxisbegehung - Was nun?“ >>> 5.2 Fragen <strong>und</strong> Antworten<br />
(FAQ) zur Aufbereitung von Medizinprodukten“<br />
>>> „5.2.1 Fragen <strong>und</strong> Antworten zur Aufbereitung von<br />
Medizinprodukten im Bereich Zahnheilk<strong>und</strong>e“ <strong>und</strong> unter<br />
„5.3 Gesetze & Vorschriften“ >>> „5.3.6 Leitfaden des<br />
Landes Baden-Württemberg zur hygienischen Aufbereitung<br />
von Medizinprodukten“. Ihre LZK-Geschäftsstelle<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
Kursprogramm Juli / November <strong>2020</strong><br />
Jetzt online<br />
anmelden unter<br />
fortbildung.kzvbw.de<br />
Strukturierte Fortbildung PARODONTOLOGIE & PERIIMPLANTÄRE THERAPIE, Teil 1-3<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ40501) 25.11.-28.11.<strong>2020</strong><br />
Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger, Freiburg (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 3.400.-<br />
27.01.-30.01.2021<br />
19.03.-20.03.2021<br />
101 Fortbildungspunkte<br />
Rehabilitation tief zerstörter Zähne mittels Komposit<br />
- Königsdisziplin der Zahnerhaltung<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ31016)<br />
Prof. Dr. Dr. Diana Wolff, Tübingen<br />
9 Fortbildungspunkte<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 375.-<br />
Erfolgreiche Praxisführung für Niedergelassene Zahnärzte<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ20217)<br />
Dirk Nayda, Titisee-Neustadt<br />
5 Fortbildungspunkte<br />
Update Kinderzahnheilk<strong>und</strong>e<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ31318)<br />
Prof. Dr. Christian H. Splieth, Greifswald<br />
7 Fortbildungspunkte<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 95.-<br />
Minimalinvasive vollkeramische Therapiekonzepte<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ30920)<br />
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Düsseldorf<br />
8 Fortbildungspunkte<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 275.-<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 375.-<br />
OnyxCeph 3 Basisseminar: FRS-Analyse <strong>und</strong> digitale Bildverwaltung<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ30221)<br />
DI Mag. Christian Url, Wien<br />
9 Fortbildungspunkte<br />
Digitale 3D KFO CAD/CAM in der Orthodontie<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ30222)<br />
Dr. Dr. Silvia M. Silli, Wien<br />
8 Fortbildungspunkte<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 275.-<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 325.-<br />
EXTRUSION - REPLANTATION - INTERAKTION<br />
Geweberegeneration mit dem Tissure Master Concept<br />
(Kurs-Nr.: 20FKZ30523)<br />
Dr. Gernot Mörig, ZA Robert Svoboda,<br />
Düsseldorf<br />
(für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
€ 595.-<br />
9 Fortbildungspunkte<br />
11.7.<strong>2020</strong><br />
18.7.<strong>2020</strong><br />
23.9.<strong>2020</strong><br />
26.9.<strong>2020</strong><br />
9.10.<strong>2020</strong><br />
10.10.<strong>2020</strong><br />
10.10.<strong>2020</strong><br />
FFZ Fortbildungsforum<br />
Zahnärzte<br />
Merzhauser Straße 114-116<br />
79100 Freiburg<br />
Fon: 0761 4506-160/-161<br />
Fax: 0761 4506-460<br />
Mail: info@ffz-fortbildung.de<br />
Web: www.ffz-fortbildung.de
Kultur 39<br />
Werke der Sammlungen Frieder, Hubert <strong>und</strong> Franz Burda<br />
Meisterwerke des Expressionismus<br />
Abbildung: © VG Bild-Kunst, Bonn <strong>2020</strong><br />
Mit der Ausstellung „Die Bilder der Brüder. Eine Sammlungsgeschichte<br />
der Familie Burda“ öffnet das Museum Frieder Burda<br />
nach der Corona-Schließung nun wieder. Gezeigt werden bis zum<br />
4. Oktober expressionistische Meisterwerke, die die Brüder Frieder,<br />
Hubert <strong>und</strong> Franz Burda im Lauf der Zeit zusammentrugen, darunter<br />
Gemälde von Kirchner, Schmidt-Rottluff, Münter <strong>und</strong> Beckmann.<br />
US-Künstler Carl Ostendarp hat sie in farbige Wandmalereien gebettet.<br />
Was die Eltern Aenne <strong>und</strong> Franz<br />
Burda sammelten, förderte die Begeisterung<br />
der drei Brüder Franz,<br />
Frieder <strong>und</strong> Hubert für die Kunst.<br />
Eine Leidenschaft fürs Leben entstand.<br />
Gesichter leuchten in starkem<br />
Pink, Körper räkeln sich in grellem<br />
Gelb, bunte Landschaften breiten<br />
sich vor dem Betrachter aus, schwarze<br />
Ränder fassen die Flächen holzschnittartig<br />
ein: Es ist der deutsche<br />
Expressionismus, dem die Farben<br />
ihre Emanzipation von den Dingen<br />
<strong>und</strong> der Wirklichkeit verdanken, der<br />
sie in den Dienst des unmittelbaren<br />
subjektiven Ausdrucks von Emotionen,<br />
von Seelenwelten <strong>und</strong> Welterfahrung<br />
stellt. Von Ernst Ludwig<br />
Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff<br />
<strong>und</strong> Gabriele Münter bis hin zu Max<br />
Beckmann: Es ist genau auch der<br />
deutsche Expressionismus, dem die<br />
drei Brüder Franz, Frieder <strong>und</strong> Hubert<br />
ihre erste Begegnung mit Kunst<br />
verdanken. Die Sammlung der Eltern,<br />
beide erfolgreiche Verleger <strong>und</strong><br />
Medienunternehmer in Offenburg,<br />
lässt sie die unmittelbare Macht der<br />
Expressionismus.<br />
Das Museum<br />
Frieder Burda<br />
öffnet wieder mit<br />
Meisterwerken<br />
des Expressionismus<br />
aus den drei<br />
Sammlungen<br />
Frieder, Hubert<br />
<strong>und</strong> Franz Burda.<br />
Zu sehen ist<br />
auch das Gemälde<br />
„Nordsee III“ (1937)<br />
von Max Beckmann.<br />
Farben erleben – als ein Versprechen<br />
auf eine faszinierende Welt hinter<br />
<strong>und</strong> mit den Bildern. Und gleichzeitig<br />
bestärkt <strong>und</strong> befeuert die Sammlung<br />
die drei Brüder auch, sich vom<br />
elterlichen Erbe zu emanzipieren<br />
<strong>und</strong> ihren eigenen Weg in die Kunst<br />
ihrer Zeit zu finden.<br />
Sammlungstätigkeit. Die Ausstellung<br />
im Museum Frieder Burda<br />
spürt den Wurzeln der Sammlungstätigkeit<br />
der drei Brüder nach. Damit<br />
schlüsselt sie auch auf, was ein Leben<br />
mit <strong>und</strong> für die Kunst bedeuten<br />
kann. Sie wurde noch zu Lebzeiten<br />
von Frieder Burda geplant <strong>und</strong><br />
spiegelt seinen großen persönlichen<br />
Wunsch wider, die Kunst der drei<br />
Geschwister einmal in seinem Museum<br />
in einer gemeinsamen Ausstellung<br />
zu vereinen. Den Auftakt<br />
der Ausstellung bildet das bekannte<br />
Gruppenporträt „The Three Gentlemen“<br />
der drei Brüder Burda von<br />
Andy Warhol, der amerikanischen<br />
Pop Art-Legende, in seinen drei<br />
farblich unterschiedlichen Varian-<br />
ten, von denen jeder der Brüder eine<br />
erhielt.<br />
Inszenierung. Expressiv <strong>und</strong><br />
farbig ist auch die Inszenierung der<br />
Ausstellung, die die klassisch weiße<br />
Architektur des Gebäudes von<br />
Richard Meier der Macht der Farben<br />
überantwortet. Dazu wurde der<br />
amerikanische zeitgenössische Maler<br />
Carl Ostendarp (geboren 1961<br />
in Massachusetts) eingeladen. Seine<br />
Wandmalerei baut auf ein ausgeklügeltes<br />
Farbkodierungssystem.<br />
Gleichzeitig zitiert er einen flächigen<br />
Comic-Stil, der die Farbe voll<br />
zur Geltung kommen lässt, indem<br />
er sie wie eine delikate Glasur über<br />
die Wände laufen lässt. Die davor<br />
angebrachten Werke erscheinen als<br />
zentrale Etappen im Verlauf dieser<br />
imaginären Lebenslinien mit all ihren<br />
Höhen <strong>und</strong> Tiefen. Sie fügen<br />
sich ein in die spielerisch entstehenden<br />
Kurvungen <strong>und</strong> Amplituden <strong>und</strong><br />
werden so humorvoll in ihrer Wirkung<br />
bereichert <strong>und</strong> gesteigert. Das<br />
gesamte Museum verwandelt sich<br />
in einen für den Betrachter erlebbaren,<br />
umfassenden Farbkosmos. Ein<br />
eigener Raum wird den jungen Besuchern<br />
gewidmet sein: Die Kunstwerke<br />
werden auf deren Augenhöhe<br />
gehängt, wie es auch Andy Warhol<br />
für eine seiner Ausstellungen realisiert<br />
hat.<br />
Museum Frieder Burda/IZZ<br />
Info<br />
Die Bilder der Brüder<br />
Eine Sammlungsgeschichte<br />
der Familie Burda<br />
bis 4. Oktober <strong>2020</strong><br />
Museum Frieder Burda<br />
Lichtentaler Allee 8b<br />
76530 Baden-Baden<br />
Tel: 07221/39898-0<br />
www.museum-frieder-burda.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Di. bis So. 10-18 Uhr<br />
Mo. geschlossen<br />
an allen Feiertagen geöffnet<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
40<br />
Amtliche Mitteilungen<br />
Einladung zur Vertreterversammlung<br />
Die Vertreterversammlung der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg findet statt am<br />
Samstag, 25. Juli <strong>2020</strong>, 10.00<br />
Uhr bis 16.00 Uhr im Hotel Maritim<br />
in Stuttgart.<br />
Die Tagesordnung wird auf Anforderung<br />
übermittelt. Die Kammermitglieder<br />
werden hiermit<br />
zur Vertreterversammlung eingeladen.<br />
Im Falle einer Teilnahme<br />
wird eine vorherige Anmeldung<br />
bei der LZK-Geschäftsstelle<br />
aus organisatorischen Gründen<br />
(per Fax 07 11 / 2 28 45 40 oder<br />
E-Mail an falk@lzk-bw.de) erbeten.<br />
Für den Fall, dass die o. g. Vertreterversammlung<br />
beschlussunfähig<br />
ist, wird bereits heute zu<br />
einer zweiten Vertreterversammlung<br />
über dieselben Gegenstände<br />
eingeladen. Diese findet statt<br />
am Samstag, 25. Juli <strong>2020</strong>, 10.30<br />
bis 16.30 Uhr im Hotel Maritim<br />
in Stuttgart.<br />
Für den Fall, dass bis zum<br />
Termin der Vertreterversammlung<br />
die Durchführung der Vertreterversammlung<br />
in Präsenz<br />
aufgr<strong>und</strong> der Einschränkungen<br />
durch die Corona-Verordnung<br />
Baden-Württemberg rechtlich<br />
nicht zulässig sein sollte, wird<br />
die Vertreterversammlung als<br />
Videokonferenz abgehalten. Wir<br />
werden für diesen Fall rechtzeitig<br />
darüber informieren, wie die<br />
interne Öffentlichkeit trotzdem<br />
gewährleistet werden kann.<br />
Dr. Torsten Tomppert, Präsident<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung<br />
Baden-Württemberg<br />
Versorgungsanteilsabhängige Gründungsbefugnis von Krankenhäusern bezüglich<br />
Z-MVZ gemäß § 95 Abs. 1b SGB V<br />
Mit der Einführung des § 95<br />
Abs. 1b in das SGB V wurde<br />
eine spezielle Regelung zur<br />
Gründung zahnärztlicher MVZ<br />
– sogenannte Zahnarzt-MVZ<br />
(Z-MVZ) – durch Krankenhäuser<br />
geschaffen. Deren Gründungsbefugnis<br />
für Z-MVZ ist<br />
künftig von der Wahrung bestimmter<br />
Versorgungsanteile<br />
abhängig, die durch die von<br />
einem Krankenhaus gegründeten,<br />
beziehungsweise betriebenen<br />
Z-MVZ nur noch maximal<br />
erreicht werden dürfen. Diese<br />
Anteile richten sich prozentual<br />
gestaffelt nach dem Versorgungsgrad<br />
des jeweiligen Planungsbereiches:<br />
• In gr<strong>und</strong>sätzlich bedarfsgerecht<br />
versorgten Planungsbereichen<br />
(entspricht einem<br />
Versorgungsgrad von 50 % bis<br />
110 %) beträgt der zulässige<br />
Versorgungsanteil eines Krankenhauses<br />
beziehungsweise<br />
„seiner“ Z-MVZ in dem betreffenden<br />
Planungsbereich<br />
maximal 10 %, mindestens<br />
je<strong>doch</strong> fünf Z-MVZ-Sitze/<br />
Zahnarztstellen in Planungsbereichen<br />
mit einem Versorgungsgrad<br />
zwischen 50 % <strong>und</strong><br />
99,9 %.<br />
• In unterversorgten Planungsbereichen<br />
(entspricht einem<br />
Versorgungsgrad von unter<br />
50 %) erhöht sich der zulässige<br />
Versorgungsanteil auf maximal<br />
20 %.<br />
• In überversorgten Planungsbereichen<br />
(entspricht einem<br />
Versorgungsgrad ab 110 %)<br />
reduziert sich der zulässige<br />
Versorgungsanteil auf maximal<br />
5 %.<br />
Die Begrenzung auf bestimmte<br />
Versorgungsanteile gilt entsprechend<br />
auch für die Erweiterung<br />
bereits bestehender Z-MVZ, so<br />
dass auch hier der maximal zulässige<br />
Versorgungsanteil des<br />
betreffenden Krankenhauses<br />
nicht überschritten werden<br />
darf.<br />
Auf die MVZ-Gründungsbefugnis<br />
von Vertragszahnärztinnen <strong>und</strong><br />
Vertragszahnärzten bezieht sich<br />
die Neuregelung hingegen nicht.<br />
Gemäß § 95 Abs. 1b Sätze 5,6<br />
SGB V haben die Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigungen jährlich<br />
umfassende <strong>und</strong> vergleichbare<br />
Übersichten zum allgemeinen bedarfsgerechten<br />
Versorgungsgrad<br />
<strong>und</strong> zum Stand der vertragszahnärztlichen<br />
Versorgung zu erstellen<br />
<strong>und</strong> zu veröffentlichen.<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Amtliche Mitteilungen 41<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung<br />
Baden-Württemberg<br />
Übersicht nach § 95 Abs. 1b Satz 5 SGB V zum allgemeinen bedarfsgerechten<br />
Versorgungsgrad <strong>und</strong> zum Stand der vertragszahnärztlichen Versorgung<br />
Veröffentlichung der KZV Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2019 Bezirksdirektion Freiburg<br />
Stand Zahnärzte: 31.12.2019, Stand Einwohner: 30.06.2019 (Zahnärztliche Versorgung) / 31.12.2018 (Kieferorthopädische Versorgung)<br />
Zahnärztliche Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Stadtkreis Freiburg 179,9 106,6<br />
G<strong>und</strong>elfingen/Breisach 68,9 101,3<br />
Titisee-Neustadt 25,2 73,4<br />
Müllheim 62,6 103,5<br />
Emmendingen 74,1 106,3<br />
Waldkirch 24,5 95,9<br />
Lahr 68,6 105,7<br />
Wolfach 31,8 91,2<br />
Offenburg 58,9 94,2<br />
Achern 56,7 94,0<br />
Kehl 40,1 109,7<br />
Oberndorf/Schramberg 49,8 85,3<br />
Rottweil 33,4 102,7<br />
Donaueschingen 27,5 87,3<br />
Furtwangen 22,8 76,8<br />
Villingen-Schwenningen 76,3 109,4<br />
Spaichingen-Trossingen 37,9 73,9<br />
Tuttlingen 45,8 96,7<br />
Konstanz 57,9 137,3<br />
Radolfzell/Stockach 46,3 126,3<br />
Singen 66,0 130,3<br />
Lörrach 79,5 106,0<br />
Rheinfelden 29,9 155,5<br />
Schopfheim 26,8 81,3<br />
Bad Säckingen 44,4 112,2<br />
Waldshut-Tiengen 57,4 144,6<br />
Kieferorthopädische Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Stadtkreis Freiburg 9,1 263,7<br />
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 11,4 109,6<br />
Landkreis Emmendingen 7,1 260,6<br />
Landkreis Ortenaukreis 18,5 125,9<br />
Landkreis Rottweil 6,1 73,8<br />
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 8,8 136,4<br />
Landkreis Tuttlingen 6,5 100,0<br />
Landkreis Konstanz 11,7 209,4<br />
Landkreis Lörrach 10,1 138,6<br />
Landkreis Waldshut 7,6 131,6<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
42<br />
Amtliche Mitteilungen<br />
Veröffentlichung der KZV Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2019 Bezirksdirektion Karlsruhe<br />
Stand Zahnärzte: 31.12.2019, Stand Einwohner: 30.06.2019 (Zahnärztliche Versorgung) / 31.12.2018 (Kieferorthopädische Versorgung)<br />
Zahnärztliche Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Baden-Baden 32,8 138,7<br />
Heidelberg 125,0 104,2<br />
Karlsruhe 244,0 89,1<br />
Mannheim 241,5 97,7<br />
Pforzheim 98,3 88,3<br />
Stadt-Calw 14,0 107,1<br />
Stadt-Nagold 13,4 130,6<br />
Calw-Land 67,1 59,3<br />
Stadt Mühlacker 15,6 83,3<br />
Enzkreis-Land 103,0 64,6<br />
Stadt-Freudenstadt 14,0 100,0<br />
Stadt-Horb 14,9 70,5<br />
Freudenstadt-Land 41,4 65,2<br />
Stadt-Bretten 17,6 108,0<br />
Stadt-Bruchsal 26,6 120,3<br />
Stadt-Ettlingen 23,4 159,4<br />
Karlsruhe Land 197,4 77,4<br />
Stadt-Buchen 10,6 134,9<br />
Stadt-Mosbach 15,7 151,6<br />
NOK-Land 59,2 84,5<br />
Stadt-Bühl 17,2 119,2<br />
Stadt-Gaggenau 17,8 91,6<br />
Stadt-Rastatt 29,7 95,3<br />
Rastatt-Land 73,2 82,0<br />
Stadt-Leimen 16,1 108,7<br />
Stadt-Schwetzingen 12,8 136,7<br />
Stadt-Sinsheim 21,1 110,4<br />
Stadt-Weinheim 27,0 143,7<br />
Stadt-Wiesloch 16,0 153,1<br />
RNK-Land 233,4 98,5<br />
Kieferorthopädische Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Baden-Baden 2,0 265,0<br />
Heidelberg 5,6 196,4<br />
Karlsruhe 11,2 205,4<br />
Mannheim 11,9 170,6<br />
Pforzheim 5,6 205,4<br />
Calw 6,8 73,5<br />
Enzkreis 8,5 64,7<br />
Freudenstadt 5,1 107,8<br />
Karlsruhe 18,5 86,5<br />
Neckar-Odenwald-Kreis 5,9 84,7<br />
Rastatt 9,5 94,7<br />
Rhein-Neckar-Kreis 23,1 140,7<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Amtliche Mitteilungen 43<br />
Veröffentlichung der KZV Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2019 Bezirksdirektion Stuttgart<br />
Stand Zahnärzte: 31.12.2019, Stand Einwohner: 30.06.2019 (Zahnärztliche Versorgung) / 31.12.2018 (Kieferorthopädische Versorgung)<br />
Zahnärztliche Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Stuttgart-Mitte 149,5 154,7<br />
S-Feuerbach/S-Zuffenhausen 109,9 78,3<br />
S-Bad Cannstatt 105,7 73,3<br />
S-Vaihingen/S-Degerloch 114,8 93,9<br />
Böblingen/Sindelfingen 134,3 114,9<br />
Herrenberg 36,9 99,5<br />
Leonberg 62,6 91,1<br />
Esslingen 93,0 114,0<br />
Plochingen 56,7 82,9<br />
Kirchheim/Teck 49,9 114,2<br />
Nürtingen 67,3 97,3<br />
Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen 51,2 110,9<br />
Göppingen 82,9 97,9<br />
Geislingen 35,2 71,9<br />
Eislingen/Donzdorf/Süssen 35,3 128,9<br />
Ludwigsburg 177,3 111,4<br />
Bietigheim-Bissingen 76,5 89,9<br />
Marbach 70,7 70,4<br />
Waiblingen 125,1 106,2<br />
Backnang 62,2 80,4<br />
Schorndorf 66,6 102,1<br />
Heilbronn 98,6 102,4<br />
Brackenheim/Eppingen 66,8 85,3<br />
Neckarsulm 86,4 82,5<br />
Weinsberg 51,6 88,8<br />
Künzelsau 32,5 69,8<br />
Öhringen 34,4 101,2<br />
Schwäbisch Hall 64,9 90,6<br />
Crailsheim 52,1 89,8<br />
Tauberbischofsheim 25,8 100,8<br />
Bad Mergentheim 34,2 84,8<br />
Wertheim 18,9 136,5<br />
Heidenheim 52,1 99,2<br />
Giengen 27,0 87,0<br />
Aalen 77,9 93,1<br />
Ellwangen 29,4 81,6<br />
Schwäbisch Gmünd 79,7 110,4<br />
Kieferorthopädische Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Stadtkreis Stuttgart 24,4 176,2<br />
Landkreis Böblingen 17,5 154,3<br />
Landkreis Esslingen 22,5 128,0<br />
Landkreis Göppingen 10,9 137,6<br />
Landkreis Ludwigsburg 24,0 153,3<br />
Landkreis Rems-Murr 18,2 147,3<br />
Stadtkreis Heilbronn 5,5 232,7<br />
Landkreis Heilbronn 15,0 130,0<br />
Landkreis Hohenlohe 4,8 72,9<br />
Landkreis Schwäbisch Hall 8,7 92,0<br />
Landkreis Main-Tauber 5,4 175,9<br />
Landkreis Heidenheim 5,7 87,7<br />
Landkreis Ostalb 13,5 114,8<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
44<br />
Amtliche Mitteilungen<br />
Veröffentlichung der KZV Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2019 Bezirksdirektion Tübingen<br />
Stand Zahnärzte: 31.12.2019, Stand Einwohner: 30.06.2019 (Zahnärztliche Versorgung) / 31.12.2018 (Kieferorthopädische Versorgung)<br />
Zahnärztliche Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Reutlingen 108,4 109,3<br />
Metzingen/Münsingen 62,2 98,1<br />
Tübingen 102,8 102,4<br />
Rottenburg 32,6 85,9<br />
Albstadt 42,8 101,6<br />
Balingen 33,9 91,4<br />
Hechingen 35,9 85,0<br />
Stadtkreis Ulm 98,8 119,9<br />
Alb-Donau-Nord 60,6 86,6<br />
Alb-Donau-Süd 56,5 85,0<br />
Biberach/Laupheim 96,1 81,7<br />
Riedlingen 23,3 82,8<br />
Friedrichshafen 90,7 127,3<br />
Überlingen 38,8 103,9<br />
Ravensburg/Weingarten/Bad Waldsee 100,1 122,4<br />
Wangen/Leutkirch 62,9 94,6<br />
Sigmaringen/Pfullendorf 60,6 85,0<br />
Bad Saulgau 24,2 98,3<br />
Kieferorthopädische Versorgung<br />
1 2 3<br />
Planungsbereich allg. bedarfsgerechter Versorgungsgrad Stand der vertragszahnärztl. Versorgung<br />
Kreis Reutlingen 12,4 145,2<br />
Kreis Tübingen 9,6 197,9<br />
Zollernalbkreis 7,7 90,9<br />
Stadtkreis Ulm 5,1 162,7<br />
Alb-Donau-Kreis 8,9 73,0<br />
Kreis Biberach 9,3 129,0<br />
Bodenseekreis 9,0 186,7<br />
Kreis Ravensburg 12,5 136,0<br />
Kreis Sigmaringen 5,7 166,7<br />
Anzeige<br />
Werden auch Sie zum Helfer.<br />
Bitte den Coupon ausfüllen, ausschneiden <strong>und</strong> senden<br />
an: German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn<br />
Coupon:<br />
Bitte senden Sie mir unverbindlich<br />
Informationen<br />
über German Doctors e.V.<br />
über eine Projektpatenschaft<br />
Name, Vorname<br />
Straße, Hausnummer<br />
PLZ, Ort<br />
E-Mail<br />
✁<br />
„Es ist schön zu erfahren, dass man<br />
den Menschen als Arzt direkt <strong>und</strong><br />
effektiv helfen kann.“<br />
Oliver Ostermeyer<br />
German Doctors e.V.<br />
info@german-doctors.de<br />
Tel.: +49 (0)228 387597-0<br />
Fax: +49 (0)228 387597-20<br />
Spendenkonto<br />
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80<br />
BIC GENODEF1EK1<br />
www.german-doctors.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Personalia 45<br />
LZK-Direktor Axel Maag feiert seinen 60. Geburtstag<br />
Ein umtriebiger Mensch <strong>und</strong><br />
geselliger Unterhalter<br />
Axel Maag ist nicht Trainer einer Fußballweltmeister-Mannschaft wie<br />
Jogi Löw, kann nicht so gut singen wie Nena <strong>und</strong> ist nicht so<br />
diplomatisch wie Sigmar Gabriel. Eine Gemeinsamkeit haben alle<br />
drei dennoch: Sie wurden 1960 geboren. Ein Jahr, in dem<br />
John F. Kennedy Präsident der USA wird, Europa durch Zollsenkung<br />
innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft enger<br />
zusammenwächst <strong>und</strong> Kurt Georg Kiesinger als Ministerpräsident in<br />
Baden-Württemberg wiedergewählt wird.<br />
Axel Maag wurde in Ulm geboren<br />
<strong>und</strong> studierte Rechtswissenschaft<br />
in Tübingen. Nach dem zweiten<br />
Staatsexamen im Jahr 1991 arbeitete<br />
er kurze Zeit bei einer Versicherung<br />
bevor er am 1. Oktober<br />
1992 in die Dienste der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-<br />
Württemberg trat. Im März<br />
dieses Jahres feierte Axel<br />
Maag seinen 60. Geburtstag.<br />
Nun ist 60 heute kein Alter<br />
für einen mitten im aktiven<br />
Leben stehenden Mann,<br />
<strong>und</strong> besonders nicht für Axel<br />
Maag.<br />
Aktiv – eine bessere Bezeichnung<br />
für Axel Maags<br />
umtriebigen Lebensstil existiert<br />
wohl nicht. Ob zu Hause,<br />
ob am Arbeitsplatz oder im<br />
Urlaub – immer geht es r<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> zwar immer nicht schnell<br />
genug. An den zahlreichen<br />
Mahlzeiten, die wir gemeinsam<br />
eingenommen haben,<br />
war es fast so, als ginge es um<br />
ein Wettessen, Axel war als Erster<br />
fertig – <strong>und</strong> zwar immer.<br />
Selbst zu Hause ist häufig Aktivität<br />
angesagt, beispielsweise<br />
das weniger beliebte Rasenmähen<br />
oder Autowaschen. Mehr Freude<br />
bereitet die Zubereitung eines<br />
mehrgängigen Menüs. Mit feinem<br />
Geschmack für lukullische Speisen<br />
<strong>und</strong> einer vorbildlichen Ordnung<br />
in der Küche kreiert er gerne ein<br />
vorzügliches Gericht.<br />
Ordnung ist Prinzip <strong>und</strong> gilt nicht<br />
nur in der Küche. Auch an seinem<br />
Arbeitsplatz. Trotz fortgeschrittener<br />
Digitalisierung erreicht Papier<br />
noch stapelweise den Schreibtisch<br />
des Direktors der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg.<br />
Dennoch vermittelt das gesamte<br />
Büro jederzeit den Eindruck von<br />
strukturierter Ordnung als wäre es<br />
ein Demons trationsraum für Ergonomie.<br />
Der Eindruck täuscht über<br />
die Menge an Arbeit, die der Jurist<br />
Axel Maag hier zügig leistet,<br />
geflissentlich hinweg. Schriftliche<br />
Vorgänge werden möglichst unverzüglich<br />
erledigt <strong>und</strong> nur ungern,<br />
wenn es sich gar nicht vermeiden<br />
lässt, auf Wiedervorlage gesetzt.<br />
Entscheidungen trifft Axel Maag<br />
am liebsten gleich, wenn sie anstehen,<br />
denn deren Vertagung ist ihm<br />
ein Graus. Beim Telefonieren gilt<br />
für ihn der alte Spruch: Fasse Dich<br />
kurz.<br />
Die in seinem Arbeitsleben stets<br />
gegenwärtige Effizienz sollte nicht<br />
darüber hinwegtäuschen, dass Axel<br />
Maag ein geselliger Mensch <strong>und</strong><br />
charmanter Unterhalter ist. Nach<br />
erledigter Arbeit plaudert er gerne<br />
in gemütlicher R<strong>und</strong>e mit seinen<br />
Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Kollegen.<br />
Dann ist da noch der Sport, für<br />
den leider zu wenig Zeit bleibt.<br />
Außer im Urlaub. Ein paar Tage<br />
Golf-Urlaub mit Fre<strong>und</strong>en waren<br />
vor der Pandemie fest in seinem<br />
Jahresprogramm eingeplant. Über<br />
Skipisten aller Farben rauscht<br />
er, bei jeder Gelegenheit die<br />
sich bietet, wie der Norweger<br />
Aleksander Aamodt Kilde,<br />
norwegischer Skiläufer <strong>und</strong><br />
Gewinner des Gesamtweltcups.<br />
Gelegentlich trainiert er<br />
im Fitnessstudio, um seinen<br />
sportlichen Körper in definierter<br />
Form zu halten, ohne<br />
den übertriebenen Ehrgeiz,<br />
die Figur von Ivan Leonel,<br />
dem Natural Bodybuilder <strong>und</strong><br />
Deutschen Meister Men`s<br />
Physique erreichen zu wollen.<br />
Und Yoga. Yoga war ein<br />
Versuch wert, wurde aber<br />
nicht weiterverfolgt, was seine<br />
Frau Karin sehr bedauert.<br />
Sie hatte sich erhofft, dass<br />
Axel mit Yoga einen Gang<br />
herunterschaltet.<br />
Bis zum Eintritt ins numerische<br />
Rentenalter bleiben Axel Maag<br />
noch einige Jahre. Bis dahin <strong>und</strong><br />
darüber hinaus wird er noch einiges<br />
bewegen. Dazu wünsche ich<br />
ihm alles Gute <strong>und</strong> viel Kraft, aber<br />
auch reichlich Freude am Leben –<br />
<strong>und</strong> ein bisschen Gelassenheit. Ad<br />
multos annos.<br />
Foto: A. Mader<br />
Dr. Udo Lenke,<br />
Ehrenpräsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
50<br />
Namen <strong>und</strong> Nachrichten<br />
Cyberwehr Baden-Württemberg<br />
Unterstützung für Praxen<br />
bei IT-Sicherheitsangriffen<br />
In der Corona-Krise wächst die Gefahr<br />
von Cyber-Angriffen auf Arztpraxen,<br />
Krankenhäuser <strong>und</strong> andere<br />
Einrichtungen der medizinischen<br />
Versorgung. Die Cyberwehr des Landes<br />
Baden-Württemberg weitet nun<br />
ihr Angebot aus <strong>und</strong> bietet kostenlos<br />
Unterstützung bei IT-Sicherheitsvorfällen.<br />
Die Hotline der Cyberwehr<br />
Baden-Württemberg bietet Ges<strong>und</strong>heitsunternehmen<br />
nun landesweit<br />
Hilfe bei IT-Sicherheitsangriffen.<br />
Wer einen IT-Sicherheitsvorfall feststellt<br />
oder ungewöhnliche Aktivitäten<br />
auf den Servern beobachtet, kann<br />
sich jetzt r<strong>und</strong> um die Uhr an die<br />
kostenlose Hotline unter der Telefonnummer<br />
0800-29237947 wenden.<br />
Die Vorfälle werden aufgenommen<br />
<strong>und</strong> von einem IT-Sicherheitsexperten<br />
analysiert. Auf dieser Basis<br />
werden mögliche sinnvolle Schritte<br />
für das weitere Vorgehen geklärt.<br />
Die Gespräche werden dabei selbstverständlich<br />
vertraulich behandelt.<br />
Informationen werden nicht an Dritte<br />
weitergegeben, können aber auf<br />
eigenen Wunsch hin mit den Ermittlungsbehörden<br />
geteilt werden.<br />
Ursprünglich war ein stufenweiser<br />
Ausbau des Angebots der Cyberwehr<br />
für <strong>2020</strong> geplant. Mit der kurzfristigen<br />
Erweiterung des Aktionsradius,<br />
die zunächst für drei Monate gilt,<br />
reagiert das Konsortium des Forschungsprojekts<br />
auf das gestiegene<br />
Gefahrenpotenzial durch Angriffe<br />
auf die IT-Infrastruktur im Ges<strong>und</strong>heitswesen.<br />
Das Gefahrenpotenzial<br />
hat sich in der Corona-Krise unter<br />
anderem durch den veränderten Arbeitsalltag<br />
erhöht: Kommunikation<br />
findet vermehrt auf digitalen Wegen<br />
statt. Cyberkriminelle nutzen diese<br />
Situation aus, um sensible Daten<br />
abzugreifen <strong>und</strong> Schadsoftware wie<br />
etwa Verschlüsselungstrojaner zu installieren.<br />
Erst nach einer Lösegeldzahlung<br />
werden die Systeme eventuell<br />
wieder freigegeben.<br />
Die Cyberwehr Baden-Württemberg<br />
ist ein b<strong>und</strong>esweit einmaliges<br />
Pilotprojekt. Das Ministerium für<br />
Inneres, Digitalisierung <strong>und</strong> Migration<br />
Baden-Württemberg fördert das<br />
Projekt als Teil der Digitalisierungsstrategie.<br />
<br />
digital@bw<br />
COVID-19-Pandemie<br />
Universität Tübingen<br />
startet Vorlesungsreihen<br />
Die Universität Tübingen wird im<br />
aktuellen Sommersemester mehrere<br />
Vorlesungsreihen zur COVID-<br />
19-Pandemie anbieten, die sich an<br />
Studierende, aber auch an alle interessierten<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
richten. Veranstaltet werden die Vorlesungsreihen<br />
von der Medizinischen<br />
Fakultät, der Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftlichen<br />
Fakultät sowie<br />
vom Seminar für Allgemeine<br />
Rhetorik. „Wir sehen ein enormes<br />
Interesse in der breiten Öffentlichkeit<br />
an verlässlichen Informationen<br />
über die Besonderheiten des neuartigen<br />
Coronavirus, Krankheitsbilder,<br />
Therapiemöglichkeiten sowie die<br />
möglichen Folgen der Pandemie“,<br />
sagte der Studiendekan der Medizinischen<br />
Fakultät, Professor Stephan<br />
Zipfel. Themen der von der Medizinischen<br />
Fakultät veranstalteten<br />
Reihe sind unter anderem mögliche<br />
Medikamententherapien gegen CO-<br />
VID-19, Impfstoffentwicklung, psychische<br />
Folgen einer Infektion sowie<br />
ethische Fragen. Die Vorlesungen<br />
werden live über die Webseite der<br />
Sectio Chirurgica ausgestrahlt <strong>und</strong><br />
können auch von Personen, die nicht<br />
Studierende oder Beschäftigte der<br />
Universität sind, ohne Login mitverfolgt<br />
werden. Alle diejenigen, die<br />
die Live-Ausstrahlung über die Webseite<br />
der Sectio Chirurgica verpasst<br />
haben, können sich die Vorlesungen<br />
zeitversetzt auf dem Youtube-Kanal<br />
der Universität ansehen. Dort wurde<br />
für die Vorlesungsreihe eine eigene<br />
Playlist eingerichtet. Eine zweite<br />
Vorlesungsreihe zu den politischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Folgen<br />
der Corona-Pandemie bereitet derzeit<br />
die Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftliche<br />
Fakultät der Universität<br />
Tübingen vor.<br />
Weitere Informationen über die<br />
Vorlesungsreihe der Medizinischen<br />
Fakultät unter https://www.sectiochirurgica.de/<br />
<strong>und</strong> über die Vorlesungsreihe<br />
der Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftlichen<br />
Fakultät unter<br />
https://uni-tuebingen.de/de/177084.<br />
Den Youtube-Kanal der Universität<br />
finden Sie unter https://www.youtu-<br />
be.com/channel/UCfqmh9cUkSo-<br />
-IVhnO7Lo2A. Uni Tübingen<br />
Zitat<br />
Jetzt verlangt uns die<br />
Coronakrise gerade<br />
alles ab <strong>und</strong> sie erschüttert<br />
Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Gesellschaft weltweit.<br />
Aber der Klimawandel<br />
beschäftigt mich weiterhin<br />
sehr, auch wenn er<br />
gerade nicht die Schlagzeilen<br />
beherrscht. Wenn<br />
wir den nicht gebremst<br />
kriegen, wird er die<br />
Coronakrise in den Auswirkungen<br />
noch in den<br />
Schatten stellen. Vor<br />
dem Klimawandel hab‘<br />
ich weit mehr Respekt<br />
als vor der Coronakrise.<br />
Der Klimawandel kann<br />
die ganze Welt nachhaltig<br />
erschüttern <strong>und</strong> ihn<br />
können wir nicht irgendwann<br />
einfach wegimpfen.<br />
Ministerpräsident Winfried<br />
Kretschmann im Gespräch mit der<br />
Deutschen Presse-Agentur (dpa)<br />
Foto: Staatsministerium<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong><br />
www.zahnaerzteblatt.de
Zu guter Letzt 51<br />
Karikatur: Grolik<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Dr. Torsten Tomppert, Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg (LZK BW), <strong>und</strong><br />
Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstands der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-<br />
Württemberg (KZV BW),<br />
für das Informationszentrum Zahnges<strong>und</strong>heit Baden-<br />
Württemberg – eine Einrichtung der LZK BW <strong>und</strong><br />
KZV BW.<br />
Redaktion:<br />
Cornelia Schwarz (Cos) (ChR, verantw.)<br />
E-Mail: cornelia.schwarz@izz-online.de<br />
Telefon: 0711/222 966-10<br />
Gabriele Billischek (Bi),<br />
E-Mail: gabi.billischek@izz-online.de<br />
Andrea Mader (am),<br />
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg<br />
Telefon: 0711/228 45-29<br />
E-Mail: mader@lzk-bw.de<br />
Guido Reiter (gr),<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-<br />
Württemberg<br />
Telefon: 0711/78 77-220<br />
E-Mail: guido.reiter@kzvbw.de<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Informationszentrum Zahnges<strong>und</strong>heit<br />
Baden-Württemberg<br />
Königstraße 26, 70173 Stuttgart<br />
Telefon: 0711/222 966-14<br />
Telefax: 0711/222 966-21<br />
E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de<br />
Redaktionsassistenz: Gabriele Billischek<br />
Layout: Gabriele Billischek, Armin Fischer<br />
Autoren dieser Ausgabe: Thorsten Beck, Dr. Udo Lenke,<br />
Andrea Mader, Claudia Richter, Dr. Sandra Riemekasten,<br />
Sabine Rücker, Cornelia Schwarz, Benedikt Schweizer,<br />
Dr. Holger Simon-Denoix, Dr. Torsten Tomppert<br />
Titelseite: Abbildung: AdobeStock/beeboys;<br />
IZZ/Armin Fischer<br />
Verantwortlich für Amtliche Mitteilungen der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung<br />
Baden-Württemberg (KZV BW):<br />
Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstands der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg<br />
(KZV BW), KdöR<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart<br />
Verantwortlich für Amtliche Mitteilungen der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg<br />
(LZK BW):<br />
Dr. Torsten Tomppert, Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg (LZK BW), KdöR<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart<br />
Hinweise: Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe<br />
gekürzt zu veröffentlichen. Ein Anspruch auf<br />
Veröffentlichung besteht nicht. Bei Einsendungen an<br />
die Redaktion wird der vollen oder auszugsweisen<br />
Veröffentlichung zugestimmt.Unaufgefordert eingegangene<br />
Fortbildungsmanuskripte können nicht veröffentlicht<br />
werden, da die Redaktion nur mit wissenschaftlichen<br />
Autoren vereinbarte Fort bildungsbeiträge veröffentlicht.<br />
Alle Rechte an dem Druckerzeugnis, insbesondere<br />
Titel-, Namens- <strong>und</strong> Nutzungsrechte etc., stehen<br />
ausschließlich den Heraus gebern zu. Mit Annahme des<br />
Manuskripts zur Publikation erwerben die Herausgeber<br />
das aus schließliche Nutzungsrecht, das die Erstellung<br />
von Fort- <strong>und</strong> Sonderdrucken, auch für Auftraggeber<br />
aus der Industrie, das Einstellen des ZBW ins Internet,<br />
die Übersetzung in andere Sprachen, die Erteilung von<br />
Abdruckgenehmigungen für Teile, Abbildungen oder<br />
die gesamte Arbeit an andere Verlage sowie Nachdrucke<br />
in Medien der Herausgeber, die fotomechanische<br />
sowie elektronische Vervielfältigung <strong>und</strong> die Wiederverwendung<br />
von Abbildungen umfasst. Dabei ist die<br />
Quelle anzugeben. Änderungen <strong>und</strong> Hinzufügungen zu<br />
Originalpublikationen bedürfen der Zustimmung des<br />
Autors <strong>und</strong> der Herausgeber.<br />
Bezugspreis:<br />
Jahresabonnement inkl. MwSt. € 90,-<br />
Einzelverkaufspreis inkl. MwSt. € 7,50<br />
Bestellungen werden vom Verlag entgegengenommen.<br />
Die Kündigungsfrist für Abonnements beträgt<br />
6 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes.<br />
Für die Mitglieder der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg ist der Bezugspreis mit dem<br />
Mitgliedsbeitrag abgegolten.<br />
Verlag:<br />
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH<br />
Geschäftsführung: Johannes Werle, Patrick Ludwig,<br />
Hans Peter Bork, Matthias Körner<br />
Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf<br />
Sebastian Hofer, Leiter Corporate Publishing<br />
Petra Forscheln, Produktmanagerin Corporate Publishing<br />
Tel. 0211 505-2911, Fax 0211 505-1002911<br />
petra.forscheln@rheinische-post.de, www.rp-media.de<br />
Druck:<br />
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien<br />
Marktweg 42-50, 47608 Geldern<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>
FONDATION BEYELER<br />
26. 1. – 17. 5. <strong>2020</strong><br />
RIEHEN / BASEL<br />
Edward Hopper, Cape Cod Morning, 1950 (Detail), Oil on canvas, 86,7 × 102,3 cm, Smithsonian American Art Museum, Gift of the Sara Roby Fo<strong>und</strong>ation, © Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zurich, Photo: Smithsonian American Art Museum, Gene Young