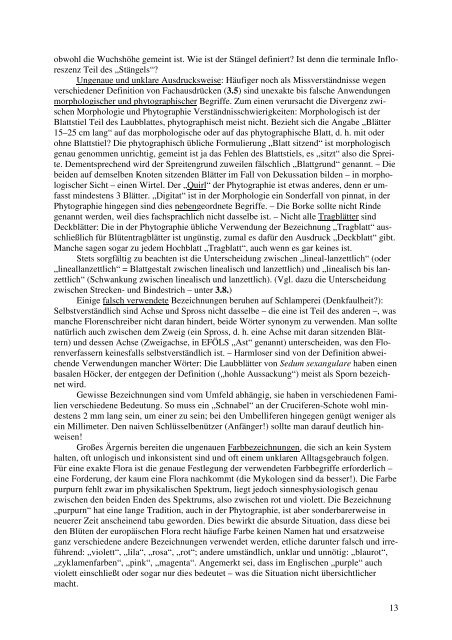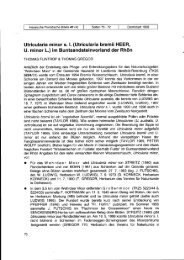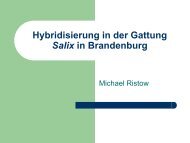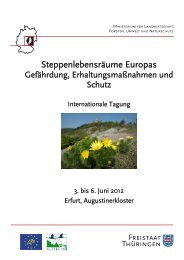Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
obwohl die Wuchshöhe gemeint ist. Wie ist <strong>der</strong> Stängel definiert? Ist denn die terminale Infloreszenz<br />
Teil des „Stängels“?<br />
Ungenaue und unklare Ausdrucksweise: Häufiger noch als Missverständnisse wegen<br />
verschiedener Definition <strong>von</strong> Fachausdrücken (3.5) sind unexakte bis falsche Anwendungen<br />
morphologischer und phytographischer Begriffe. Zum einen verursacht die Divergenz zwischen<br />
Morphologie und Phytographie Verständnisschwierigkeiten: Morphologisch ist <strong>der</strong><br />
Blattstiel Teil des Laubblattes, phytographisch meist nicht. Bezieht sich die Angabe „Blätter<br />
15–25 cm lang“ auf das morphologische o<strong>der</strong> auf das phytographische Blatt, d. h. mit o<strong>der</strong><br />
ohne Blattstiel? Die phytographisch übliche Formulierung „Blatt sitzend“ ist morphologisch<br />
genau genommen unrichtig, gemeint ist ja das Fehlen des Blattstiels, es „sitzt“ also die Spreite.<br />
Dementsprechend wird <strong>der</strong> Spreitengrund zuweilen fälschlich „Blattgrund“ genannt. – Die<br />
beiden auf demselben Knoten sitzenden Blätter im Fall <strong>von</strong> Dekussation bilden – in morphologischer<br />
Sicht – einen Wirtel. Der „Quirl“ <strong>der</strong> Phytographie ist etwas an<strong>der</strong>es, denn er umfasst<br />
mindestens 3 Blätter. „Digitat“ ist in <strong>der</strong> Morphologie ein Son<strong>der</strong>fall <strong>von</strong> pinnat, in <strong>der</strong><br />
Phytographie hingegen sind dies nebengeordnete Begriffe. – Die Borke sollte nicht Rinde<br />
genannt werden, weil dies fachsprachlich nicht dasselbe ist. – Nicht alle Tragblätter sind<br />
Deckblätter: Die in <strong>der</strong> Phytographie übliche Verwendung <strong>der</strong> Bezeichnung „Tragblatt“ ausschließlich<br />
für Blütentragblätter ist ungünstig, zumal es dafür den Ausdruck „Deckblatt“ gibt.<br />
Manche sagen sogar zu jedem Hochblatt „Tragblatt“, auch wenn es gar keines ist.<br />
Stets sorgfältig zu beachten ist die Unterscheidung zwischen „lineal-lanzettlich“ (o<strong>der</strong><br />
„lineallanzettlich“ = Blattgestalt zwischen linealisch und lanzettlich) und „linealisch bis lanzettlich“<br />
(Schwankung zwischen linealisch und lanzettlich). (Vgl. dazu die Unterscheidung<br />
zwischen Strecken- und Bindestrich – unter 3.8.)<br />
Einige falsch verwendete Bezeichnungen beruhen auf Schlamperei (Denkfaulheit?):<br />
Selbstverständlich sind Achse und Spross nicht dasselbe – die eine ist Teil des an<strong>der</strong>en –, was<br />
manche Florenschreiber nicht daran hin<strong>der</strong>t, beide Wörter synonym zu verwenden. Man sollte<br />
natürlich auch zwischen dem Zweig (ein Spross, d. h. eine Achse mit daran sitzenden Blättern)<br />
und dessen Achse (Zweigachse, in EFÖLS „Ast“ genannt) unterscheiden, was den Florenverfassern<br />
keinesfalls selbstverständlich ist. – Harmloser sind <strong>von</strong> <strong>der</strong> Definition abweichende<br />
Verwendungen mancher Wörter: Die Laubblätter <strong>von</strong> Sedum sexangulare haben einen<br />
basalen Höcker, <strong>der</strong> entgegen <strong>der</strong> Definition („hohle Aussackung“) meist als Sporn bezeichnet<br />
wird.<br />
Gewisse Bezeichnungen sind vom Umfeld abhängig, sie haben in verschiedenen Familien<br />
verschiedene Bedeutung. So muss ein „Schnabel“ an <strong>der</strong> Cruciferen-Schote wohl mindestens<br />
2 mm lang sein, um einer zu sein; bei den Umbelliferen hingegen genügt weniger als<br />
ein Millimeter. Den naiven Schlüsselbenützer (Anfänger!) sollte man darauf deutlich hinweisen!<br />
Großes Ärgernis bereiten die ungenauen Farbbezeichnungen, die sich an kein System<br />
halten, oft unlogisch und inkonsistent sind und oft einem unklaren Alltagsgebrauch folgen.<br />
Für eine exakte <strong>Flora</strong> ist die genaue Festlegung <strong>der</strong> verwendeten Farbbegriffe erfor<strong>der</strong>lich –<br />
eine For<strong>der</strong>ung, <strong>der</strong> kaum eine <strong>Flora</strong> nachkommt (die Mykologen sind da besser!). Die Farbe<br />
purpurn fehlt zwar im physikalischen Spektrum, liegt jedoch sinnesphysiologisch genau<br />
zwischen den beiden Enden des Spektrums, also zwischen rot und violett. Die Bezeichnung<br />
„purpurn“ hat eine lange Tradition, auch in <strong>der</strong> Phytographie, ist aber son<strong>der</strong>barerweise in<br />
neuerer Zeit anscheinend tabu geworden. Dies bewirkt die absurde Situation, dass diese bei<br />
den Blüten <strong>der</strong> europäischen <strong>Flora</strong> recht häufige Farbe keinen Namen hat und ersatzweise<br />
ganz verschiedene an<strong>der</strong>e Bezeichnungen verwendet werden, etliche darunter falsch und irreführend:<br />
„violett“, „lila“, „rosa“, „rot“; an<strong>der</strong>e umständlich, unklar und unnötig: „blaurot“,<br />
„zyklamenfarben“, „pink“, „magenta“. Angemerkt sei, dass im Englischen „purple“ auch<br />
violett einschließt o<strong>der</strong> sogar nur dies bedeutet – was die Situation nicht übersichtlicher<br />
macht.<br />
13