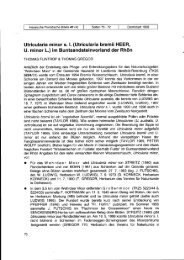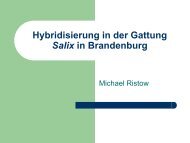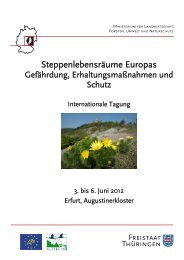Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Buch etwas an<strong>der</strong>es, und es gibt nicht wenige Pflanzenfreunde und Botaniker, in <strong>der</strong>en Bibliothek<br />
sich mehr als ein einziges Buch befinden.<br />
In <strong>der</strong> Kürze liegt keineswegs stets Würze, diese For<strong>der</strong>ung ist im Gegenteil oft kontraproduktiv.<br />
Obwohl sie vor<strong>der</strong>gründig sowohl den Verfassern wie den Benützern entgegenkommt,<br />
ist Knappheit <strong>der</strong> Schlüssel und Beschreibungen eine Hauptquelle für Bestimmungsprobleme<br />
und -fehler. – „Pars pro toto“ ist in Alltag und Literatur ein beliebtes und meist<br />
sinnvolles Stilmittel; dass in einem Bestimmungsschlüssel jedoch Genauigkeit Vorrang haben<br />
muss, berücksichtigen nicht alle Floren, denn so manche schreiben, beson<strong>der</strong>s bei Farbangaben<br />
„Blüte“, wenn sie die Krone meinen (weil sie nicht wissen, dass auch Kelch, Andrözeum<br />
und Gynözeum Teile <strong>der</strong> Blüte sind?); „Wurzel“, obwohl sie das Rhizom meinen; „Blatt“,<br />
wobei sie sich nur auf die Spreite beziehen usw.<br />
Die Übernahme <strong>von</strong> Daten aus älteren Florenwerken bewirkt <strong>zur</strong> Illustration eines<br />
Merkmals nicht selten Vergleiche mit Gegenständen, die vor zweihun<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> hun<strong>der</strong>t o<strong>der</strong><br />
auch nur fünfzig Jahren zum Alltag gehörten, damals daher je<strong>der</strong>mann und je<strong>der</strong>frau vertraut<br />
waren, heute aber nur ethnographisch Gebildeten verständlich sind: „kreiselförmig“, „Spitalgeruch“,<br />
„Karbolgeruch“ usw. – Ähnliche Gründe hat wohl die Verwendung <strong>von</strong> Gegenständen<br />
<strong>zur</strong> Größenangabe anstelle <strong>der</strong> Verwendung des metrischen Systems: „erbsengroß“,<br />
„haselnussgroß“, „kirschgroß“. Verwun<strong>der</strong>lich auch deshalb, weil man <strong>von</strong> Botanikern<br />
annehmen müsste, dass sie wissen, wie sehr die Größe etwa einer Kirsche <strong>von</strong> <strong>der</strong> Sorte<br />
abhängt.<br />
Ein wichtiges, aber oft vernachlässigtes Thema betrifft die Rolle <strong>der</strong> Abbildungen und<br />
<strong>der</strong>en Verhältnis zum Text. Einer oberflächlichen, aber populären Meinung zufolge sagt „ein<br />
Bild mehr als tausend Worte“. Genauer besehen, ist das allerdings nicht richtig, vielmehr gilt<br />
eher das Gegenteil: Eine gute verbale Beschreibung kann nicht nur kürzer, son<strong>der</strong>n auch<br />
exakter sein; insbeson<strong>der</strong>e lässt sich die Variationsbreite viel einfacher durch Worte beschreiben.<br />
Die Abstimmung <strong>von</strong> Text und Abbildung erfor<strong>der</strong>t große Sorgfalt. Nicht selten findet<br />
man offenkundige Wi<strong>der</strong>sprüche zwischen Text und Zeichnung, die vor allem deshalb misslich<br />
sind, weil die Leser und Leserinnen im Allgemeinen dazu neigen, dem Bild mehr Glauben<br />
zu schenken, tatsächlich aber meist die verbale Darstellung richtiger und genauer ist.<br />
Eine nützliche Hilfe für rückläufiges Bestimmen (ausgehend <strong>von</strong> einem vermuteten<br />
Ergebnistaxon werden dessen Merkmale überprüft) sind Herkunftsnummern („Rückläufigkeitszahlen“)<br />
unmittelbar nach <strong>der</strong> Punktnummer; sie wird in vielen, aber lei<strong>der</strong> keineswegs<br />
allen Schlüsseln angegeben. Wichtig ist dies vor allem bei Mehrfachschlüsselung!<br />
Es mag überraschen, beim Thema Benützerfreundlichkeit auf die Nomenklaturregeln zu<br />
sprechen zu kommen. Ein leserfreundlicher Text muss gezielt mögliche Missverständnisse<br />
vermeiden. Wenn <strong>der</strong> Leserkreis – wie bei einer guten <strong>Flora</strong> – weit gespannt ist, <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
SchülerIn und <strong>der</strong> StudentIn über die AmateurIn bis <strong>zur</strong> ZoologIn und NichtbiologIn reicht,<br />
ist zu bedenken, dass botanische Fachspezifika, <strong>der</strong>en Bedeutung dem Fachbotaniker und <strong>der</strong><br />
Fachbotanikerin geläufig sind, bei den übrigen Benützern Missverständnisse verursachen.<br />
Dies gilt z. B. für die nomenklatorischen Autorbezeichnungen bei den botanisch-lateinischen<br />
Taxanamen. Aufgrund eines Missverständnisses des diesbezüglichen Artikels 23 im Nomenklatur-Code<br />
(ICBN: MCNEILL & al. 2007) und begünstigt durch eine lange Tradition, meinen<br />
viele Florenverfasser, diese Autornamen müssten unbedingt genannt werden, weil an<strong>der</strong>nfalls<br />
<strong>der</strong> wissenschaftliche Charakter bedroht sei – ein absurdes Argument angesichts <strong>der</strong> geringen<br />
Rolle wissenschaftlicher Prinzipien bei <strong>der</strong> Abfassung vieler Floren und insbeson<strong>der</strong>e vieler<br />
Bestimmungsschlüssel! Die ehemals missverständliche Formulierung im ICBN, auf die sich –<br />
<strong>zur</strong> Rede gestellt – die Befürworter nomenklatorischer Autorangaben berufen, ist übrigens<br />
inzwischen korrigiert worden, indem klar festgehalten wird, dass diese bloß in taxonomischnomenklatorischen<br />
Abhandlungen zu verwenden sind (FISCHER 2001b). Der tatsächliche<br />
Grund für das Festhalten an <strong>der</strong> unsinnigen Tradition liegt wohl in nicht hinterfragtem Traditionalismus,<br />
wenn nicht sogar in Unkenntnis <strong>der</strong> Nomenklaturregeln. (Es sei hier übrigens aus-<br />
17