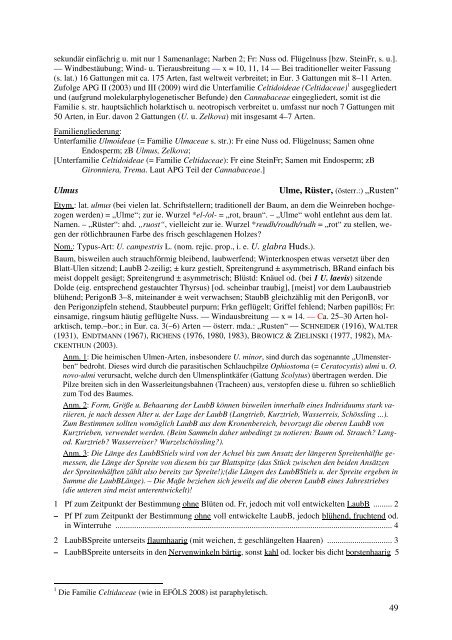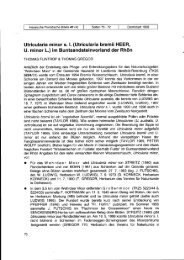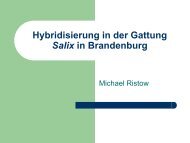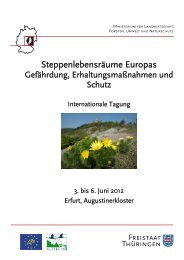Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Flora von Österreich - Gesellschaft zur Erforschung der Flora ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sekundär einfächrig u. mit nur 1 Samenanlage; Narben 2; Fr: Nuss od. Flügelnuss [bzw. SteinFr, s. u.].<br />
— Windbestäubung; Wind- u. Tierausbreitung — x = 10, 11, 14 — Bei traditioneller weiter Fassung<br />
(s. lat.) 16 Gattungen mit ca. 175 Arten, fast weltweit verbreitet; in Eur. 3 Gattungen mit 8–11 Arten.<br />
Zufolge APG II (2003) und III (2009) wird die Unterfamilie Celtidoideae (Celtidaceae) 1 ausgeglie<strong>der</strong>t<br />
und (aufgrund molekularphylogenetischer Befunde) den Cannabaceae eingeglie<strong>der</strong>t, somit ist die<br />
Familie s. str. hauptsächlich holarktisch u. neotropisch verbreitet u. umfasst nur noch 7 Gattungen mit<br />
50 Arten, in Eur. da<strong>von</strong> 2 Gattungen (U. u. Zelkova) mit insgesamt 4–7 Arten.<br />
Familienglie<strong>der</strong>ung:<br />
Unterfamilie Ulmoideae (= Familie Ulmaceae s. str.): Fr eine Nuss od. Flügelnuss; Samen ohne<br />
Endosperm; zB Ulmus, Zelkova;<br />
[Unterfamilie Celtidoideae (= Familie Celtidaceae): Fr eine SteinFr; Samen mit Endosperm; zB<br />
Gironniera, Trema. Laut APG Teil <strong>der</strong> Cannabaceae.]<br />
Ulmus Ulme, Rüster, (österr.:) „Rusten“<br />
Etym.: lat. ulmus (bei vielen lat. Schriftstellern; traditionell <strong>der</strong> Baum, an dem die Weinreben hochgezogen<br />
werden) = „Ulme“; <strong>zur</strong> ie. Wurzel *el-/ol- = „rot, braun“. – „Ulme“ wohl entlehnt aus dem lat.<br />
Namen. – „Rüster“: ahd. „ruost“, vielleicht <strong>zur</strong> ie. Wurzel *reudh/roudh/rudh = „rot“ zu stellen, wegen<br />
<strong>der</strong> rötlichbraunen Farbe des frisch geschlagenen Holzes?<br />
Nom.: Typus-Art: U. campestris L. (nom. rejic. prop., i. e. U. glabra Huds.).<br />
Baum, bisweilen auch strauchförmig bleibend, laubwerfend; Winterknospen etwas versetzt über den<br />
Blatt-Ulen sitzend; LaubB 2-zeilig; ± kurz gestielt, Spreitengrund ± asymmetrisch, BRand einfach bis<br />
meist doppelt gesägt; Spreitengrund ± asymmetrisch; Blüstd: Knäuel od. (bei 1 U. laevis) sitzende<br />
Dolde (eig. entsprechend gestauchter Thyrsus) [od. scheinbar traubig], [meist] vor dem Laubaustrieb<br />
blühend; PerigonB 3–8, miteinan<strong>der</strong> ± weit verwachsen; StaubB gleichzählig mit den PerigonB, vor<br />
den Perigonzipfeln stehend, Staubbeutel purpurn; Frkn geflügelt; Griffel fehlend; Narben papillös; Fr:<br />
einsamige, ringsum häutig geflügelte Nuss. — Windausbreitung — x = 14. — Ca. 25–30 Arten holarktisch,<br />
temp.–bor.; in Eur. ca. 3(–6) Arten — österr. mda.: „Rusten“ — SCHNEIDER (1916), WALTER<br />
(1931), ENDTMANN (1967), RICHENS (1976, 1980, 1983), BROWICZ & ZIELINSKI (1977, 1982), MA-<br />
CKENTHUN (2003).<br />
Anm. 1: Die heimischen Ulmen-Arten, insbeson<strong>der</strong>e U. minor, sind durch das sogenannte „Ulmensterben“<br />
bedroht. Dieses wird durch die parasitischen Schlauchpilze Ophiostoma (= Ceratocystis) ulmi u. O.<br />
novo-ulmi verursacht, welche durch den Ulmensplintkäfer (Gattung Scolytus) übertragen werden. Die<br />
Pilze breiten sich in den Wasserleitungsbahnen (Tracheen) aus, verstopfen diese u. führen so schließlich<br />
zum Tod des Baumes.<br />
Anm. 2: Form, Größe u. Behaarung <strong>der</strong> LaubB können bisweilen innerhalb eines Individuums stark variieren,<br />
je nach dessen Alter u. <strong>der</strong> Lage <strong>der</strong> LaubB (Langtrieb, Kurztrieb, Wasserreis, Schössling ...).<br />
Zum Bestimmen sollten womöglich LaubB aus dem Kronenbereich, bevorzugt die oberen LaubB <strong>von</strong><br />
Kurztrieben, verwendet werden. (Beim Sammeln daher unbedingt zu notieren: Baum od. Strauch? Lang-<br />
od. Kurztrieb? Wasserreiser? Wurzelschössling?).<br />
Anm. 3: Die Länge des LaubBStiels wird <strong>von</strong> <strong>der</strong> Achsel bis zum Ansatz <strong>der</strong> längeren Spreitenhälfte gemessen,<br />
die Länge <strong>der</strong> Spreite <strong>von</strong> diesem bis <strong>zur</strong> Blattspitze (das Stück zwischen den beiden Ansätzen<br />
<strong>der</strong> Spreitenhälften zählt also bereits <strong>zur</strong> Spreite!);(die Längen des LaubBStiels u. <strong>der</strong> Spreite ergeben in<br />
Summe die LaubBLänge). – Die Maße beziehen sich jeweils auf die oberen LaubB eines Jahrestriebes<br />
(die unteren sind meist unterentwickelt)!<br />
1 Pf zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Bestimmung ohne Blüten od. Fr, jedoch mit voll entwickelten LaubB ......... 2<br />
– Pf Pf zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Bestimmung ohne voll entwickelte LaubB, jedoch blühend, fruchtend od.<br />
in Winterruhe .................................................................................................................................... 4<br />
2 LaubBSpreite unterseits flaumhaarig (mit weichen, ± geschlängelten Haaren) ............................... 3<br />
– LaubBSpreite unterseits in den Nervenwinkeln bärtig, sonst kahl od. locker bis dicht borstenhaarig 5<br />
1 Die Familie Celtidaceae (wie in EFÖLS 2008) ist paraphyletisch.<br />
49