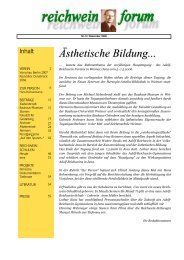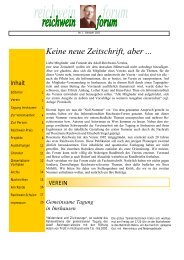Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erlasse des Kultusministeriums stützten zunächst den von<br />
Kade und dem Peter Petersen-Schüler Johann Friedrich Dietz<br />
vorangetriebenen agrarromantischen Neuansatz. (Vgl. Kade<br />
1932 a,b; 1935; Dietz 1934; 1935; Oppermann 1933/ 34)<br />
Wenn daher Ernst Bargheer in seinen Verhandlungen mit<br />
<strong>Reichwein</strong> im Sommer 1933 die Taunusschule in Wörsdorf als<br />
Vorbild für die Aufbauarbeit in Tiefensee erwähnte, lag darin<br />
die Erwartung, dass der �vorläufig beurlaubte� Professor sich<br />
durch einen Beitrag in der Landschulreform bewähren würde,<br />
deren Entwicklungsrichtung bereits feststand.<br />
In Tiefensee war der neue Lehrer im Oktober 1933 demnach<br />
mit der Frage konfrontiert, welche Reformrichtung das<br />
begonnene Schulprojekt einschlagen sollte. Anders formuliert:<br />
er musste realistische Vorstellungen über die Zukunft der<br />
Schulkinder gewinnen, auf die sie sich in der Schule<br />
vorbereiten sollten.<br />
Bereits die soziologische Struktur des Straßendorfes schloss<br />
eine unbesehene Übernahme der Vorstellungswelt von<br />
Krieck, Kade und Dietz aus. Tiefensee war zwar ländlich<br />
geprägt, aber kein Bauerndorf. Es gab gleich neben der<br />
Schule ein größeres Gut, auch eine Försterei, wo einige<br />
Ortsbewohner Arbeit fanden. Überwiegend aber lebte die<br />
Bevölkerung vom Ausflugsverkehr aus der nahe gelegenen<br />
Großstadt. Dem entsprach die soziale Zusammensetzung der<br />
Schülerschaft. Während der Jahre 1933 bis 1939 besuchten<br />
die einklassige Schule pro Schuljahr etwa 40 Schulkinder.<br />
Von diesen stammten, wie <strong>Reichwein</strong> 1937 notiert, �20 aus<br />
Landarbeiterfamilien, die andere Hälfte verteilt sich auf<br />
Bahnarbeiter, Handwerker, und ganz wenige stammen aus<br />
anderen Schichten�. (Vgl. Amlung 1999, 313)<br />
2.2. <strong>Reichwein</strong>s pädagogische Reformperspektive<br />
Basierend auf gesellschaftlichen Tatsachen betont <strong>Reichwein</strong><br />
bereits in seinem Artikel: �Deutsche Landschule� in der<br />
Frankfurter Zeitung vom 21. Januar 1934 zwar die<br />
pädagogische Notwendigkeit, von der ländlichen Lebenswelt<br />
der Schulkinder auszugehen; er relativiert aber die modische<br />
Agrarromantik, indem er mit dem unverdächtigen Wilhelm<br />
Heinrich Riehl die Vielfalt und Unterschiedlichkeit dörflicher<br />
Siedlungsformen in Deutschland schildert. Vor diesem<br />
Hintergrund trifft seine Kritik die Kirchturmsenge der �neuen<br />
Richtung�: � Die Schule soll die Fenster der Dorfes aufreißen,<br />
im wörtlichen und im übertragenen Sinne, die Fenster zum<br />
Volk und zur Welt. Die Heimatgebundenheit der Landschule<br />
wird manchmal noch so mißverstanden, als ob die Welt<br />
jenseits der Feldmark oder jenseits der nächsten Kreisstadt<br />
mit Brettern zugenagelt sei. Die Schule muß wissen: das Land<br />
darf sich nicht abkapseln, darf nicht Museum werden, sondern<br />
muß sich mitten im ganzen großen Volk und mit ihm<br />
entwickeln. Nichts würde diese Jungen und Mädchen später,<br />
wenn sie Bauern, Handwerker und Hausfrauen sind, mehr<br />
schaden, als engstirniges Winkeltum. Der Landlehrer muß<br />
das Ohr am Herzen des ganzen Volkes haben; er muß es<br />
kennen in allen seinen Schichten. Die tiefste Schicht der<br />
Schule heißt �Volk�; in dieser Schicht heben �Stadt� und �Land�<br />
sich auf; an ihr haben alle Kinder teil.� (<strong>Reichwein</strong> 1934)<br />
<strong>Reichwein</strong>s Konzept einer weltoffenen Schulwerkstatt auf<br />
dem Lande findet hier bereits eine erste Begründung. Dass er<br />
aber die Richtungsentscheidung für das Projekt Tiefensee<br />
nicht unabhängig von seinen Analysen weltwirtschaftlicher<br />
und geopolitischer Entwicklungstrends getroffen hat, konnte<br />
schon am Geschichtsfries, dem �Laufenden Band der<br />
Geschichte�, nachgewiesen werden. Als Konstruktionsprinzip<br />
des Bandes, das die Kinder an der Wand ihres<br />
Klassenraumes befestigten, entdeckt man den �realsoziologischen�<br />
Ansatz wieder, den <strong>Reichwein</strong> in der Einleitung<br />
17<br />
Nr. 4 / April 2004<br />
seiner Untersuchung: �Die Rohstoffwirtschaft der Erde� 1928<br />
entwickelt hatte. Dort zog <strong>Reichwein</strong> zugleich Folgerungen<br />
aus seinen Untersuchungen für die künftige Entwicklung<br />
Deutschlands. Als rohstoffarmes Land, lautet sein Befund,<br />
stehe Deutschland in den weltwirtschaftlichen Prozessen an<br />
einem �Scheideweg�. Nur dann habe es eine Chance zur<br />
Übernahme einer weltpolitischen Rolle, wenn es sich dem<br />
neuen Trend zu neoimperialistischen Gewaltlösungen der<br />
Probleme widersetze und an ihrer Stelle �die Parole<br />
genossenschaftlicher Zusammenarbeit� verfolge (<strong>Reichwein</strong><br />
1928, VII-XI; vgl. Lingelbach 1997, 227).<br />
<strong>Reichwein</strong>s Vorstellungen über die gesellschaftliche<br />
Entwicklung in Deutschland wird bereits in seinen<br />
Bearbeitungen von Beiheften für Unterrichtsfilme erkennbar,<br />
die 1935 einsetzen. Unter dem Titel: �Handgedrucktes<br />
Bauernleinen� verbirgt sich eine historische Rekonstruktion<br />
handwerklicher Farbstoffgewinnungs- und Färbungsverfahren.<br />
Die Geschichte von Weiterentwick-lungen der Verarbeitungsformen<br />
zunächst des einheimischen Maisch über den<br />
importierten Indigo bis zu Färbungstechnologien mit<br />
künstlichen Farbstoffen in der modernen Farbenindustrie wird<br />
als wohltätiger Fortschritt aller Menschen beschrieben.<br />
Verdichtungen der Kooperationsbeziehungen zwischen der<br />
ländlichen und der städtischen Arbeitswelt, erfahren die<br />
Nutzer des Beiheftes, nicht deren Abkapselungen<br />
gegeneinander dienen dem Wohlergehen beider Bevölkerungsgruppen.<br />
Wenn <strong>Reichwein</strong> gleichwohl die werktätige<br />
Rekonstruktion tradierter Web- und Färbeverfahren in<br />
Tiefensee förderte, war das ein Ansatz ästhetischer<br />
Erziehung, durch den Maßstäbe für die Herstellung<br />
formschöner Gegenstände gewonnen werden sollten,<br />
keineswegs ein Kotau vor der offiziösen Revitalisierung<br />
traditioneller bäuerlicher Produktionsformen (vgl. Amlung<br />
2000, 127 ff.).<br />
Die 1936 erschienenen Beihefte für die Unterrichtsfilme:<br />
�Pulquebereitung in Mexiko�, �Sisalernte auf Yukatan�,<br />
�Maisernte in Mexiko�, �Kokosnußernte in Columbien� und das<br />
1938 produzierte Beiheft: �Deutsche Kamerun-Bananen�<br />
waren didaktisch der Förderung globaler Horizonterweiterung<br />
der Landkinder zugeordnet. Enge Beziehungen zwischen<br />
�Mexiko erwacht� (<strong>Reichwein</strong> 1930) und den Unterrichtshilfen<br />
für Lehrer von 1936 hat <strong>Reichwein</strong> durch Literaturhinweise<br />
hergestellt.<br />
Im Gegensatz zur gängigen pädagogischen Agrarromantik<br />
setzt <strong>Reichwein</strong>s Auffassung der Landschulreform<br />
offenkundig auf die Modernisierung der deutschen<br />
Gesellschaft. Der Ausbau der Verkehrsnetze verdichte die<br />
Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen<br />
und intensiviere, wie er im Beiheft zum<br />
Unterrichtsfilm �Verkehrsflugzeug im Flughafen Berlin� zeigt<br />
(<strong>Reichwein</strong> 1939), die internationalen Austauschbeziehungen.<br />
Nicht zufällig bezeichnet <strong>Reichwein</strong> daher seine Vision von<br />
der künftigen Bewährung des �Schaffenden Schulvolkes� mit<br />
dem auf die Arbeitswelt als ganze bezogenen Begriff<br />
�Schaffendes Volk�. Der Begriff weckte Erwartungen, dass<br />
Tugenden und Kompetenzen, wie sie die Kinder in den<br />
werkgenossenschaftlich strukturierten �Vorhaben� in<br />
Tiefensee erwarben, künftig in allen Berufstätigkeiten auf dem<br />
Land und in der Stadt nachgefragt würden. Mit der Forderung<br />
nach planvollen, �in sich aufgebauten Leistungsfolgen� und<br />
der ständigen Verifikation der Arbeit an der Funktionstüchtigkeit<br />
des �Werks� schufen diese Projekte nach<br />
<strong>Reichwein</strong>s Auffassung �Erfolgsfreude�, die im Kinde �Impulse<br />
zu weiterem Schaffen entbindet�. Die Weiterführung des<br />
Weges, hoffte der Tiefenseer Lehrer mit Berthold Otto, könnte