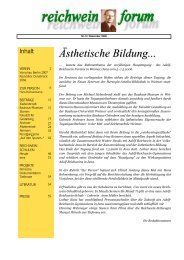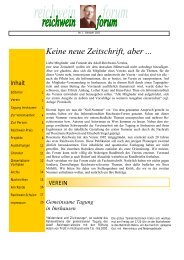Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sen � vor der gefährlichen Aufspaltung des �Gebildeten� [...] er<br />
nimmt gern ein Wissen an, das ihm lebensnah erscheint und<br />
sich laiengemäß auf das Bedeutsame beschränkt.� 23 Dem<br />
�Schaffenden Schulvolk� liegt ein umfassendes Bildungskonzept<br />
zugrunde, wie die Abschnitte über die Durchsichtigkeit<br />
der Formen, etwa �Vom Sehen� und �Vom Hören�, zeigen.<br />
<strong>Reichwein</strong>s Erziehungskonzept steht dem, was wir früher unter<br />
�volkstümlicher Bildung� verstanden, nahe. <strong>Eine</strong> wissenschaftsorientierte<br />
oder �basierte Bildung als Grundlage schulischer<br />
Bildung für alle lehnt er ab, das zeigen seine vielfachen<br />
Äußerungen in verschiedenen Lebensabschnitten über<br />
Gebildete oder Intellektualismus.<br />
<strong>Reichwein</strong>s Schulkonzept geht allerdings über einen Kanon<br />
weit hinaus. Die Differenz zwischen <strong>Reichwein</strong> und dem heutigen<br />
Schulverständnis liegt darin, dass <strong>Reichwein</strong> in der kleinen<br />
Landschule Tiefensee ein erzieherisches Gesamtkonzept<br />
verwirklichen konnte, unser Schulverständnis aber weitgehend<br />
unterrichtlich-fachlich geprägt sind. Die Bestimmung der<br />
Grenzen von Schule, die Konzentration auf Unterricht, die so<br />
verschiedene Erziehungswissenschaftler wie Giesecke, Oelkers<br />
oder Tenorth fordern, und die Unterstützung, die dieses<br />
Konzept in der Öffentlichkeit hat, weist auf die Stärke des<br />
herrschenden Schulverständnisses hin.<br />
III. Das Verständnis von Erziehung<br />
Die Erziehungsaufgabe der Schule ist nicht Gegenstand von<br />
PISA, sie ist dessen Sprache auch fremd, obwohl für die anderen<br />
PISA-Länder die deutsche Unterscheidung von Bildung<br />
und Erziehung unverständlich ist. Zedler wie Fuchs jedenfalls<br />
vermissen den erzieherischen Aspekt in den large-scaleassessements.<br />
Ich meine demgegenüber, die PISA-<br />
Philosophie schließe im Prinzip Erziehung nicht aus. PISA<br />
setzt sich in zwei Kapiteln mit Zielen auseinander, die in der<br />
älteren Sprache als Erziehungsziele zu kennzeichnen wären,<br />
in der PISA-Sprache als Lernkompetenzen: �Selbstreguliertes<br />
Lernen� und �Kooperation und Kommunikation� werden beschrieben<br />
und gemessen. 24 Versuchte man, <strong>Reichwein</strong>s Erziehungsbegriff<br />
im PISA-Denken stärker zu verankern� ginge<br />
es �nur� darum, ob etwa auf der großen Fahrt, einem der zentralen<br />
Erziehungsvorhaben <strong>Reichwein</strong>s, nachweisbar(!) Basiskompetenzen<br />
ausgebildet oder weiterentwickelt werden, die<br />
zur Lebensbewältigung notwendig sind. Solche Kompetenzen<br />
müssten erfassbar sein, möglicherweise mit Einschränkungen<br />
und nur auf sehr komplizierte Weise. Die tatsächliche Problematik<br />
der PISA-Philosophie bestünde in der schon erörterten<br />
faktischen Gewichtung unterschiedlicher Aufgaben von Schule.<br />
Für <strong>Reichwein</strong>s Schulverständnis ist die Erziehungsaufgabe<br />
zentral, �Erziehung� beschreibt sein Schulverständnis. Im<br />
�Schaffenden Schulvolk� fällt die permanente Verwendung der<br />
Begriffe �Erziehung�, �erzieherisch�, �Erzieher� auf. Der Begriff<br />
Unterricht kommt seltener vor, Lehrer fast gar nicht, und<br />
wenn, dann eher negativ, obwohl doch �Schaffendes Schulvolk�<br />
die konkrete Beschreibung eines Schulversuchs darstellt.<br />
Auch dann, wenn es �nur� um gute didaktische und methodische<br />
Einfälle geht, meidet <strong>Reichwein</strong> den Begriff Lehrer<br />
und schreibt vom Erzieher.<br />
�Das Kind �unterrichtet� sich, indem es selbsttätig, vom Erzieher<br />
geführt, spielt, versucht und wirkt, liest, erfährt und lernt.<br />
Und all dieses Bemühen kreist um die Welt, in der es lebt und<br />
sich bewähren muss. Dieser �Unterricht� ist das Kernstück,<br />
23 Schulvolk, S. 127f.<br />
24 PISA 2000, Kapitel 6 und 7.<br />
31<br />
Nr. 4 / April 2004<br />
vielleicht das schwierigste Stück unserer Erziehung. Fast alle<br />
Beispiele, die wir uns aus unserer Arbeit gaben, gehören zu<br />
diesem Unterricht im engen Sinne. Wer mit einem alten, verlebten<br />
Begriff von Unterricht an ihre Betrachtung ginge, könnte<br />
vielleicht vermuten, dass hier gar nicht von Unterricht die<br />
Rede sei, weil er nämlich darunter noch die einseitige �Belehrung�<br />
von Seiten des �Lehrers� verstünde. In Wirklichkeit hat<br />
dieser Unterricht früheren und verbrauchten Stils einen Gestaltwandel<br />
durchgemacht. Er ist in der verjüngten Form der<br />
selbsttätigen Erziehungsgemeinschaft wiederauferstanden.� 25<br />
Offensichtlich liegt <strong>Reichwein</strong> zwar an gutem Unterricht � man<br />
kann sich an der Fülle der Einfälle und Ergebnisse begeistern<br />
-, aber ihm geht es in der Darstellung primär um die durch Unterricht<br />
verfolgten Erziehungsziele, nicht um konkrete Lernergebnisse.<br />
�Denn Erziehung heißt, zum Wesen der Dinge zu<br />
führen; zum eigenen Können und zum Begreifen der um uns<br />
wirkenden Welt.� 26 <strong>Reichwein</strong> zielt auf das Verhalten der Kinder.<br />
Sie sollen auf den eigenen Weg gebracht werden ,27 aus<br />
freiem Antrieb und mit Lust arbeiten, Freude an der Leistung<br />
haben .28 Der Erzieher hilft dem Kind, die �Sitte� zu entwickeln,<br />
den Sinn für Ordnung und geordnete Leistung; der Eifer soll<br />
gestählt, der Wetteifer aufgebaut, die persönliche Einordnung<br />
in einen Aufgabenkreis erfahren werden; Sorgfalt und Sachlichkeit<br />
sind einzuüben. �Übung und ihr dauerhafter Niederschlag<br />
in Gewohnheit und Sitte wirkt als bleibende formbildende<br />
Kraft fürs ganze Leben.� 29 Man könnte von der Didaktik<br />
der Erziehung sprechen. Der Unterricht wird auf erzieherische<br />
Wirkung hin geprüft, die Erziehungsaufgabe bestimmt<br />
den Unterricht.<br />
Meyers Konversationslexikon von 1888 �versteht [...] unter Erziehung<br />
die absichtliche und planmäßige Einwirkung der Erwachsenen<br />
auf die Unmündigen, welche den natürlichen Vorgang<br />
des Erwachsens begleitet und wie dieser in der natürlichen<br />
Reife, so ihrerseits in der geistigen Mündigkeit der Erzogenen<br />
ihren Zielpunkt findet. “30 Diese Definition formuliert den<br />
damals gängigen Oberbegriff für das, was wir heute häufig<br />
trennen. Im Alltagssprachgebrauch und in der erziehungswissenschaftlichen<br />
Diskussion werden im deutschen Sprachgebrauch<br />
die Begriffe Erziehung und Bildung auseinandergehalten,<br />
Unterricht hat mit Bildung, 31 Erziehung mit Moral zu<br />
tun. 32 Offensichtlich hat sich � wohl erst in den letzten 30 Jahren<br />
- eine sprachliche Verschiebung ergeben, die beide Aspekte<br />
des Erziehungsprozesses trennt, dementsprechend<br />
muss man sich seither um die Beziehung beider Begriffe, ihre<br />
Trennung oder Einheit bemühen. Besonders deutlich wird unser<br />
Sprachgebrauch in den unterschiedlichen Berufsbezeichnungen<br />
Erzieher/in und Lehrer/in; <strong>Reichwein</strong> sah sich selbst-<br />
25 Schulvolk, S. 118.<br />
26 <strong>Adolf</strong> <strong>Reichwein</strong>, Film in der Schule, S. 211 (in: <strong>Reichwein</strong>, Schaffendes<br />
Schulvolk � Film in der Schule, Weinheim 1993), zitiert als<br />
Film.<br />
27 Schulvolk, S. 42.<br />
28 Schulvolk, S. 34.<br />
29 Schulvolk, S. 32-38.<br />
30 Meyer 1888, Bd. V, S. 834.<br />
31 Peter Fauser (Wozu die Schule da ist, in: P. Fauser (Hrsg.) Wozu<br />
die Schule da ist. <strong>Eine</strong> Streitschrift, Velber 1996, S. 75-88) wirft etwa<br />
Giesecke vor, sein Konzept sei das der �klassisch modernen Unterrichtsschule�<br />
(S. 87).<br />
32 Vgl. Annegret Eickhorst, Schulpädagogik - Strukturlinien und Problemlagen,<br />
in: Leo Roth (Hrsg), Pädagogik Handbuch für Studium und<br />
Praxis, München 2001 2.A., S. 724-742; Jürgen Oelkers, Wie man<br />
Schule entwickelt, Weinheim 2003.