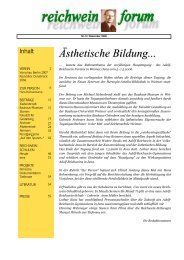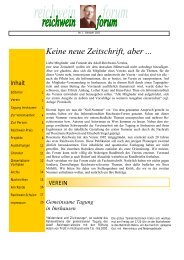Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Eine Brücke ... - Adolf-Reichwein-Verein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bauersfrau den Schwatz am Brunnen nicht mit langen<br />
Lastwegen erkaufen -, von den Fronten grüßen hohe, helle<br />
Fenster, wenn auch der heimliche Schummer unserer<br />
großväterlichen Stuben verloren geht � denn was dem<br />
Schweinestall recht ist, soll der menschlichen Behausung<br />
billig sein usw. Kurz, unser Dorf sei aufgeschlossen für das<br />
notwendige Neue � die Schule öffnet sich ihm zuerst! � und<br />
zugleich zäh verschworen den alten, wahren, bäuerlichen<br />
Werten, wie der Einfachheit in Wohnung und Gerät, der<br />
Schönheit, Einheit und bodenständigen Zweckmäßigkeit der<br />
urländlichen Holzkultur, dem gelassenen Leben im Rhythmus<br />
von Jahr und Tag � dem die Schule bewusst sich wieder<br />
hingibt als einem Unterpfand der gesunden Nation.�<br />
(<strong>Reichwein</strong> 1939, 215 f.). Gewiss, auch in den Tiefenseer<br />
Schulschriften ist von ländlicher Holzkultur und vom<br />
Rhythmus der Tages- und Jahresabläufe auf dem Land die<br />
Rede, aber eine derartige Verklärung des zeitgenössischen<br />
bäuerlichen Dorflebens findet man dort nicht. Andererseits<br />
werden die globale Horizonterweiterung der Tiefenseer<br />
Schulkinder, ihr werktätiger Nachvollzug von Kontinente<br />
umspannenden Luftverkehrsverbindungen, aber auch ihre<br />
Einsichten in die Wechselbeziehungen zwischen den<br />
ländlichen und städtischen Arbeitswelten in der modernen<br />
Gesellschaft mit keinem Wort erwähnt. Im Gegenteil: Die<br />
Eigenständigkeit bäuerlicher Dorfkultur wird gegen städtische<br />
Einflüsse wacker verteidigt. Kein Zweifel, <strong>Reichwein</strong> taktiert.<br />
Seine Bemühungen, die im NSLB immer noch virulenten<br />
agrarromantischen Tendenzen in seiner Darstellung zu<br />
berücksichtigen, sind zu übersehen. 4<br />
Von den politischen Befürchtungen und schwierigen<br />
Verhandlungen ihres Lehrers erfuhren die Tiefenseer<br />
Schulkinder nichts. Und doch spürten sie Verbindungen ihrer<br />
kooperativen Projektarbeit mit gesellschaftlichen Reformperspektiven.<br />
Ihre Bewusstseinsänderungen beschreibt<br />
<strong>Reichwein</strong> im abschließenden Kapitel von �Schaffendes<br />
Schulvolk� offen.<br />
3. �Schaffendes Schulvolk� und <strong>Reichwein</strong>s konkrete<br />
Utopie des �Schaffenden Volkes�<br />
Den Zusammenhang von Reformpädagogik und<br />
Gesellschaftsreform erlebten die Tiefenseer Schulkinder nach<br />
<strong>Reichwein</strong>s Bericht als Qualitätssteigerung ihrer<br />
Arbeitsbeziehungen im Gruppenprozess. Er beschreibt den<br />
Vorgang als Abfolge von drei Entwicklungsstufen in der<br />
Herausbildung der schulischen Werkgenossenschaft: �Nachbarschaft�,<br />
�Kameradschaft� und �die neue Gruppe�.<br />
Zum Verständnis der qualitativen Veränderungen in den<br />
Kooperationsbeziehungen verweist der Autor auf<br />
Entwicklungstrends der modernen Gesellschaft. Bereits<br />
entwickelt hätten sich im Modernisierungsprozess neue, nicht<br />
mehr allein durch Herkunft und Privileg, sondern durch<br />
�Leistung� erworbene Statusunterschiede. Sie ermöglichten<br />
eine �neue Unmittelbarkeit� in den zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen, die auf wechselseitigem Respekt der durchaus<br />
ungleichen Kommunikationspartner beruhe.<br />
4 Link 1999, 311 übersieht die inhaltlichen Differenzen zwischen den<br />
genannten Texten und gelangt zu inkonsistenten Einschätzungen.<br />
19<br />
Nr. 4 / April 2004<br />
3.1. �Mitsorgende Nachbarschaft�. <strong>Reichwein</strong>s<br />
Auffassung von der Struktur der pädagogischen<br />
Sozialbeziehung<br />
Im Bereich der pädagogischen Sozialbeziehungen öffne die<br />
�neue Unmittelbarkeit� und �Nähe� dem �Erzieher� die<br />
Chance, das einzelne Kind als �Träger eines persönlichen,<br />
d.h. einmaligen Formwerts� überhaupt erst wahrzunehmen<br />
und dadurch zu erfahren, dass seine eigene �Nachbarschaft�<br />
zu jedem einzelnen der Kinder als eine �persönliche� gefordert<br />
sei:<br />
�Vor dieser Aufgabe stehend spüren wir, wie schwer es ist, sie<br />
immer wieder zu erfüllen. Und doch entbinden wir damit erst<br />
jenen Kraftstrom, der unsere Bemühungen, wenn überhaupt,<br />
zum Blühen bringt. Der Erzieher weiß es am Besten aus<br />
seiner Erfahrung mit den Sorgenkindern. Denn diese sind am<br />
stärksten der Nähe und des persönlichen Kraftstroms<br />
bedürftig. Es gehört zu dem feinsten und wichtigsten Können<br />
aller Erziehungskunst, den Grad dieses unmittelbaren<br />
Wechselspiels aufs gewissenhafteste zu bemessen. Jedem<br />
Kind soll er gemäß sein und sein einziger Maßstab ist dessen<br />
Bedürftigkeit.� In der �mitsorgenden Nachbarschaft�, fährt er<br />
konsequent fort, dürfe daher kein Kind der Gruppe<br />
vernachlässigt oder gar wegen �angeblich minderen<br />
Anspruchs� offen oder insgeheim ausgegrenzt werden. �Wert<br />
und Wirksamkeit jeder Erziehungsgemeinschaft ist untrüglich<br />
am Stande ihrer Sorgenkinder abzulesen, so schwer die<br />
Verwirklichung ohne Fördergruppen auf dem Lande auch sein<br />
mag.� (<strong>Reichwein</strong> 1993, 157).<br />
Das ist eine in verschiedener Hinsicht bemerkenswerte<br />
Aussage. Zu ihrem Verständnis empfiehlt es sich, <strong>Reichwein</strong>s<br />
Gedankengang noch einmal zu rekonstruieren. Wirkungen der<br />
�neuen Unmittelbarkeit� und �Nähe� des gesellschaftlichen<br />
Umgangs fördert <strong>Reichwein</strong> nicht nur im Lehrer-Schüler-<br />
Verhältnis, sondern im Beziehungsgefüge der Tiefenseer<br />
Arbeitsgruppen insgesamt. Jedes einzelne Kind sollte von<br />
allen anderen Gruppenmitgliedern der �Erziehungsgemeinschaft�<br />
nicht nur als mitarbeitendes Gruppenmitglied<br />
akzeptiert werden, sondern erhielt Hilfen in Formen, die es als<br />
Person respektierten. Dieses Beziehungsgefüge charakterisiert<br />
<strong>Reichwein</strong> als �mitsorgende Nachbarschaft�, in die auch<br />
der Lehrer einbezogen war.<br />
Als Gruppenmitglied steht er vor der sehr schwierigen<br />
Aufgabe, seine professionellen Zuwendungen zu den<br />
einzelnen Kindern als nachbarschaftlich-fürsorgliche zu<br />
realisieren, d.h. in jeder Unterrichtssituation ist er<br />
herausgefordert, die unterschiedlichen Schwierigkeiten,<br />
Bedürfnisse, Nöte und Hoffnungen der einzelnen Schülerinnen<br />
und Schüler wahrzunehmen und in seinem Handeln<br />
so zu berücksichtigen, dass die Eigenkräfte der einzelnen<br />
Kinder gestärkt werden.<br />
In der konkreten, durch wissenschaftliche Untersuchungen nie<br />
hinreichend erfassbaren Handlungssituation orientiert sich<br />
<strong>Reichwein</strong> an theoretisch geklärten pädagogischen Prinzipien<br />
und stützt sich auf gesicherte Erfahrungen.<br />
Der Göttinger Pädagoge Johann Friedrich Herbart hat zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts für diese Handlungskompetenz<br />
des Erziehers, die sich zwischen Praxis und Theorie bewegt,<br />
den Begriff �Pädagogischer Takt� eingeführt. Er bewertet ihn<br />
als �das höchste Kleinod der pädagogischen Kunst� (Herbart<br />
1913, 116 ff.).<br />
<strong>Reichwein</strong>s Hallenser Kollegin Elisabeth Blochmann, die mit<br />
ihm zusammen 1933 aus dem Professorenamt entlassen<br />
wurde, hat nach ihrer Rückkehr aus dem englischen Exil die<br />
notorische Missachtung des �Pädagogischen Taktes� im<br />
deutschen Erziehungswesen kulturhistorisch begründet. In