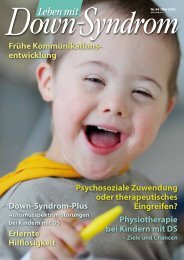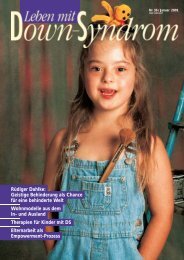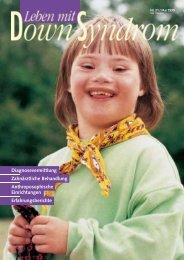Nr. 39, Januar - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 39, Januar - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 39, Januar - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PSYCHOLOGIE<br />
Kognitives Entwicklungstempo<br />
und Verhalten<br />
Hellgard Rauh<br />
Internationale Längsschnittstudien bei Kindern mit<br />
<strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> und auch die Berliner Längsschnittstudie<br />
berichten, trotz Unterschieden in den – insgesamt jeweils<br />
guten – Förderbedingungen, über ähnliche Verlaufskurven<br />
der geistigen, motorischen und sprachlichen Entwicklung.<br />
Die individuellen Unterschiede bei Verlaufskurven<br />
und Entwicklungstempo sind groß.<br />
Aus dem zweiten Lebensjahr ließ sich das Entwicklungsniveau<br />
über drei Jahre später allerdings eher aus Verhaltensmerkmalen<br />
der Kinder als aus den erreichten<br />
Entwicklungsmeilensteinen vorhersagen.<br />
Kinder, die sich besonders langsam entwickelten, zeigten<br />
auch ein eher ungünstiges Verhaltensmuster ihres<br />
leistungsbezogenen Verhaltens.<br />
Die Bindungsqualität der Kinder mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
ließ sich vergleichbar zu der nicht behinderter Kinder<br />
klassifizieren. Bindungssicherheit korrelierte aber im<br />
Vorschulalter nicht notwendigerweise mit rascherem<br />
Entwicklungstempo. Bindungssichere Kinder schienen<br />
jedoch im Verhaltensverlauf eindeutiger und insgesamt<br />
„umgänglicher“ zu sein als bindungsunsichere Kinder.<br />
Längsschnittstudien bei Kindern mit<br />
<strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
Längsschnittstudien bei Kindern mit<br />
<strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong>, die in verschiedenen<br />
Regionen der Welt einschließlich<br />
Deutschland in den letzten 20 Jahren<br />
durchgeführt wurden, haben unser Bild<br />
von der Entwicklung dieser Kinder erheblich<br />
differenziert. Auch in Berlin haben<br />
wir mehr als 30 Kinder mit <strong>Down</strong>-<br />
<strong>Syndrom</strong> über mehrere Jahre in ihrer<br />
Entwicklung begleiten dürfen. Sie wurden<br />
zwischen 1986 und 1995 geboren<br />
und sind nun zwischen fünf und 14 Jahre<br />
alt. Von 25 Kindern haben wir ziemlich<br />
ausführliche Entwicklungsdaten.<br />
6 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>39</strong>, Jan. 2002<br />
In vielen Hinsichten können wir unsere<br />
Berliner Kinder mit denen in anderen<br />
Regionen der Welt vergleichen, weil wir<br />
zur Erfassung des jeweiligen Entwicklungsstandes<br />
der Kinder dasselbe Testverfahren<br />
verwendet haben, nämlich<br />
die Bayley Scales of Infant Development<br />
(Bayley, 1969; 1993). Im Durchschnitt<br />
ähneln unsere Ergebnisse denen in den<br />
USA (z.B. Atkinson et al., 1995; Dunst,<br />
1990; Pueschel, 1984; Pueschel et al.,<br />
1987, 1995; Sigman & Ruskin, 1999), in<br />
Kanada (Bowman, s. Rauh, Rudinger,<br />
Bowman, Berry, Gunn, Hayes, 1991), in<br />
England (z.B. Carr, 1978; 1988), in Australien<br />
(Berry, Gunn & Andrews, 1984;<br />
Crombie & Gunn 1998) oder Deutschland<br />
(Rauh, 1997; 1999). Alle diese Länder<br />
zeichnen ein verhältnismäßig hoher<br />
Lebensstandard, eine gute Gesundheitsversorgung<br />
und das Bestreben aus,<br />
auch Kinder mit erheblichen Behinderungen<br />
in das allgemeine Bildungswesen<br />
und das gesellschaftliche Leben zu<br />
integrieren. Sie unterscheiden sich jedoch<br />
in der Art und Intensität der Frühförderung.<br />
Diese scheint sich aber nicht<br />
in generell unterschiedlichen Entwicklungsverläufen<br />
auszuwirken, wie die<br />
umfangreichen Studien in Australien<br />
zeigen.<br />
In der australischen Untersuchung<br />
(Crombie & Gunn, 1998) wurden Kinder<br />
aus zwei Geburtsjahrgängen verglichen.<br />
Der eine Jahrgang wurde kurz vor, der<br />
andere kurz nach der Einführung differenzierter<br />
Frühfördermaßnahmen und<br />
integrativer Kindergärten und Schulen<br />
untersucht. Die Befunde über die Entwicklungsverläufe<br />
der Kinder bis ins Jugendalter<br />
legen allerdings nahe, dass<br />
sich weder der Zeitpunkt des Beginns<br />
der institutionalisierten Frühförderung<br />
noch ihre Dauer, noch ihre inhaltliche<br />
Ausrichtung in den Entwicklungswerten<br />
der Kinder niederschlugen. Dagegen<br />
zeigten Kinder, die von ihren Eltern<br />
ganz selbstverständlich in das soziale<br />
Alltagsleben einbezogen, z.B. bei Ausflügen<br />
und Besuchen mitgenommen<br />
wurden, im Alter von 14 Jahren ein besseres<br />
Entwicklungsniveau als Kinder,<br />
denen diese anregende Einbeziehung<br />
versagt blieb.<br />
Dass sich die Frühförderungswirkungen<br />
nicht nachweisen ließen, könnte<br />
auch daran liegen, dass bereits bei<br />
dem ersten Geburtsjahrgang die Diskussionen<br />
um die Notwendigkeit von<br />
Frühförderung das Erziehungsklima für<br />
die Kinder positiv beeinflusst haben<br />
können.<br />
Allgemeiner Entwicklungsverlauf bei<br />
Kindern mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
In den ersten drei Lebensjahren entspricht<br />
nach den übereinstimmenden<br />
Befunden der verschiedenen Längsschnittstudien<br />
der geistige Entwicklungsverlauf<br />
der <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong>-Kinder<br />
im Mittel etwas mehr als dem halben<br />
Tempo nicht behinderter Kinder.<br />
D.h., im Alter von zwei Jahren kann<br />
man im Durchschnitt von einem Entwicklungsniveau<br />
von etwa zwölf bis 14<br />
Monaten ausgehen, allerdings mit einer