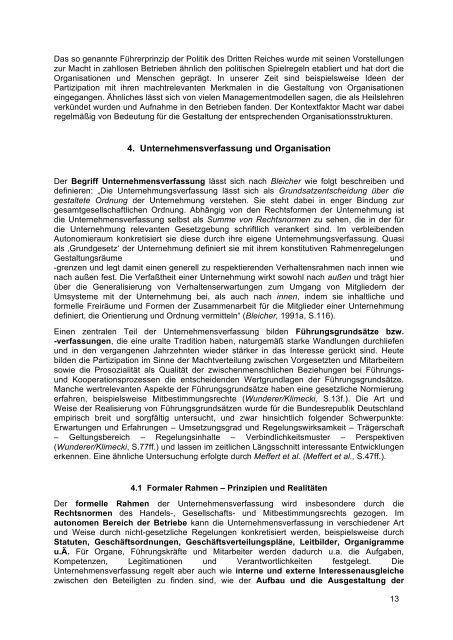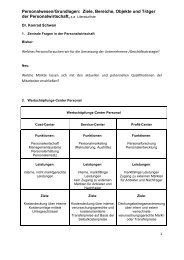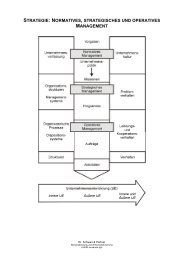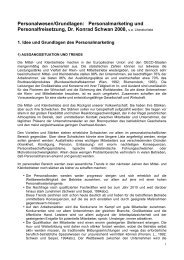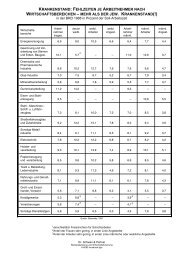Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das so genannte Führerprinzip <strong>der</strong> Politik des Dritten Reiches wurde mit seinen Vorstellungen<br />
zur Macht in zahllosen Betrieben ähnlich den politischen Spielregeln etabliert und hat dort die<br />
Organisationen und Menschen geprägt. In unserer Zeit sind beispielsweise Ideen <strong>der</strong><br />
Partizipation mit ihren machtrelevanten Merkmalen in die Gestaltung von Organisationen<br />
eingegangen. Ähnliches lässt sich von vielen Managementmodellen sagen, die als Heilslehren<br />
verkündet wurden und Aufnahme in den Betrieben fanden. Der Kontextfaktor Macht war dabei<br />
regelmäßig von Bedeutung für die Gestaltung <strong>der</strong> entsprechenden Organisationsstrukturen.<br />
4. Unternehmensverfassung und Organisation<br />
Der Begriff Unternehmensverfassung lässt sich nach Bleicher wie folgt beschreiben und<br />
definieren: „Die Unternehmungsverfassung lässt sich als Grundsatzentscheidung über die<br />
gestaltete Ordnung <strong>der</strong> Unternehmung verstehen. Sie steht dabei in enger Bindung zur<br />
gesamtgesellschaftlichen Ordnung. Abhängig von den Rechtsformen <strong>der</strong> Unternehmung ist<br />
die Unternehmensverfassung selbst als Summe von Rechtsnormen zu sehen, die in <strong>der</strong> für<br />
die Unternehmung relevanten Gesetzgebung schriftlich verankert sind. Im verbleibenden<br />
Autonomieraum konkretisiert sie diese durch ihre eigene Unternehmungsverfassung. Quasi<br />
als ‚Grundgesetz‘ <strong>der</strong> Unternehmung definiert sie mit ihrem konstitutiven Rahmenregelungen<br />
Gestaltungsräume und<br />
-grenzen und legt damit einen generell zu respektierenden Verhaltensrahmen nach innen wie<br />
nach außen fest. Die Verfaßtheit einer Unternehmung wirkt sowohl nach außen und trägt hier<br />
über die Generalisierung von Verhaltenserwartungen zum Umgang von Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Umsysteme mit <strong>der</strong> Unternehmung bei, als auch nach innen, indem sie inhaltliche und<br />
formelle Freiräume und Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit für die Mitglie<strong>der</strong> einer Unternehmung<br />
definiert, die Orientierung und Ordnung vermitteln“ (Bleicher, 1991a, S.116).<br />
Einen zentralen Teil <strong>der</strong> Unternehmensverfassung bilden Führungsgrundsätze bzw.<br />
-verfassungen, die eine uralte Tradition haben, naturgemäß starke Wandlungen durchliefen<br />
und in den vergangenen Jahrzehnten wie<strong>der</strong> stärker in das Interesse gerückt sind. Heute<br />
bilden die Partizipation im Sinne <strong>der</strong> Machtverteilung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern<br />
sowie die Prosozialität als Qualität <strong>der</strong> zwischenmenschlichen Beziehungen bei Führungs-<br />
und Kooperationsprozessen die entscheidenden Wertgrundlagen <strong>der</strong> Führungsgrundsätze.<br />
Manche wertrelevanten Aspekte <strong>der</strong> Führungsgrundsätze haben eine gesetzliche Normierung<br />
erfahren, beispielsweise Mitbestimmungsrechte (Wun<strong>der</strong>er/Klimecki, S.13f.). Die Art und<br />
Weise <strong>der</strong> Realisierung von Führungsgrundsätzen wurde für die Bundesrepublik Deutschland<br />
empirisch breit und sorgfältig untersucht, und zwar hinsichtlich folgen<strong>der</strong> Schwerpunkte:<br />
Erwartungen und Erfahrungen – Umsetzungsgrad und Regelungswirksamkeit – Trägerschaft<br />
– Geltungsbereich – Regelungsinhalte – Verbindlichkeitsmuster – Perspektiven<br />
(Wun<strong>der</strong>er/Klimecki, S.77ff.) und lassen im zeitlichen Längsschnitt interessante Entwicklungen<br />
erkennen. Eine ähnliche Untersuchung erfolgte durch Meffert et al. (Meffert et al., S.47ff.).<br />
4.1 Formaler Rahmen – Prinzipien und Realitäten<br />
Der formelle Rahmen <strong>der</strong> Unternehmensverfassung wird insbeson<strong>der</strong>e durch die<br />
Rechtsnormen des Handels-, Gesellschafts- und Mitbestimmungsrechts gezogen. Im<br />
autonomen Bereich <strong>der</strong> Betriebe kann die Unternehmensverfassung in verschiedener Art<br />
und Weise durch nicht-gesetzliche Regelungen konkretisiert werden, beispielsweise durch<br />
Statuten, Geschäftsordnungen, Geschäftsverteilungspläne, Leitbil<strong>der</strong>, Organigramme<br />
u.Ä. Für Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter werden dadurch u.a. die Aufgaben,<br />
Kompetenzen, Legitimationen und Verantwortlichkeiten festgelegt. Die<br />
Unternehmensverfassung regelt aber auch wie interne und externe Interessenausgleiche<br />
zwischen den Beteiligten zu finden sind, wie <strong>der</strong> Aufbau und die Ausgestaltung <strong>der</strong><br />
13