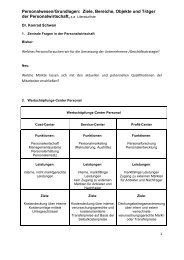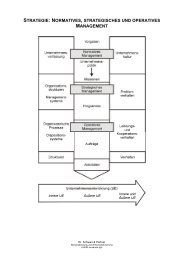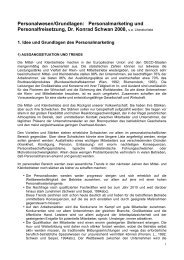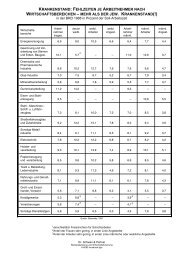Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Organisationsgrundlagen: Bestimmungsfaktoren der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
führen, dass diese außerhalb des Betriebes tätig werden und möglicherweise<br />
Konfliktsituationen auslösen, die bei Einbindung <strong>der</strong> Gruppen nicht entstünden o<strong>der</strong><br />
vergleichsweise besser, sprich konstruktiver lösbar wären. Daher sollte jeweils geprüft<br />
werden, ob es sinnvoll möglich ist, Interessenvertreter bzw. -gruppen in die<br />
Unternehmensverfassung und Organisation einzubinden, um bessere und möglichst<br />
konsensfähige Interessenausgleiche zu erreichen.<br />
Bei <strong>der</strong> internen Strukturierung <strong>der</strong> Interessen geht es im Wesentlichen um<br />
organisatorische Lösungen zur Bewältigung des Spannungsverhältnisses zwischen dem<br />
Autonomiestreben <strong>der</strong> Teilbereiche <strong>der</strong> Organisation einerseits und an<strong>der</strong>erseits <strong>der</strong><br />
Integration <strong>der</strong> organisatorischen Teilbereiche mit <strong>der</strong> Gesamtorganisation, was regelmäßig<br />
Beschränkungen <strong>der</strong> Autonomie <strong>der</strong> Teilbereiche bedingt. Die Regelung <strong>der</strong> betriebsinternen<br />
Interessenstruktur erstreckt sich auf wirtschaftliche, personelle, soziale und an<strong>der</strong>e Aspekte,<br />
d.h. die Regelungen können diffizil und schwierig sein. Eine große Geschäftsnähe <strong>der</strong><br />
Betriebs- bzw. Unternehmensleitung wird häufig mit einer geringen Differenzierung <strong>der</strong><br />
wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Interessenstruktur einhergehen und zentrale<br />
Leistungsstrukturen begünstigen. Eine ausgeprägte Differenzierung <strong>der</strong> betriebsinternen<br />
Interessenstruktur wird hingegen eher zu dezentralisierten Leitungs- und Organisationsformen<br />
führen, wie es beispielsweise für Konglomeratkonzerne sehr typisch ist. Die Gesamtleitung<br />
des Konzerns wird normalerweise Detaileingriffe in Tochterunternehmen vermeiden und sich<br />
auf die Entscheidungen über Rahmenziele, Budgets, Investitionen, wichtige<br />
Personalentscheidungen, Ergebnisbewertungen, Son<strong>der</strong>vorhaben mit beträchtlicher<br />
Bedeutung u.Ä. konzentrieren.<br />
Die Kompetenzordnung <strong>der</strong> Spitzenorgane kann nach dem Vereinigungsmodell einstufig<br />
o<strong>der</strong> nach dem Trennungsmodell mehrstufig geregelt sein, d.h. nach dem Board-System o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Regelung, wie sie das deutsche und österreichische Aktienrecht für die Trennung <strong>der</strong><br />
Leitungs- und Kontrollfunktionen für den Vorstand bzw. den Aufsichtsrat vorsieht. Es darf auf<br />
die Ausführungen an an<strong>der</strong>er Stelle des vorliegenden Kapitels verwiesen werden. Eine<br />
Aufteilung des Aufsichtsrates nach Ressorts ist nicht üblich. Wenn ein solcher Bedarf in<br />
einem Betrieb konkret besteht, kann er durch entsprechende Aufsichtsratsausschüsse<br />
erfüllt werden. Bei den Leitungsorganen hingegen sind ressortspezifische<br />
Aufgabenverteilung eher die Regel und werden durch die rechtliche Gesamtverantwortung<br />
des Vorstandes in <strong>der</strong> Praxis nicht tatsächlich tangiert.<br />
Die Verantwortung und das Selbstverständnis <strong>der</strong> Spitzenorgane kann bei <strong>der</strong> Leitung<br />
einmal tendenziell als treuhändische Verantwortung und ein risikovermeidendes<br />
Sicherungsverhalten verstanden werden, zum an<strong>der</strong>en als eine engagierte unternehmerische<br />
Geschäftstätigkeit mit <strong>der</strong> ständigen Suche nach neuen betrieblichen Möglichkeiten. Dem<br />
entsprechen eine sichernde Überwachung o<strong>der</strong> die Geschäftstätigkeit prospektiv prüfende<br />
Beratung durch die Aufsichtsgremien. Bei dynamischen Betrieben ist Letzteres sicher von<br />
sehr großem Vorteil und <strong>der</strong> ex post-Überwachung vorzuziehen (Bleicher, 1991b, S.131ff.).<br />
5. Organisationsanalyse und Organisationssynthese<br />
Die Organisationsanalyse verfolgt die systematische Untersuchung des<br />
Gesamtzustandes einer Organisation, vornehmlich mit dem Ziel vorhandene<br />
Organisationsprobleme aufzuzeigen und entsprechende Organisationsentwicklungen<br />
vorzubereiten. Eine ganzheitliche Vorgehensweise und die Einbeziehung empirischanalytischer<br />
sowie normativer Komponenten sind dabei von beson<strong>der</strong>er Bedeutung.<br />
Die Organisationsanalyse sollte eine ausreichende Information über den Ist-Zustand einer<br />
Organisation schaffen, wobei die Problemerkennung und Problemanalyse die<br />
wesentlichen Schwerpunkte sind. Damit können Erkenntnisse über die Effizienz einer<br />
Organisation gewonnen werden. Die darauf aufbauende Problemdiagnose soll die<br />
Ursachen für organisatorische Mängel sichtbar machen. Durch die Organisationsanalyse<br />
werden mögliche Soll-Vorstellungen für eine Organisationsgestaltung und<br />
27