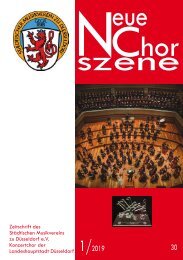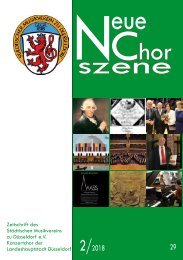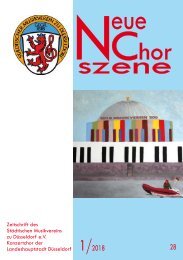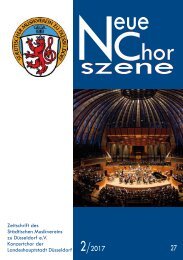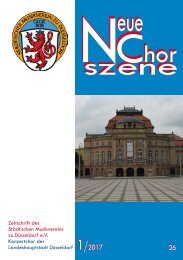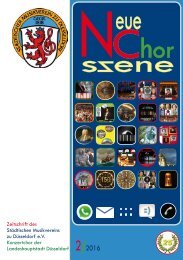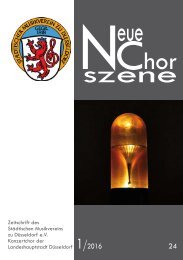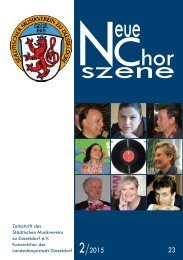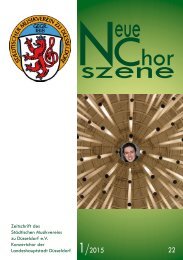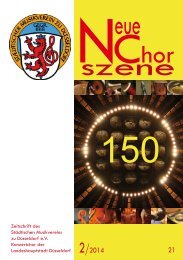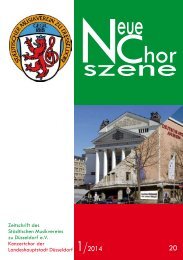NeueChorszene 08 - Ausgabe 2/2008
Zeitschrift des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e.V. Konzertchor der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zeitschrift des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e.V.
Konzertchor der Landeshauptstadt Düsseldorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
liturgischen Gebrauch im Gottesdienst<br />
geschrieben wurden.<br />
„Ein ‚deutsches‘ Requiem“ ent-<br />
gegen der lateinischsprachigen<br />
Tradition<br />
Hinsichtlich der Textgrundlage nimmt<br />
das 1868 endgültig vollendete Werk<br />
„Ein deutsches Requiem“ von Johannes<br />
Brahms (geboren am 7. Mai 1833<br />
in Hamburg, gestorben am 3. April<br />
1897 in Wien) eine Sonderstellung ein.<br />
Brahms vertont von ihm selbst ausgesuchte<br />
und in Reihenfolge gebrachte<br />
Worte der Bibel aus dem Alten und dem<br />
Neuen Testament sowie aus den Apokryphen<br />
3) in der deutschen Übersetzung<br />
von Martin Luther. Während das liturgische<br />
Requiem ein Bittgottesdienst ist,<br />
der für den Verstorbenen gefeiert wird,<br />
und der ihm helfen soll, zur Erlösung zu<br />
gelangen, richten sich die von Johannes<br />
Brahms ausgesuchten Texte an die<br />
Hinterbliebenen, um ihnen Rat, Hilfe<br />
und Trost zu geben 4) . Insofern steht er<br />
mit seinem Werk in der christlich-reformatorischen<br />
lutherischen Tradition,<br />
die sich deutlich von dem lateinischen<br />
Requiem abgewendet hat. Die Aussagen<br />
der ausgewählten Bibelstellen reichen<br />
von der Linderung des Leides der<br />
Trauernden bis zur Mahnung, die Tatsache<br />
des eigenen Todes als Ziel des<br />
irdischen Daseins zu Lebzeiten in das<br />
Denken und Handeln einzubeziehen.<br />
Ausgewählte Bibelstellen werden<br />
zu einer neuen literarischen<br />
Textvorlage zusammengestellt<br />
Die Textauswahl zeugt von einer originären<br />
Frömmigkeit Brahms’ und von<br />
seiner verblüffenden Bibelkenntnis.<br />
Formal ist die Textvorlage von einer<br />
ausgeklügelten Architektur, da die sieben<br />
Teile des deutschen Requiems<br />
in einer raffinierten dramaturgischen<br />
Konstruktion Gedanken an den Kampf<br />
zwischen Schmerz und Freude (Sätze<br />
2 und 6), das Schwanken zwischen<br />
Trauer und Hoffnung (Sätze 3 und 5)<br />
und Worte des Trostes (Sätze 1, 4 und<br />
7 - Eingangs-, Mittel- und Schlussteil)<br />
auch formal zu einem literarischen Meisterwerk<br />
zusammenfassen.<br />
So schafft sich Brahms die Textgrundlage<br />
für ein sehr persönliches und singuläres<br />
Werk.<br />
Gereifte Kompositionskenntnisse<br />
ermöglichen ein erstes großes,<br />
geniales Werk<br />
Auch musikalisch ist das deutsche<br />
Requiem genial und einzigartig. Die<br />
Musik ist von tiefer romantischer Kraft,<br />
vermeidet aber den gefühlsbetonten,<br />
sentimentalen Ausdruck. Auch auf<br />
arienhafte, ausschweifende Sologesänge<br />
eines sonst in Requien üblichen<br />
Solistenquartetts wird verzichtet.<br />
Im Mittelpunkt als Träger des Inhalts<br />
steht der Chor, dem auch die großen<br />
dramatischen Steigerungen übertragen<br />
wurden. Die beiden Solisten, die in drei<br />
der sieben Sätze mitwirken, wechseln<br />
sich mit dem Chor in einer Art Responsorium<br />
ab. Das Orchester ist ein selbständiger<br />
Partner. Seine Funktion geht<br />
weit über die Aufgabe der Begleitung<br />
hinaus. Es bereitet die musikalischen<br />
Geschehnisse vor, beantwortet sie und<br />
führt sie fort.<br />
Mit dem deutschen Requiem „wagte“<br />
sich Johannes Brahms an seine erste<br />
NC 2 / <strong>08</strong> 17