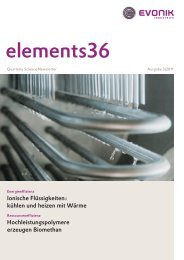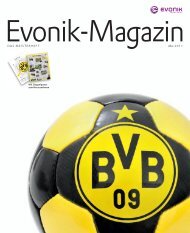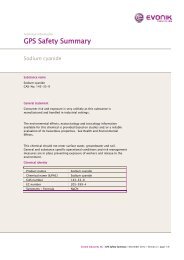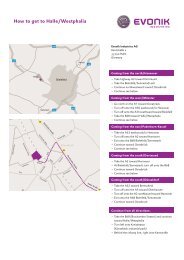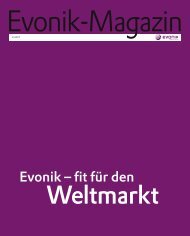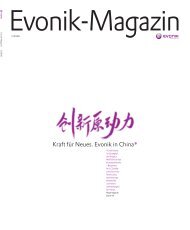elements33 - Evonik
elements33 - Evonik
elements33 - Evonik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
333 Produktes oder Prozesses etabliert,<br />
weil sie als einzige ein weites Feld von Anwendungen<br />
schlüssig und länderübergreifend<br />
harmonisiert abdecken können. Das<br />
auch Life Cycle Assessment (LCA) genannte<br />
Instrument beschreibt den gesamten<br />
Lebensweg eines Produktes – von der<br />
Gewinnung der Rohstoffe über den Herstellungsprozess<br />
und die Anwendung bis<br />
zu seiner Entsorgung.<br />
Mit der neuen Ökobilanz ist <strong>Evonik</strong> der<br />
einzige Hersteller von Aminosäuren für<br />
die Tierernährung, der seine Produkte –<br />
DLMethionin, LLysin (Biolys®), LThreonin<br />
und LTryptophan – einer vergleichenden<br />
und umfassenden Bilanzierung<br />
unterzogen und alternativen Rohstoffen<br />
wie Sojamehl oder Rapsschrot gegenübergestellt<br />
hat. Die Ökobilanz wurde zudem<br />
vom TÜV Rheinland als weltweit anerkanntem,<br />
unabhängigem Gutachter zertifiziert.<br />
Das Zertifikat belegt, dass die Wissenschaftler<br />
alle Umweltauswirkungen<br />
sorgfältig und unvoreingenommen bilanziert<br />
haben.<br />
Futtermischungen im<br />
Vergleich<br />
Für die Ökobilanz hat <strong>Evonik</strong> eine repräsentative<br />
Basismischung aus Weizen und<br />
Gerste zugrunde gelegt, die Defizite an<br />
Methionin, Lysin, Threonin und Tryptophan<br />
aufweist. Um diese Defizite auszugleichen,<br />
beschritt <strong>Evonik</strong> drei Wege:<br />
• die Anreicherung mit den vier<br />
Aminosäuren aus eigener Produktion<br />
(Option 1)<br />
• die Zugabe einer Mischung aus<br />
Sojaschrot und Sojaöl (Option 2)<br />
• die Zugabe eine Mischung aus<br />
Sojaschrot und Rapsschrot (Option 3)<br />
Diese drei Optionen wurden in der Ökobilanz<br />
miteinander verglichen. Die Menge<br />
an zugesetzten Aminosäuren bzw. an Sojaschrot/Sojaöl<br />
oder Sojaschrot/Rapsschrot<br />
ergänzt die Basismischung jeweils<br />
um genau die Menge an Methionin, Lysin,<br />
Threonin und Tryptophan, die den durchschnittlichen<br />
Proteinbedarf eines<br />
Schweins optimal deckt. Der Einsatz von<br />
einem Kilogramm einer bedarfsgerechten<br />
Aminosäurenmischung ersetzt etwa 31 kg<br />
einer Futtermischung auf Sojaschrotbasis<br />
oder rund 34,5 kg einer alternativen Futtermischung<br />
auf SojaRapsBasis für die<br />
Schweinemast. Um eine Vergleichbarkeit<br />
der Systeme herzustellen und eine „funktionelle<br />
Einheit“ für die Bilanzierung zu<br />
Methioninanlage in<br />
Antwerpen. Für eine<br />
Tonne CO 2 , die<br />
während der Synthese<br />
von Methionin ausgestoßen<br />
wird, können<br />
insgesamt 23 Tonnen<br />
über den gesamten<br />
Produktlebenszyklus<br />
eingespart werden.<br />
Für Ammoniak beträgt<br />
dieser Einsparfaktor<br />
sogar 26, für Nitrat liegt<br />
er bei 7<br />
schaffen, mussten die Futtermischungen<br />
außerdem den Tieren jeweils den gleichen<br />
Nutzen bieten. Der Aminosäurenmischung<br />
(Option 1) wurde daher noch eine<br />
WeizenGersteMaisMischung von 29,1<br />
bzw. 31,7 kg zugesetzt, um Energiegehalt<br />
und Gewicht der Mischungen abzugleichen<br />
(Abb. 1).<br />
Analysiert und bewertet wurden die<br />
Umweltauswirkungen des gesamten<br />
Lebensweges, also der Anbau der pflanzlichen<br />
Rohstoffe, die Produktion der Aminosäuren,<br />
die Mischfutterherstellung sowie<br />
die Stallhaltung der konventionellen<br />
Landwirtschaft in Deutschland bzw. Europa<br />
(Abb. 2). Als wesentliche Faktoren<br />
der Auswirkungen auf Umwelt und Klima<br />
wurden folgende Indikatoren ermittelt<br />
und miteinander verglichen: Treibhauseffekt,<br />
Versauerungspotenzial, Eutrophierungspotenzial,<br />
Primärenergiebedarf,<br />
Ressourcenverbrauch und Landnutzungsänderungen.<br />
Ergebnisse der Ökobilanz<br />
Der Treibhauseffekt wird hauptsächlich<br />
durch die Schadgase Kohlendioxid (CO 2 ),<br />
Lachgas (N 2 O) und Methan (CH 4 ) verursacht,<br />
wobei bei den hier betrachteten<br />
Szenarien der Schweinemast CO 2 und N 2 O<br />
von vorrangiger Bedeutung sind. Methan<br />
als Klimagas spielt vor allem in der Rinderzucht<br />
eine wesentliche Rolle.<br />
Der Vergleich der drei Futtermischungen<br />
zeigt: Während die Option 1 mit zugesetzten<br />
Aminosäuren nur rund 5 kg<br />
CO 2 Äquivalente je funktionelle Einheit<br />
(kg CO 2 e/fE) zum Treibhauspotenzial beiträgt,<br />
liegen die Emissionen der Optionen<br />
2 und 3 mit 25 bzw. 8 kg CO 2e/fE deutlich<br />
höher (Abb. 3). Für den höheren Treibhauseffekt<br />
der Futtermischungen 2 und 3<br />
sind insbesondere die Lachgasemissionen<br />
der Ölsaatenanteile im Futter und bei der<br />
Ausbringung der Gülle als Wirtschaftsdünger<br />
verantwortlich.<br />
Versauerungs und Eutrophierungspotenzial<br />
sind zwei Faktoren, die die Ausbreitung<br />
von großflächigen Waldschäden<br />
– bekannt als „Waldsterben“ – beschleunigen.<br />
Beide Indikatoren werden hauptsächlich<br />
bestimmt durch Stickstoffemissionen<br />
aus dem Anbau der einzelnen Futtermittelkomponenten.<br />
Somit ist es nicht<br />
erstaunlich, dass der erhöhte Anteil an Ölsaaten<br />
in den Optionen 2 und 3 ein deutlich<br />
höheres Versauerungspotenzial zur<br />
Folge hat als bei Option 1: Die Futtermischung<br />
mit den supplementierten Aminosäuren<br />
hat ein Versauerungspotenzial von<br />
nur 0,1 kg SO2e/fE (gemessen als Menge<br />
SchwefeldioxidÄquivalent pro funktioneller<br />
Einheit) und liegt damit um den<br />
Faktor 12 bzw. 13 niedriger als die beiden<br />
ölsaatenreichen Alternativen (Abb. 4).<br />
Ähnlich deutlich ist das Ergebnis beim<br />
Euthropierungspotenzial (Abb. 5). Düngemittelinhaltsstoffe<br />
wie Nitrat und Phosphat<br />
sind Ursache für die Überdüngung von<br />
Gewässern, die zu Sauerstoffmangel und<br />
im Endstadium zum Absterben von Tieren<br />
und Pflanzen in Oberflächengewässern<br />
führen (Eutrophierung). Option 1 schneidet<br />
mit nur 0,022 kg PO4e/fE (gemessen<br />
in PhosphatÄquivalent pro funktionelle<br />
Einheit) gegenüber 0,357 kg PO4e/fE für<br />
die Optionen 2 und 3 weit besser ab. Dies<br />
bedeutet ein rund 16faches Entlastungspotenzial<br />
durch die Supplementierung mit<br />
Aminosäuren.<br />
Ein zentraler Indikator ist der Primärenergiebedarf<br />
der verschiedenen Optionen.<br />
Bei diesem Indikator ist die Diskrepanz<br />
der Ergebnisse nicht so augenfällig.<br />
Der Energiebedarf der Option 1 ist mit 154<br />
MJ/fE (gemessen in Megajoule pro funktioneller<br />
Einheit) annähernd so groß wie<br />
für die Option 2 mit rund 148 MJ/fE. Option<br />
3 enthält einen erhöhten Anteil 333<br />
<strong>elements33</strong> Ausgabe 4|2010