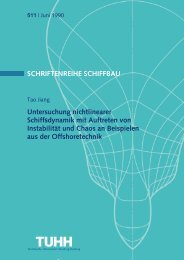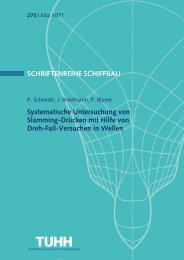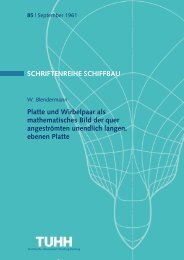spektrum_201310.pdf (11.592 KB) - TUHH
spektrum_201310.pdf (11.592 KB) - TUHH
spektrum_201310.pdf (11.592 KB) - TUHH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
44 Bionik Forschung<br />
Die Natur als Vorbild<br />
Die Bionik hat sich als interdisziplinäres Forschungsgebiet einen festen Platz in der Wissenschaft erobert,<br />
interessant für Naturwissenschaftler, Architekten, Philosophen, Soziologen, Designer und vor allem Ingenieure.<br />
Auch Wissenschaftler der TU Hamburg holen sich für ihre neuen Technologien Anleihen aus Flora und Fauna. Was<br />
man vom Kongo-Rosenkäfer und Gecko, Bambusstängel und Zahnschmelz lernen kann, darüber berichtet<br />
Birk Grüling im folgenden Beitrag.<br />
Käfergelenke als Vorbild<br />
Der Kongo-Käfer ist ein eher durchschnittlicher<br />
Vertreter seiner Gattung.<br />
Er besitzt keine besonderen<br />
Eigenschaften, die Biologen verzücken<br />
könnten. Auch vom Aussterben ist der<br />
Pachnoda marginata nicht bedroht. Nur<br />
Terrarien-Freunde benutzen die Larven<br />
des kaum 25 Millimeter großen Käfers zur<br />
Fütterung ihrer Reptilien. „Der Käfer ist<br />
anatomisch nicht auffällig und leicht zu<br />
züchten, für unsere Forschung sind das<br />
gute Voraussetzungen“, sagt Steffen Vagts,<br />
Ingenieur in der Arbeitsgruppe für Anlagensystemtechnik<br />
und methodische Produktentwicklung<br />
unter Leitung von<br />
Professor Josef Schlattmann. Im Fokus der<br />
TU-Wissenschaftler stehen die Gelenke<br />
dieses Käfers, der – wie der Name es sagt<br />
– im Kongo, aber auch anderen Gebieten<br />
Zentral-und Westafrikas zu Hause ist.<br />
Alle Insekten haben sechs Beine mit je fünf<br />
Gliedern, die durch Gelenke miteinander<br />
verbunden sind. Die Hüfte ist dabei direkt<br />
mit dem Körper verwachsen, danach folgen<br />
drei unterschiedlich lange, bewegliche<br />
Teile – der Schenkelring, der Schenkel und<br />
die Schiene – das Bein endet schließlich<br />
im Fuß. Ihre Beine nutzen die Insekten<br />
nicht nur zum Laufen, sondern auch zum<br />
Schwimmen, Graben, Springen oder dem<br />
Einsammeln von Nahrung. „Über die mechanischen<br />
und vor allem tribologischen<br />
Funktionsweisen der Gelenke wissen wir<br />
bisher nur wenig. Für die Technik ist die Erforschung<br />
sehr interessant“, sagt Vagts.<br />
Denn in der Wissenschaft geht man davon<br />
aus, dass die Insektengelenke – anders als<br />
beim Menschen – mit trockener Reibung<br />
funktionieren – also ohne Knorpel und<br />
Gelenkflüssigkeit sowie ohne größeren<br />
Verschleiß durch Reibung. Um dem Geheimnis<br />
des Käfergelenks auf die Spur zu<br />
kommen, arbeiten Vagts und seine Kollegen<br />
mit Biologen der Christian-Albrechts-<br />
Universität Kiel zusammen. Im Labor<br />
werden die Käfer-Gelenke auf bis zu 30<br />
verschiedene Parameter analysiert. „Langfristig<br />
wollen wir auf Basis dieser Erkenntnisse<br />
auch Produkte entwickeln“, sagt<br />
Vagts. Eine mögliche Anwendung könnte<br />
zum Beispiel im Fahrzeugbau liegen: So hat<br />
die Einzelradaufhängung eines PKW<br />
mehrere Kugelgelenke, die nur<br />
durch den Einsatz von – auf<br />
der Basis von Erdöl gewonnenen<br />
– Schmiermitteln<br />
funktionieren.<br />
Optimierung in der<br />
Natur<br />
Jedes Kilogramm eines Flugzeugs kostet<br />
Kerosin und damit Geld. Mit entsprechend<br />
viel Ehrgeiz suchen Forscher und<br />
Flugzeughersteller nach Wegen, das Gewicht<br />
der Flieger zu reduzieren. Ein Vorbild<br />
ist ihnen dabei auch die Natur. „Ob bei<br />
Pflanzen oder Tieren, es wird stets nur so<br />
viel an ‚Material‘ eingesetzt, wie es nötig<br />
ist. Davon kann man lernen“, sagt Professor<br />
Claus Emmelmann. Besonders interessant<br />
für den Leiter des Instituts für Laserund<br />
Anlagensystemtechnik sind Knochen,<br />
Bambus und Seerosenstängel: Sie sind extrem<br />
leicht, innen hohl und trotzdem sehr<br />
stabil. Diese Eigenschaften sind millionenfach<br />
erprobt, ihren Machbarkeitstest<br />
haben die Pflanzen längst bestanden. Wie<br />
weit die Natur der Technik voraus ist, wird<br />
auch im folgenden Beispiel sehr deutlich.<br />
In einem Kooperationsprojekt mit dem<br />
Flugzeughersteller Airbus untersuchten<br />
Emmelmann und sein Team eine ganze<br />
Reihe nicht tragender Teile eines Flugzeugs,<br />
beispielsweise Halterungen oder<br />
Gepäckablagen. „Wir berechneten mit<br />
Hilfe der Finite-Elemente-Methode die<br />
maximale Belastung, denen diese Teile ausgesetzt<br />
sind und konstruierten dementsprechend<br />
und nach dem aktuellen Stand<br />
der Technik neu“, beschreibt Emmelmann.<br />
Als nächstes verglichen die Wissenschaftler<br />
ihre neuen Konstruktionen mit Struk-