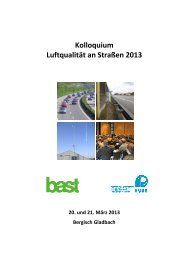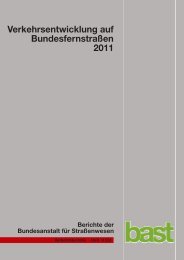Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
18<br />
lern (WIERWILLE & ELLSWORTH 1994; KAIDA et<br />
al. 2007; PHILIP et al. 2005; ARNEDT et al. 2005).<br />
Angewendet werden die genannten Verfahren der<br />
Testperformanz auch bei einer Begutachtung zur<br />
Diagnose von Tagesschläfrigkeit.<br />
Zielt die Anwendung auf die Beurteilung der Fahr-<br />
(und Bedien-)tüchtigkeit im betrieblichen Arbeitsumfeld<br />
ab, spricht man von testperformanzbasierten<br />
Verfahren als Fitness-for-Duty-Tests (kurz:<br />
FFD). Am gebräuchlichsten ist die Verwendung<br />
von FFD (synonym auch Readiness to Perform)<br />
bei Operateuren und Maschinenführern. Oft werden<br />
einfache Wahlreaktionsaufgaben simultan zur<br />
Bedientätigkeit dargeboten. Einen Überblick über<br />
bestehende Verfahren liefert Kapitel 4. Die Anwendung<br />
im realen Straßenverkehr ist aufgrund der<br />
Interferenz mit der Fahraufgabe kritisch zu bewerten.<br />
Neben objektiven Leistungsmaßen werden<br />
auch Checklisten und Selbstbeurteilungsverfahren<br />
als FFD eingesetzt. Doch nur bei objektiven<br />
Leistungsmaßen ist eine Manipulation der Ergebnisse<br />
in Richtung eines wacheren Zustands ausgeschlossen.<br />
Als Nachteil der testdiagnostischen Verfahren wird<br />
neben der mangelnden Spezifität (Ablenkung,<br />
mangelnde Leistungsmotivation, Alkohol) v. a. die<br />
Reaktivität ins Feld geführt. Die Aufgabenbearbeitung<br />
reduziert die Monotonie und führt somit zu<br />
besseren Leistungen.<br />
Fazit<br />
Bei einer Anwendung außerhalb der Fahrsituation<br />
weist eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabentypen<br />
und Leistungsgrößen müdigkeitsbedingte<br />
Veränderungen auf. Aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit<br />
der Studien und der Abhängigkeit von<br />
den jeweiligen kognitiven Anforderungen verschiedener<br />
Fahrtsituation sind keine abschließenden<br />
Aussagen möglich, welche Modalität (visuell vs.<br />
akustisch) oder Aufgabenkomplexität (gering vs.<br />
hoch) besonders geeignet zur Müdigkeitserfassung<br />
ist. Bei Fitness-for-Duty-Tests werden zumeist Verfahren<br />
mit einer geringen Reaktivität (einfache<br />
Wahlreaktions- und Vigilanzaufgaben) bevorzugt.<br />
Wie bei allen Verfahren ist davon auszugehen,<br />
dass eine längere Testdauer die Testgüte verbessert.<br />
Als Nachteil erweisen sich die geringe Spezifität,<br />
da neben Müdigkeit auch andere Faktoren die<br />
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können, die bereits<br />
diskutierte Reaktivität und die eingeschränkte<br />
Anwendbarkeit während der Fahraufgabe.<br />
Ein vorgeschriebener Einsatz von Fitness-for-<br />
Duty-Tests während der Teilnahme am Straßenverkehr<br />
ist wegen der Interferenz mit der Fahraufgabe<br />
nicht zu empfehlen. Zu Forschungszwecken hingegen<br />
ist die selbstbestimmte Bearbeitung einfacher<br />
akustischer Nebenaufgaben vertretbar.<br />
3.5 Physiologische Messverfahren<br />
3.5.1 Augenaktivität<br />
<strong>Das</strong> am weitesten verbreitete Verfahren zur Erfassung<br />
von Müdigkeit beruht auf der Erfassung der<br />
Augenaktivität. Im Großen und Ganzen lassen<br />
sich zwei Verfahrensklassen unterscheiden:<br />
• Die Erfassung des Lidschlussverhaltens über<br />
das Elektrookulogramm (EOG) oder kamerabasierte<br />
Systeme. Mit steigender Müdigkeit nehmen<br />
die Phasen des Lidschlusses an Dauer zu<br />
und an Geschwindigkeit und Amplitude (Augenöffnungsgrad)<br />
ab. Die Frequenz der Lidschlüsse<br />
binnen eines gesetzten Zeitraums weist<br />
einen umgekehrt u-förmigen Verlauf auf, sie<br />
steigt mit aufkommender Müdigkeit und fällt bei<br />
hoher Müdigkeit wieder ab.<br />
• Die Erfassung des Blickverhaltens über spezielle<br />
Eyetrackingsysteme, die Merkmale des<br />
Blickverlaufs abbilden. Aufgezeichnet werden<br />
das Verharren des Blicks auf einer bestimmten<br />
Stelle (Fixationen) und die Blicksprünge (Sakkaden),<br />
die den Blick neu ausrichten. Belege<br />
für müdigkeitsbedingte Veränderungen liegen<br />
für unterschiedliche Merkmale der Sakkaden<br />
vor.<br />
Nachfolgend werden die unterschiedlichen Müdigkeitsindikatoren<br />
des Lidschlusses und des Blickverhaltens<br />
kurz vorgestellt.<br />
Lidschlussverhalten<br />
Lidschläge lassen sich nach ihren zeitlichen<br />
Abläufen in verschiedene Phasen einteilen, die<br />
müdigkeitsbedingte Veränderungen zeigen (vgl.<br />
Bild 2).<br />
Die Lidschlussdauer nimmt mit steigender Müdigkeit<br />
zu (CAFFIER et al. 2003; PAPADELIS et al.<br />
2007; ANUND 2009; SCHLEICHER et al. 2008).<br />
Von allen Parametern des Lidschlussverhaltens ist<br />
die Lidschlussdauer der wohl meistverwendete<br />
und vielleicht valideste Indikator für Müdigkeit.