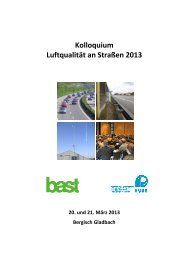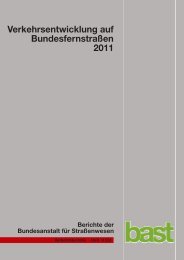Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
44<br />
Weiterhin genannt wurden:<br />
• Time on Task (1 x),<br />
• phonetische Stimmmerkmale (1 x),<br />
• periphere Hauttemperatur (1 x),<br />
• Vigilanz- und Daueraufmerksamkeitstests (1 x).<br />
Time on Task ist unstrittig ein hochvalides Anzeichen<br />
für das Vorliegen der Fahrermüdigkeit. Da jedoch<br />
keine Erfassung der Müdigkeit oder Müdigkeitsfolgen<br />
erfolgt, ist eine entsprechende Kategorisierung<br />
als Messverfahren fraglich. Die fehlende<br />
Passung zum vorgegebenen Auswahlschema mag<br />
daher die nur einmalige Nennung erklären. Auf nur<br />
einmalig genannte Messverfahren wird in der folgenden<br />
Ergebnisdarstellung nicht weiter eingegangen.<br />
Ein Überblick über die peripherphysiologischen<br />
bzw. testperformanzbasierten Verfahren findet<br />
sich in den Kapiteln 3.4.3 und 3.5.3.<br />
Die absolute Häufigkeit der Nennungen vermittelt<br />
einen ersten Eindruck über die Validität der genannten<br />
Verfahren. Da es Bedingung war, maximal<br />
ein Messverfahren je Kategorie (Fahrperformanz,<br />
Verhaltensbeobachtung, Testperformanz, Lidschlussverhalten,<br />
EEG und Peripherphysiologie)<br />
auszuwählen, kann die getroffene Auswahl von der<br />
vorgegebenen Kategorisierung der Messverfahren<br />
beeinflusst worden sein. So ist es durchaus denkbar,<br />
dass eine Zusammenfassung von EEG und peripherphysiologischen<br />
Verfahren in eine Kategorie<br />
„Physiologie“ die Anzahl der Nennungen des EEG<br />
auf Kosten der Pupillografie erhöht hätte (oder umgekehrt).<br />
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Bewertung<br />
der sechs Messverfahren aus Delphi-Runde 1 und 2<br />
(kurz für Delphi-Runde 1 und 2: DEL) und dem Expertenworkshop<br />
(kurz: WS) vorgestellt. Die im Workshop<br />
diskutierten und bei Bedarf modifizierten Güteprofile<br />
zeigen Tabelle 9 bis Tabelle 14. Die Bewertungen<br />
beider Delphi-Runden mit Median und Spanne<br />
der Beurteilungen finden sich in Kapitel 6.3.3.<br />
6.3.1 Lenkverhalten<br />
Sechs der zwölf Experten wählten das Lenkverhalten<br />
als eines der drei validesten Müdigkeitsmessverfahren.<br />
Häufiger genannt wurde nur das Lidschlussverhalten<br />
(8 x). Auf die operationalisierende<br />
Beschreibung verzichteten drei, die verbleibenden<br />
nannten:<br />
• „Lenkwinkeländerungen“ (2 x),<br />
• „Standardabweichung des Betrags der Lenkwinkelgeschwindigkeit“<br />
(1 x).<br />
Messgüte<br />
Die Reliabilität der Müdigkeitserfassung gilt wie bei<br />
allen anderen in der Delphi-Studie diskutierten Müdigkeitsmessverfahren<br />
als „eher“ gegeben, sofern<br />
ein „adäquater Algorithmus“ verwendet und der<br />
„Kontext der Erfassung“ berücksichtigt wird. <strong>Das</strong><br />
bezieht sich insbesondere auf die Differenzierung<br />
unterschiedlicher Fahrzeugtypen – bei Pkw-<br />
Fahrern sieht man schnelle Lenkbewegungen,<br />
während Lkw-Fahrer zu pendeln beginnen [WS].<br />
Die Erkennung beginnender Müdigkeit ist hingegen<br />
nur eingeschränkt gewährleistet, das mit „aktuellen<br />
Algorithmen erkennbare“ Lenkverhalten ändert sich<br />
erst bei starker Müdigkeit [DEL]. Dies beeinträchtigt<br />
zwangsläufig auch die Güte der Differenzierung<br />
von beginnender und schwerer Müdigkeit. Zusätzlich<br />
erschwert wird diese durch die „Plateauphase“<br />
bei Veränderungen im Lenkverhaltens, innerhalb<br />
derer sich verschiedene Müdigkeitsausprägungen<br />
schwer differenzieren lassen [WS]. Da Fahrbahnunebenheiten<br />
oder Seitenwind ähnliche Lenkmuster<br />
erzeugen, wie man sie von müden Fahrern<br />
kennt [DEL], ist die Spezifität eher mäßig. Immerhin<br />
zeigt sich das Lenkverhalten im Vergleich als merklich<br />
spezifischer als z. B. die Spurposition, nach der<br />
bspw. auch ein mäßiger Alkoholkonsum (BAK<br />
=< 0.05 %) ein der Müdigkeit vergleichbares Ergebnismuster<br />
aufweist (BROOKHUIS & de WAARD<br />
1993).<br />
Validität<br />
Die Kriteriumsvalidität und die externe Validität sind<br />
– soweit das angesichts des globalen Problems des<br />
„fehlenden Goldstandards“ beurteilbar ist [WS] –<br />
nach Expertensicht eher gegeben (vgl. auch<br />
BROOKHUIS & de WAARD 1993). Hingegen gilt<br />
die Generalisierbarkeit der Messwerte aufgrund<br />
inter- und intraindividueller Schwankungen [WS] lediglich<br />
als „etwas“ erfüllt, d. h., gleiche Messwerte<br />
gehen nicht mit einem vergleichbaren Ausmaß an<br />
Müdigkeit einher. Daher ist eine „Ausgangswertadaption<br />
erforderlich“ [DEL]. Dies ist wohl einer der<br />
Gründe für das Fehlen akzeptierter Grenzwerte, ab<br />
denen eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr<br />
fraglich wäre. Ein anderer, nicht weniger gewichtiger,<br />
liegt in der Abhängigkeit der Lenkwinkelparameter<br />
von dem gefahrenen Fahrzeug – und hier