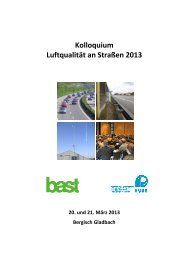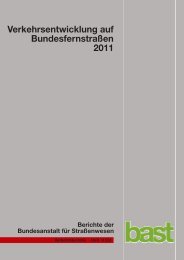Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
22<br />
Dies beeinträchtigt die Aussagekraft der EDA-<br />
Werte gerade bei der Anwendung außerhalb eines<br />
kontrollierten Settings erheblich.<br />
Änderungen der zentralnervösen Aktivierung spiegeln<br />
sich auch in Veränderungen der Pupille wider.<br />
Bei Müdigkeit nehmen der Pupillendurchmesser<br />
ab und die Latenz der Kontraktion zu (SIREVAAG;<br />
RUSSO et al. 1999). Problematisch ist die hohe<br />
Beeinflussbarkeit pupillografischer Indikatoren<br />
durch Licht, Beanspruchung oder Langeweile.<br />
Eine standardisierte Erfassung pupillografischer<br />
Maße in einem von äußeren Störeinflüssen abgeschotteten<br />
Setting ermöglicht der Pupillografische<br />
Schläfrigkeitstest (PST). Auf dieses Testverfahren<br />
wird im folgenden Unterkapitel umfassend<br />
eingegangen, da er aus Expertensicht das valideste<br />
peripherphysiologische Messverfahren darstellt<br />
und im Rahmen der Delphi-Studie (siehe Kapitel<br />
6.3.6) seine Mess- und Testgüte kontrovers diskutiert<br />
wurden.<br />
Einen interessanten Forschungsansatz stellt die Erfassung<br />
kognitiv-physiologischer Sprachveränderungen<br />
(Artikulation, Atmung, Stimm- und Lautbildung)<br />
infolge von Müdigkeit dar. Erste Studien<br />
sprechen für eine hohe Klassifikationsgüte<br />
wacher und müder Probanden von bis zu 86 %<br />
(KRAJEWSKI et al. 2009). Die Autoren beschreiben<br />
das Verfahren als robust gegen Umgebungsbedingungen<br />
wie Feuchtigkeit, Temperatur und Vibrationen<br />
bei einer kontaktfreien und nicht intrusiven<br />
Messung (KRAJEWSKI et al. 2009). Allerdings<br />
zeigte sich, dass die Müdigkeitserkennung durch<br />
ein Training der Stimme beeinträchtigt werden kann<br />
(BAGNALL et al. 2011). Für eine umfassende Beurteilung<br />
ist es verfrüht, doch scheint der gewählten<br />
Ansatz vielversprechend.<br />
Zu weiteren müdigkeitsbedingten physiologischen<br />
Veränderungen gehören<br />
• das Absinken der Körperkerntemperatur bei<br />
gleichzeitigem Anstieg der peripheren Temperatur<br />
(van den HEUVEL et al. 1998),<br />
• der Anstieg des Melatonin-Levels (LOWDEN<br />
et al. 2004),<br />
• das Absinken des Blutdrucks (MALIK et al.<br />
1996),<br />
• die Abnahme der Atmungsfrequenz (DUREMAN<br />
& BODÉÉN 1972),<br />
• der Anstieg des Ptyalinspiegels (YAMAGUCHI<br />
et al. 2006).<br />
Fazit<br />
In ihrer Validität bleiben peripherphysiologische<br />
und endokrinologische Maße größtenteils hinter<br />
anderen Messverfahren zurück. Dies ist insbesondere<br />
darauf zurückzuführen, dass viele gerade im<br />
Feld nicht kontrollierbare Faktoren (Temperatur,<br />
Bewegung, Licht, Nahrungsaufnahme, Stress, Beanspruchung<br />
etc.) die Messgrößen stark beeinflussen.<br />
Bei einigen Messverfahren ist die Erfassung<br />
außerhalb eines Laborsettings (z. B. Melatonin,<br />
Cortisol, Ptyalin) kaum denkbar. Zumindest<br />
gängigere Maße wie z. B. die Herzrate und die<br />
Herzratenvariabilität zeigen auch bei den (generell)<br />
seltenen Studien im realen Straßenverkehr<br />
müdigkeitsbedingte Veränderungen. Auch scheint<br />
nach ersten Erkenntnissen durch die Analyse<br />
müdigkeitsbedingter Sprachveränderung eine<br />
vergleichsweise robuste und nichtintrusive<br />
Anwendbarkeit während der Fahrt möglich. Doch<br />
liegen zu Letzterem noch zu wenige Erkenntnisse<br />
vor, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Die<br />
hier aufgeführten physiologischen Verfahren<br />
können als zusätzliche Indikatoren die Müdigkeitsdetektion<br />
durch andere, spezifischere Müdigkeitsmessverfahren<br />
ergänzen. Von einer ausschließlichen<br />
Verwendung peripherphysiologischer<br />
Maße ist abzuraten.<br />
Pupillografischer Schläfrigkeitstest (PST)<br />
Der PST erfasst die spontanen Pupillenschwankungen,<br />
die infolge der abnehmenden zentralnervösen<br />
Aktivierung bei erhöhter Müdigkeit unter<br />
Ausschluss von Lichteinfall auftreten. <strong>Das</strong> Ausmaß<br />
der Schwankungen über die bislang noch elfminütige<br />
Messzeit wird über das Amplitudenspektrum<br />
in Hz und den Pupillenunruheindex (PUI) in<br />
mm quantifiziert. Die Messung erfolgt in absoluter<br />
Dunkelheit, der Kopf wird mithilfe einer Kinnstütze<br />
fixiert, und die Aufgabe des Probanden besteht<br />
darin, während der elfminütigen Messung einen<br />
leuchtenden Punkt zu fixieren. Entwickelt und vorrangig<br />
eingesetzt wurde der PST zur Erfassung<br />
der Tagesschläfrigkeit. Er differenziert zwischen<br />
gesunden und schlafkranken (Hypersomnikern,<br />
Probanden mit hoher Tagesschläfrigkeit) Probanden,<br />
wobei Letztere signifikant höhere Werte des<br />
Amplitudenspektrums und des PUI aufwiesen<br />
(WILHELM et al. 1998b; WILHELM et al. 1998a).<br />
Auch Korrelationen zu Selbstbeurteilungsverfahren<br />
(ca. r = .3) und videobasierten Expertenratings<br />
sind belegt (WILHELM 2007; SCHNIEDER et al.<br />
2012).