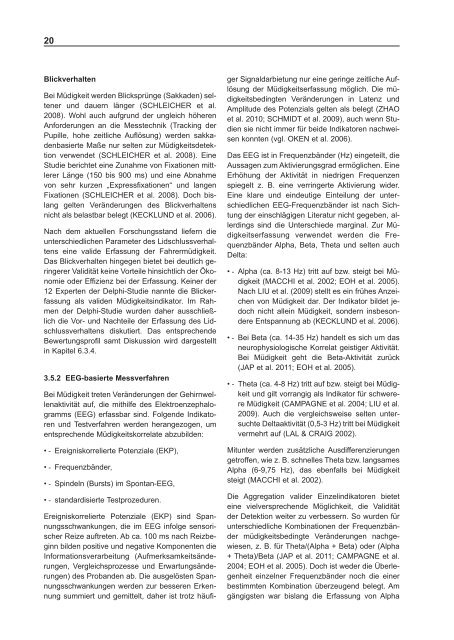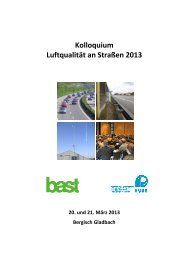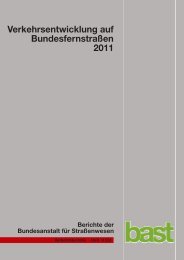Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20<br />
Blickverhalten<br />
Bei Müdigkeit werden Blicksprünge (Sakkaden) seltener<br />
und dauern länger (SCHLEICHER et al.<br />
2008). Wohl auch aufgrund der ungleich höheren<br />
Anforderungen an die Messtechnik (Tracking der<br />
Pupille, hohe zeitliche Auflösung) werden sakkadenbasierte<br />
Maße nur selten zur Müdigkeitsdetektion<br />
verwendet (SCHLEICHER et al. 2008). Eine<br />
Studie berichtet eine Zunahme von Fixationen mittlerer<br />
Länge (150 bis 900 ms) und eine Abnahme<br />
von sehr kurzen „Expressfixationen“ und langen<br />
Fixationen (SCHLEICHER et al. 2008). Doch bislang<br />
gelten Veränderungen des Blickverhaltens<br />
nicht als belastbar belegt (KECKLUND et al. 2006).<br />
Nach dem aktuellen Forschungsstand liefern die<br />
unterschiedlichen Parameter des Lidschlussverhaltens<br />
eine valide Erfassung der Fahrermüdigkeit.<br />
<strong>Das</strong> Blickverhalten hingegen bietet bei deutlich geringerer<br />
Validität keine Vorteile hinsichtlich der Ökonomie<br />
oder Effizienz bei der Erfassung. Keiner der<br />
12 Experten der Delphi-Studie nannte die Blickerfassung<br />
als validen Müdigkeitsindikator. Im Rahmen<br />
der Delphi-Studie wurden daher ausschließlich<br />
die Vor- und Nachteile der Erfassung des Lidschlussverhaltens<br />
diskutiert. <strong>Das</strong> entsprechende<br />
Bewertungsprofil samt Diskussion wird dargestellt<br />
in Kapitel 6.3.4.<br />
3.5.2 EEGbasierte Messverfahren<br />
Bei Müdigkeit treten Veränderungen der Gehirnwellenaktivität<br />
auf, die mithilfe des Elektroenzephalogramms<br />
(EEG) erfassbar sind. Folgende Indikatoren<br />
und Testverfahren werden herangezogen, um<br />
entsprechende Müdigkeitskorrelate abzubilden:<br />
• Ereigniskorrelierte Potenziale (EKP),<br />
• Frequenzbänder,<br />
• Spindeln (Bursts) im Spontan-EEG,<br />
• standardisierte Testprozeduren.<br />
Ereigniskorrelierte Potenziale (EKP) sind Spannungsschwankungen,<br />
die im EEG infolge sensorischer<br />
Reize auftreten. Ab ca. 100 ms nach Reizbeginn<br />
bilden positive und negative Komponenten die<br />
Informationsverarbeitung (Aufmerksamkeitsänderungen,<br />
Vergleichsprozesse und Erwartungsänderungen)<br />
des Probanden ab. Die ausgelösten Spannungsschwankungen<br />
werden zur besseren Erkennung<br />
summiert und gemittelt, daher ist trotz häufiger<br />
Signaldarbietung nur eine geringe zeitliche Auflösung<br />
der Müdigkeitserfassung möglich. Die müdigkeitsbedingten<br />
Veränderungen in Latenz und<br />
Amplitude des Potenzials gelten als belegt (ZHAO<br />
et al. 2010; SCHMIDT et al. 2009), auch wenn Studien<br />
sie nicht immer für beide Indikatoren nachweisen<br />
konnten (vgl. OKEN et al. 2006).<br />
<strong>Das</strong> EEG ist in Frequenzbänder (Hz) eingeteilt, die<br />
Aussagen zum Aktivierungsgrad ermöglichen. Eine<br />
Erhöhung der Aktivität in niedrigen Frequenzen<br />
spiegelt z. B. eine verringerte Aktivierung wider.<br />
Eine klare und eindeutige Einteilung der unterschiedlichen<br />
EEG-Frequenzbänder ist nach Sichtung<br />
der einschlägigen Literatur nicht gegeben, allerdings<br />
sind die Unterschiede marginal. Zur Müdigkeitserfassung<br />
verwendet werden die Frequenzbänder<br />
Alpha, Beta, Theta und selten auch<br />
Delta:<br />
• Alpha (ca. 8-13 Hz) tritt auf bzw. steigt bei Müdigkeit<br />
(MACCHI et al. 2002; EOH et al. 2005).<br />
Nach LIU et al. (2009) stellt es ein frühes Anzeichen<br />
von Müdigkeit dar. Der Indikator bildet jedoch<br />
nicht allein Müdigkeit, sondern insbesondere<br />
Entspannung ab (KECKLUND et al. 2006).<br />
• Bei Beta (ca. 14-35 Hz) handelt es sich um das<br />
neurophysiologische Korrelat geistiger Aktivität.<br />
Bei Müdigkeit geht die Beta-Aktivität zurück<br />
(JAP et al. 2011; EOH et al. 2005).<br />
• Theta (ca. 4-8 Hz) tritt auf bzw. steigt bei Müdigkeit<br />
und gilt vorrangig als Indikator für schwerere<br />
Müdigkeit (CAMPAGNE et al. 2004; LIU et al.<br />
2009). Auch die vergleichsweise selten untersuchte<br />
Deltaaktivität (0,5-3 Hz) tritt bei Müdigkeit<br />
vermehrt auf (LAL & CRAIG 2002).<br />
Mitunter werden zusätzliche Ausdifferenzierungen<br />
getroffen, wie z. B. schnelles Theta bzw. langsames<br />
Alpha (6-9,75 Hz), das ebenfalls bei Müdigkeit<br />
steigt (MACCHI et al. 2002).<br />
Die Aggregation valider Einzelindikatoren bietet<br />
eine vielversprechende Möglichkeit, die Validität<br />
der Detektion weiter zu verbessern. So wurden für<br />
unterschiedliche Kombinationen der Frequenzbänder<br />
müdigkeitsbedingte Veränderungen nachgewiesen,<br />
z. B. für Theta/(Alpha + Beta) oder (Alpha<br />
+ Theta)/Beta (JAP et al. 2011; CAMPAGNE et al.<br />
2004; EOH et al. 2005). Doch ist weder die Überlegenheit<br />
einzelner Frequenzbänder noch die einer<br />
bestimmten Kombination überzeugend belegt. Am<br />
gängigsten war bislang die Erfassung von Alpha