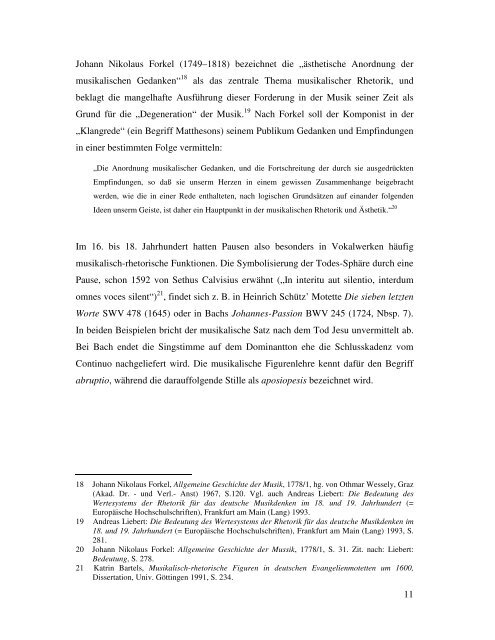Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Johann Nikolaus Forkel (1749–1818) bezeichnet die „ästhetische Anordnung der<br />
musikalischen Gedanken“ 18 als das zentrale Thema musikalischer Rhetorik, und<br />
beklagt die mangelhafte Ausführung dieser Forderung in der Musik seiner Zeit als<br />
Grund für die „Degeneration“ der Musik. 19 Nach Forkel soll der Komponist in der<br />
„Klangrede“ (ein Begriff Matthesons) seinem Publikum Gedanken und Empfindungen<br />
in einer bestimmten Folge vermitteln:<br />
„Die Anordnung musikalischer Gedanken, und die Fortschreitung der durch sie ausgedrückten<br />
Empfindungen, so daß sie unserm Herzen in einem gewissen Zusammenhange beigebracht<br />
werden, wie die in einer Rede enthalteten, nach logischen Grundsätzen auf einander folgenden<br />
Ideen unserm Geiste, ist daher ein Hauptpunkt in der musikalischen Rhetorik und Ästhetik.“ 20<br />
Im 16. bis 18. Jahrhundert hatten Pausen also besonders in Vokalwerken häufig<br />
musikalisch-rhetorische Funktionen. Die Symbolisierung der Todes-Sphäre durch eine<br />
Pause, schon 1592 von Sethus Calvisius erwähnt („In interitu aut silentio, interdum<br />
omnes voces silent“) 21 , findet sich z. B. in Heinrich Schütz’ Motette Die sieben letzten<br />
Worte SWV 478 (1645) oder in Bachs Johannes-Passion BWV 245 (1724, Nbsp. 7).<br />
In beiden Beispielen bricht der musikalische Satz nach dem Tod Jesu unvermittelt ab.<br />
Bei Bach endet die Singstimme auf dem Dominantton ehe die Schlusskadenz vom<br />
Continuo nachgeliefert wird. Die musikalische Figurenlehre kennt dafür den Begriff<br />
abruptio, während die darauffolgende Stille als aposiopesis bezeichnet wird.<br />
18 Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 1778/1, hg. von Othmar Wessely, <strong>Graz</strong><br />
(Akad. Dr. - und Verl.- Anst) 1967, S.120. Vgl. auch Andreas Liebert: Die Bedeutung des<br />
Wertesystems der Rhetorik für das deutsche Musikdenken im 18. und 19. Jahrhundert (=<br />
Europäische Hochschulschriften), Frankfurt am Main (Lang) 1993.<br />
19 Andreas Liebert: Die Bedeutung des Wertesystems der Rhetorik für das deutsche Musikdenken im<br />
18. und 19. Jahrhundert (= Europäische Hochschulschriften), Frankfurt am Main (Lang) 1993, S.<br />
281.<br />
20 Johann Nikolaus Forkel: Allgemeine Geschichte der Mussik, 1778/1, S. 31. Zit. nach: Liebert:<br />
Bedeutung, S. 278.<br />
21 Katrin Bartels, Musikalisch-rhetorische Figuren in deutschen Evangelienmotetten um 1600,<br />
Dissertation, Univ. Göttingen 1991, S. 234.<br />
11