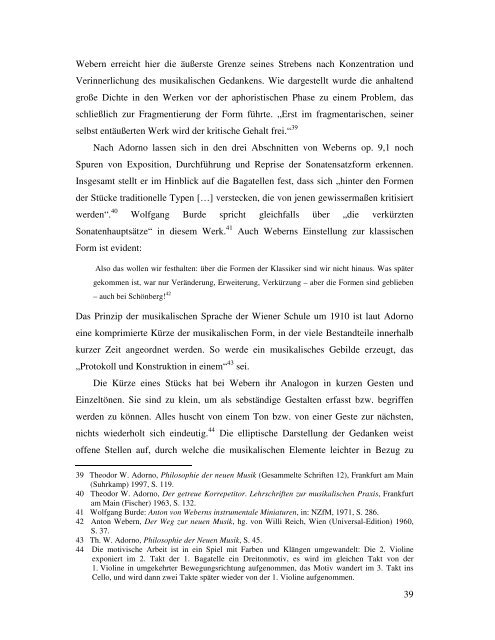Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Volltext - Musiktheorie / Musikanalyse - Kunstuniversität Graz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Webern erreicht hier die äußerste Grenze seines Strebens nach Konzentration und<br />
Verinnerlichung des musikalischen Gedankens. Wie dargestellt wurde die anhaltend<br />
große Dichte in den Werken vor der aphoristischen Phase zu einem Problem, das<br />
schließlich zur Fragmentierung der Form führte. „Erst im fragmentarischen, seiner<br />
selbst entäußerten Werk wird der kritische Gehalt frei.“ 39<br />
Nach Adorno lassen sich in den drei Abschnitten von Weberns op. 9,1 noch<br />
Spuren von Exposition, Durchführung und Reprise der Sonatensatzform erkennen.<br />
Insgesamt stellt er im Hinblick auf die Bagatellen fest, dass sich „hinter den Formen<br />
der Stücke traditionelle Typen […] verstecken, die von jenen gewissermaßen kritisiert<br />
werden“. 40 Wolfgang Burde spricht gleichfalls über „die verkürzten<br />
Sonatenhauptsätze“ in diesem Werk. 41 Auch Weberns Einstellung zur klassischen<br />
Form ist evident:<br />
Also das wollen wir festhalten: über die Formen der Klassiker sind wir nicht hinaus. Was später<br />
gekommen ist, war nur Veränderung, Erweiterung, Verkürzung – aber die Formen sind geblieben<br />
– auch bei Schönberg! 42<br />
Das Prinzip der musikalischen Sprache der Wiener Schule um 1910 ist laut Adorno<br />
eine komprimierte Kürze der musikalischen Form, in der viele Bestandteile innerhalb<br />
kurzer Zeit angeordnet werden. So werde ein musikalisches Gebilde erzeugt, das<br />
„Protokoll und Konstruktion in einem“ 43 sei.<br />
Die Kürze eines Stücks hat bei Webern ihr Analogon in kurzen Gesten und<br />
Einzeltönen. Sie sind zu klein, um als sebständige Gestalten erfasst bzw. begriffen<br />
werden zu können. Alles huscht von einem Ton bzw. von einer Geste zur nächsten,<br />
nichts wiederholt sich eindeutig. 44 Die elliptische Darstellung der Gedanken weist<br />
offene Stellen auf, durch welche die musikalischen Elemente leichter in Bezug zu<br />
39 Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (Gesammelte Schriften 12), Frankfurt am Main<br />
(Suhrkamp) 1997, S. 119.<br />
40 Theodor W. Adorno, Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis, Frankfurt<br />
am Main (Fischer) 1963, S. 132.<br />
41 Wolfgang Burde: Anton von Weberns instrumentale Miniaturen, in: NZfM, 1971, S. 286.<br />
42 Anton Webern, Der Weg zur neuen Musik, hg. von Willi Reich, Wien (Universal-Edition) 1960,<br />
S. 37.<br />
43 Th. W. Adorno, Philosophie der Neuen Musik, S. 45.<br />
44 Die motivische Arbeit ist in ein Spiel mit Farben und Klängen umgewandelt: Die 2. Violine<br />
exponiert im 2. Takt der 1. Bagatelle ein Dreitonmotiv, es wird im gleichen Takt von der<br />
1. Violine in umgekehrter Bewegungsrichtung aufgenommen, das Motiv wandert im 3. Takt ins<br />
Cello, und wird dann zwei Takte später wieder von der 1. Violine aufgenommen.<br />
39