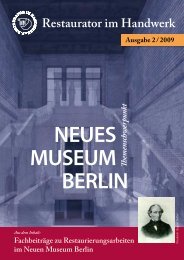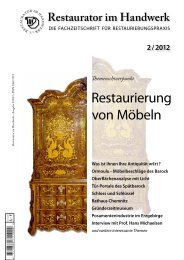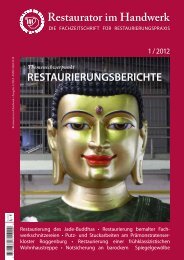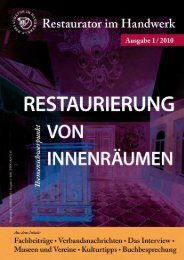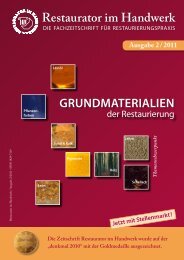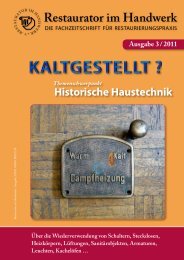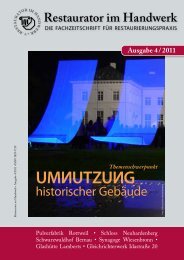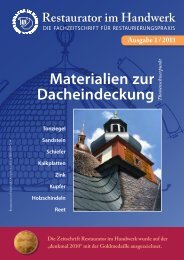Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dokumentiert wurden exemplarisch nachfolgende Schadensbilder:<br />
• vielfältige Glasurschäden, z.B. Glasurkorrosion, Glasurrisse/Glasurabbrüche<br />
• partielle Abplatzungen, auch durch Kantendruck zu<br />
eng verlegter Fliesen<br />
• Salzkristallisation an Rissen, Glasurrändern, Glasurabbrüchen<br />
• Feuchteflecken und Feuchteränder, z. B. sichtbar am<br />
glasurfreien Scherben<br />
• ausgeprägte, vertikale und horizontale, oberflächenparallele<br />
Rissbildung und Brüche<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die schädigenden<br />
Auswirkungen der Salze, neben dem rein visuellen<br />
Eindruck, dominant auf Vorgängen beruhen, die<br />
als Salzhydratation und Salzkristallisation bezeichnen<br />
werden. Hierbei werden Wassermoleküle aus der Luft<br />
und der Bausubstanz in Form von Kristallwasser auf festen<br />
Gitterplätzen <strong>im</strong> Kristall eingebaut. Es kommt zu<br />
einer Volumenerweiterung mit regelrechter Sprengwirkung,<br />
die als Prozess bis zur Substanzzerstörung führt.<br />
Bei Trockenheitsphasen verdunstet das aufgenommene<br />
Wasser wieder, und die Salze kristallisieren. Bei Überschreitung<br />
des Löslichkeitsproduktes, bedingt durch<br />
den Wassereintrag z. B. bei fortschreitender Feuchte an<br />
den Verdunstungszonen, beginnt der schädigende Prozess<br />
erneut.<br />
Der Umfang der Schädigungen veranlasste die Entscheidung<br />
zum kompletten Rückbau des keramischen<br />
Mosaikfußbodens und das Auskoffern der belasteten<br />
Kiesgründung sowie der Verlegesande.<br />
Der Rückbau begünstigte in jedem Fall eine umfassende<br />
Zustandserfassung und begleitend werktechnische<br />
Beobachtungen – ein Sachverhalt, der wesentlich spezielle<br />
Bearbeitungsmethoden, die Materialauswahl, Restaurierungsmaßnahmen<br />
sowie die verantwortungsbewusste<br />
Fliesenrekonstruktion unterstützte. Die Fliesen,<br />
in der großen Stückzahl und in den Bearbeitungsphasen<br />
ständiger Betrachtung unterzogen, lassen sich charakterisieren<br />
und ihre Besonderheiten, z. B. Material und<br />
Herstellung, sicher zusammenfassen.<br />
Grundlage der Fertigung keramischer Fliesen in<br />
der vorindustriellen Epoche waren neben Kenntnissen<br />
zu Vorbildern, realen Beispielen der Anwendung sowie<br />
bewährten funktionalen Nutzungen umfangreiche Rohstoffvorkommen,<br />
räumliche Eignung, sich fortentwickelnde<br />
handwerkliche Fertigkeiten und die Kontinuität<br />
regionaler sowie überregionaler Nachfrage.<br />
Zur Herstellung der Fliesen des Mosaikfußbodens<br />
für die nördlichen Chorkapelle verarbeiteten die damaligen<br />
<strong>Handwerk</strong>er einen hellrot brennenden Ziegelton aus<br />
Tongruben regionaler Vorkommen.<br />
Tonballen, verdichtend geschlagen (sogenannte Kluten),<br />
werden in gewässerte Holzformen eingeschlagen<br />
und oberhalb des Rahmens mit einem abgerundeten<br />
Holzstock bzw. mit einer in einen Bügel eingespannten<br />
Sehne nahezu parallel zum Grund abgezogen oder mit<br />
den Händen glattgestrichen. Hinweis für diese Technik<br />
sind <strong>im</strong> Querbruch festgestellte oberflächenparallele<br />
Risse oder schichtförmige Einlagerungen. Gerichtete<br />
Gefüge und Mehrlagigkeit, Quetschungen und Lufteinschlüsse<br />
belegen einen manuellen, z. T. diskontinuierlichen<br />
sowie inhomogenen Formungsprozess.<br />
Die Fliesen sind in der Draufsicht äußerst exakt und<br />
scharfkantig. Die Seitenflächen weisen umlaufend ebenfalls<br />
ausgerichtete Rillen von mitgezogenen Sandkörnern<br />
auf. Diese Qualitäten sind ausführbar, wenn ausgeformte<br />
Plattenrohlinge mit Hilfe einer scharfen Klinge entlang<br />
einer die Form best<strong>im</strong>menden Metall- oder Holzlehre<br />
( hier Trapez oder Quadrat) umschnitten wurden. Der<br />
Zuschnitt der Seitenflächen erfolgte konisch, damit bei<br />
der engen Verlegung genug Platz für den Mörtel vorhanden<br />
war.<br />
Die bereits erwähnte Farbigkeit des Scherbens nach<br />
dem Brand ist durch die unterschiedlichen Bedingungen<br />
in der Brennkammer, so Temperaturunterschiede von<br />
mehreren Grad, je nach Lage des Ziegel <strong>im</strong> Brennraum,<br />
diskontinuierliche Befeuerung und nicht konstante<br />
Ofenatmosphäre zu erklären. Die damaligen Brennöfen/<br />
Feldbrandöfen wurden nur mit Reisig, Holz und bei visueller<br />
Kontrolle ohne Temperaturmesseinrichtungen<br />
betrieben.<br />
Typisch ist die Ausbildung eines grauen Reduktionskernes<br />
<strong>im</strong> Inneren des Scherbens der meisten Fliesen. Er<br />
Craquelierte glasierte<br />
Oberfläche<br />
mit Rissbildung<br />
Glasurkorrosion,<br />
Glasurausbrüche,<br />
Aufwerfungen,<br />
Salzkristallisation<br />
in kleinen<br />
Nestern, grauer<br />
Reduktionskern<br />
Horizontaler<br />
Bruch einer<br />
Mittelfliese<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2010</strong><br />
19