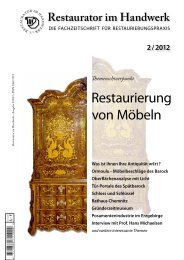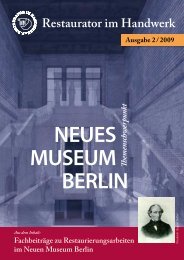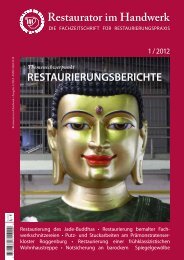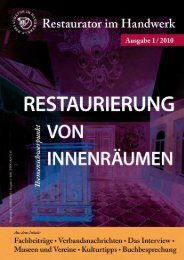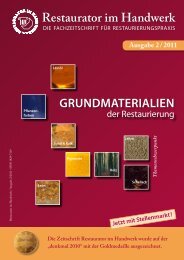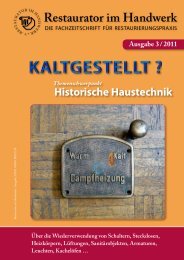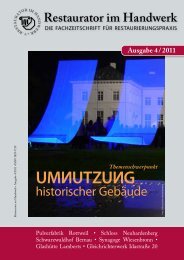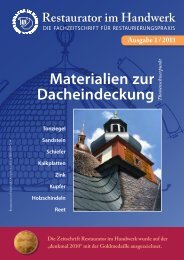Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
diesem Bestreben direkt und massiv gegenüber stehen.<br />
Aber jedes Gesetz kennt Ausnahmeregelungen, und in<br />
der Restaurierung bewegen wir uns <strong>im</strong> Feld der Ausnahmen.<br />
2009 wurde von uns das Parkettfoyer der 1958 neu<br />
gebauten Oper Leipzig teilweise restauriert. Um dort<br />
Gleichartigkeit der Fassungen zu ermöglichen, war es<br />
unumgänglich, Anstriche alter Prägung anzuwenden.<br />
Die Ausnahmegenehmigungen wurden nach einigem<br />
amtlichen Formalismus auch seitens der EU erteilt. So<br />
konnte die historische Fassung der Furniere aus Schweizer<br />
Birnbaum, die mit altem SH – Lack aus früher DDR-<br />
Zeit – erfolgt war, mit einem sehr ähnlichen Material<br />
aus einer Sonderanfertigung nahezu artgleich gestaltet<br />
werden.<br />
Damit ist aber noch die Frage nach dem Bezug des<br />
Materials offen. Die meisten namhaften Hersteller von<br />
Anstrichstoffen folgen den gesetzlichen Trends: Ablösung<br />
der alten Systeme durch moderne Bindemittel und<br />
alter Lösemittel durch Wasseranteile. Sie müssen ihnen<br />
folgen, um am Markt bestehen zu können, und die wenigen<br />
Hersteller von Farben nach altem Rezept lassen sich<br />
diese Produkte zwischenzeitlich nahezu vergolden. Darum<br />
ist es in der Restaurierung ein Muss, sich wieder selbst<br />
mit der Herstellung von geeigneten Farben auseinander<br />
zu setzen. Die Ausgangsstoffe sind auch heute sämtlich<br />
verfügbar, und es ist kein Zauberwerk eine eigene und<br />
gut funktionierende Farbe zu bereiten. Für dieses weite<br />
Feld verweise ich auf die gute einschlägige Literatur, als<br />
Beispiel sei hier das „Werkstattbuch des Johann Arendt<br />
Müller zu Quakenbrück“ angeführt. Müller ist ein sogenannter<br />
Fassmaler des frühen 19. Jahrhunderts und hat<br />
in dem einzigartigen Buch wichtige Details festgehalten,<br />
die sonst selten so lebensnah abgehandelt werden.<br />
Der Inhalt des Buches entstammt nachweislich sogar der<br />
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist eine Sammlung<br />
von gesammelten Anweisungen wesentlich älterer<br />
<strong>Handwerk</strong>er. Im Jahre 2002 wurde das Buch in einer Bearbeitung<br />
von Frau Jirina Lehmann in Hildeshe<strong>im</strong> neu<br />
veröffentlicht.*<br />
Materialien und Mischungen für die Lasuren<br />
Bis zu diesem Punkt wurde das magische Bier, das Bindemittel<br />
der lasierenden Malfarben bei der sog. Biermalerei,<br />
nicht erwähnt. Erst jetzt kommt diese Kompomente<br />
in den Blick. Auf den oben beschriebenen Grundfarbton<br />
und den damit ausgeführten deckenden Anstrich werden<br />
nun die eigentlichen Malereien mit den Lasuren aufgetragen.<br />
Auch hier müssen wir uns kurz mit der Maltechnologie<br />
befassen. Jede klassische Malfarbe……Die erste<br />
Komponente sind die Pigmente, die Zweite das Lösemittel,<br />
in welchem die dritte Komponente, das Bindemittel,<br />
aufgelöst ist. Das Lösemittel ist in der Regel zugleich das<br />
Verdünnungsmittel für die Malfarbe. Da die Lasuren für<br />
die Holzmalerei grundsätzlich selbst zu zubereiten sind,<br />
wollen wir uns der Lösemittelfrage und der Bindemittelfrage<br />
besonders zuwenden. Wiederum klassisch gibt<br />
es dazu zwei Varianten. Einerseits gibt es Malfarben mit<br />
Bindemitteln, die in Wasser oder in organischen Lösemitteln<br />
aufgelöst sind. Sie trocknen durch Verdunstung<br />
des Lösemittels, d. h. physikalisch. Andererseits gibt es<br />
Malfarben auf Basis von trocknenden Ölen, sie trocknen<br />
durch chemische Reaktionen (Oxidation und Polymerisation<br />
zugleich, sog. chemische Trocknung).<br />
Bier als Bindemittel und Lösemittel für Lasurfarben<br />
Jedes Bier enthält Wasser, Ethanol, kleine Menge von<br />
unvergorenem Malzzucker (Maltose) und Dextrin,<br />
sowie Eiweißstoffe, Bitterstoffe und Kohlensäure. Zu<br />
manchen Biersorten darf als Farbstoff auch karamellisierter<br />
Zucker zugesetzt werden.<br />
Die Maltose ist ein zusammengesetzter Zucker (Disaccharid),<br />
bestehend aus zwei chemisch gebundenen<br />
Glukosemolekülen. Sie ist ebenso wie Dextrin ein Abbauprodukt<br />
von Stärke aus Gerste bzw. Weizen. Maltose<br />
und Dextrin sind zusammen mit Eiweißstoffen die<br />
eigentlichen Bindemittel in den Bier - Lasurfarben. Das<br />
Wasser, Ethanol und Kohlensäure sind <strong>im</strong> Bier die Lösemittel.<br />
Die Menge von den Bestandteilen mit Bindemittel -<br />
Funktion ist <strong>im</strong> Bier relativ klein (ca. 3% Maltose, noch<br />
kleinere Anteile der übrigen Stoffe kommen hinzu). Deshalb<br />
haben frühere Holzmaler für die Bierlasuren gerne<br />
das sog. „Tropfbier“ genommen, also das Bier, das in<br />
der Schenke daneben fließt<br />
und unter dem Zapfhahn<br />
gesammelt wird. Durch<br />
teilweise Verdunstung vom<br />
Wasser, Ethanol und Kohlensäure<br />
ist dieses Bier reicher<br />
an den bindefähigen<br />
Bestandteilen.<br />
Selbstverständlich gibt es<br />
Unterschiede in der Zusammensetzung<br />
der zahlreichen<br />
Biersorten, weil ihre Produktion<br />
vielfach variabel<br />
ist. Hier ist es eine Sache<br />
von Versuchen, wieviel Bier<br />
und welche Sorte zum Einsatz<br />
kommen sollte. Man<br />
kann Bier durchaus unverdünnt<br />
verwenden und hat<br />
damit opt<strong>im</strong>ale Bindekraft.<br />
Man kann es aber auch mit<br />
Wasser verdünnen, auch<br />
dann genügt die Bindekraft<br />
noch. Entscheidend ist die<br />
Haltbarkeit der Lasur. Bier<br />
verdirbt relativ schnell und<br />
wird so für die Malerei unbrauchbar.<br />
Darum sollte<br />
nicht zu viel Lasur angesetzt<br />
werden, und es sollten<br />
die Lagerbedingungen der<br />
Lasur dem Lebensmittel<br />
Bier angepasst werden.<br />
Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die für<br />
Holzmalerei ideale Eigenschaft des Bieres als Bindeund<br />
Lösemittel. Das Bier gewährleistet damit die opt<strong>im</strong>ale<br />
Verschiebbarkeit der noch nassen Lasur auf dem<br />
Untergrund. Dieser Vorgang des Vertreibens der Lasur<br />
ist nämlich der wichtigste bei der ganzen Holzmalerei.<br />
Der oben beschriebne Hütchenstapel, welcher das Maserbild<br />
ergibt, hat ja die Eigenschaft, dass die Farbintensität<br />
der Jahrringe innerhalb eines Wachstumsjahres der<br />
Bäume erheblich variiert. Diese Übergänge geschehen<br />
niemals schlagartig, sondern <strong>im</strong>mer in feinen Abstufungen<br />
innerhalb des gleichen Farbtones. Darum wer-<br />
Ein 2003 neu<br />
angefertigter<br />
Clairitz, der aber<br />
seinen Zweck<br />
nur sehr ungenügend<br />
erfüllt, weil<br />
einige markante<br />
Merkmale des<br />
alten Pinsels trotz<br />
Vorlage nicht<br />
beachtet wurden.<br />
Auch der mit<br />
Lasur gefüllte<br />
und durchkämmte<br />
nachgebaute<br />
Clairitz lässt<br />
seine Schwächen<br />
erkennen.<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2010</strong><br />
41