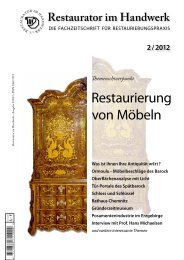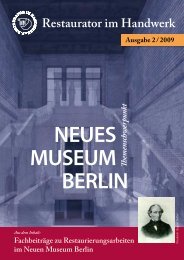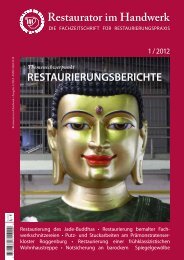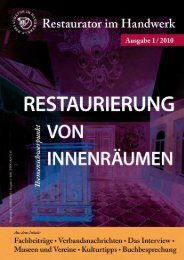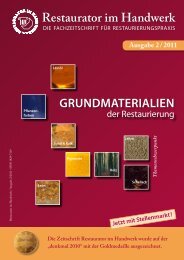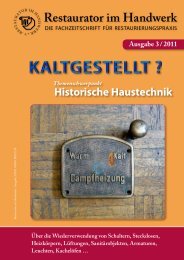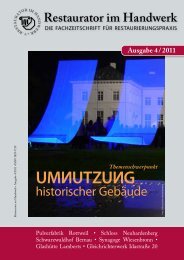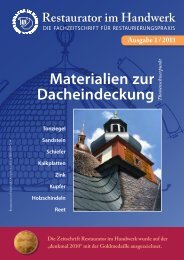Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2010 - Kramp & Kramp
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zu manchen heutigen sehr viel schnellwüchsiger gemachten<br />
Hölzern. Es gibt Fichten, die fast einen Zent<strong>im</strong>eter<br />
Jahreswachstum erreichen sollen. Die unterschiedliche<br />
Wachstumsgeschwindigkeit <strong>im</strong> Jahreszyklus wiederum<br />
ist die Ursache für eine deutlich erkennbare Ausprägung<br />
von Farbunterschieden in der jeweiligen „Hütchenwandung“,<br />
um in dem Bild zu bleiben.<br />
Sommerholz ist in der Regel heller als Winterholz.<br />
Natürlich sind diese Hüte niemals kreisrund und bei<br />
manchen Holzarten, wie z. b. bei der deutschen Esche,<br />
sind sie bewusst mit einer unregelmäßig gewellten Mantelfläche<br />
ausgebildet. Ferner haben Bäume <strong>im</strong>mer Äste,<br />
und diese durchdringen je nach Ansatz die darüber gewachsenen<br />
Hüte und ergeben an den Stellen der Durchdringung<br />
nochmals unendlich verspielte Bildvarianten,<br />
die aber alle zwingenden Gesetzen der Physik und des<br />
Baumwachstums unterliegen. Die von der Wachstumsgeschwindigkeit<br />
herbeigeführten Farbtonunterschiede<br />
der Hütchenwandungen sind nun die Grundlage für<br />
die Maserbilder. Das übliche Maserbild ergibt sich aber<br />
erst be<strong>im</strong> Sägen der Stämme. Hier soll nur das einfache<br />
Längssägen entlang der Stammachse betrachtet und<br />
andere Technologien vernachlässigt werden. Schneidet<br />
man den beschriebenen Hütchenstapel entlang der<br />
Mittelachse in einem best<strong>im</strong>mten Abstand zur Mittelachse<br />
mit einer Säge auf, erhält man, wegen der Farbunterschiede<br />
in der Hütchenwandung, eine Reihe von<br />
parabelförmigen Strukturen mit wiederum unendlichen<br />
Varianten. Dies geht alles nach zwingenden Gesetzmäßigkeiten<br />
des Holzwachstums vonstatten, die der Maler<br />
erkennen lernen muss.<br />
Ein Maler, der Holzarten <strong>im</strong>itieren möchte, muss sein<br />
Vorhaben zwingend mit intensiven Studien dieser so entstandenen<br />
Bilder beginnen. Dabei sollte er sich zunächst<br />
auf eine kleine Auswahl von Hölzern und Maserbildern<br />
beschränken. Auf einem der beigefügten Bilder sieht<br />
man, wie Maler ein vorgegebenes Bild eines Kirschbaumes<br />
nachzumalen versuchen. Das Naturstudium führt<br />
dazu, dass man Maserbilder der Hölzer zunächst in vielen<br />
Versuchen mit Kohle oder Bleistift auf Papier wiedergibt.<br />
Diese Studien sind ein unumgängliches Muss!<br />
Erfolgen sie autodidaktisch, sollten sie ab und zu einem<br />
kritischen und sachkundigen Auge zugänglich gemacht<br />
werden, um sich nicht ob der vermeintlichen Perfektion<br />
selbst zu belügen. Man muss sich dazu natürlich eine<br />
Reihe von Vorlagenhölzern beschaffen. Das tut man am<br />
besten in einem kleineren Sägewerk, wo noch Hölzer<br />
verarbeitet werden, die von Normholz abweichen, und<br />
wo dann besonders in den Anschnitten der Stammsockel<br />
oder in Stammkrümmungen sehr schöne Maserbilder<br />
vorkommen. Diese ergeben getrocknet, gehobelt<br />
und geschliffen sowie mit einem Holzöl behandelt die<br />
schönsten Vorlagen.<br />
Dabei muss man die Ästhetik der Bilder erkennen<br />
lernen und die Linienführung der Natur bis ins Detail<br />
zu verinnerlichen suchen. Allein die Linienführung<br />
der gesamten Vorlage zu erkennen, ist sehr wichtig.<br />
Ein Baum wächst niemals kerzengerade, er unterliegt<br />
Krümmungen und Windungen. Die Übernahme dieser<br />
Grundstruktur macht ein Maserbild aber erst echt<br />
und lebensnah, dessen Reproduktion bedarf unendlicher<br />
Studien und Malversuche. Auch sollte man die Bilder<br />
unbedingt <strong>im</strong> Verhältnis 1:1 wiedergeben, um dem Arm<br />
des Malers schon frühzeitig die freie Schwingung anzutrainieren,<br />
die für das Malen mit dem Pinsel unbedingt<br />
erforderlich ist. Auch das spiegelbildliche Malen ist eine<br />
wichtige Übung. Man denke nur an in Kreuzfugen zusammengelegte<br />
Furnierbilder. Das wiederum setzt alles<br />
großen Eifer und Lernwille und vor allem verfügbare<br />
Zeit voraus. Dies soll zum ersten Kapitel der individuellen<br />
Grundstudien genügen.<br />
Materialstudien zu Farben für die Imitation<br />
Holmalerei wird auch als Lasurmalerei bezeichnet.<br />
Ihr wesentliches Merkmal ist, dass ein vorgegebener<br />
Grundfarbton das Erscheinungsbild der gesamten Malerei<br />
nachhaltig beeinflusst. Die auf diesem Grundfarbton<br />
aufgebrachten Lasuren schaffen dann das Maserbild<br />
und die vielschichtigen Farbwirkungen in Form<br />
durchscheinender Komponenten. Die Besonderheit von<br />
Lasuren besteht darin, dass die Teilchengröße der in<br />
ihnen enthaltenen Pigmente wesentlich kleiner ist als<br />
bei gängigen Malfarben. Verwendet<br />
werden die feinsten Pigmente, derer<br />
Teilchengröße ca. zwischen 2 und 0,1<br />
μm (Mikrometer) beträgt. Im Vergleich<br />
dazu liegt die Wellenlänge des<br />
auf sie wirkenden sichtbaren Lichtes<br />
zwischen 0,4-0,75 μm. Feine und sehr<br />
feine Pigmente zeigen allgemein ein<br />
schlechtes Deckvermögen, das allerdings<br />
auch durch das Vermögen des<br />
jeweiligen Pigments und Bindemittels<br />
das Licht zu brechen (sog. Brechungsindex)<br />
beeinflusst wird. Je kleiner der<br />
Unterschied zwischen Brechungsindices<br />
des Pigments und Bindemittels ist,<br />
desto weniger deckt die Malfarbe und<br />
umgekehrt. Bei großem Unterschied<br />
der Brechungsindices liegt ein hohes<br />
Deckungsvermögen vor.<br />
Durch den Einsatz der feinkörnigen<br />
Pigmente wirken die Lasuren niemals<br />
deckend und ihre Transparenz erhöht<br />
sich noch durch das Zwischen- und<br />
Abschlusslackieren. Somit werden alle<br />
farbigen Komponenten des Grundfarbtones<br />
auch noch be<strong>im</strong> Auftrag der<br />
letzten Lasur sichtbar. Eine gute Malerei<br />
besteht aus mindestens drei bis<br />
fünf übereinander liegenden Lasuren<br />
und dem zugehörigen Grundfarbton.<br />
Es wirken damit also bis zu sechs<br />
Farbkomponenten auf das abschließende<br />
Maserbild ein.<br />
Aus diesen stark vereinfachten Darlegungen wird<br />
schon deutlich, dass restauratorische Arbeit an Holzmalerein<br />
eine besondere Erfahrung in bezug auf die Farbtonanalyse<br />
der wirksamen Schichten erfordert. Auch<br />
technische Möglichkeiten der Farbvermessung geraten<br />
hier schnell an Grenzen, so dass die Erfahrung des Malers<br />
unersetzlich ist. Der für eine Anlage prägende Farbton<br />
ist und bleibt der Grundfarbton, der als deckende<br />
Farbe aufgebracht wird. Es gibt aber auch Spezialtechniken,<br />
wo sowohl das Maserbild als auch die Farbwirkung<br />
des Holzes der Konstruktion mit in das gesamte<br />
Erscheinungsbild einbezogen wurden. Dies sind Sondervarianten,<br />
die wir hier nicht berücksichtigen wollen,<br />
Eine Malvorlage<br />
aus gesägtem<br />
Kirschbaum,<br />
wie <strong>im</strong> Text<br />
beschrieben dient<br />
sie als Vorlage<br />
für die Übungen<br />
der Lehrgangsteilnehmer.<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2010</strong><br />
39