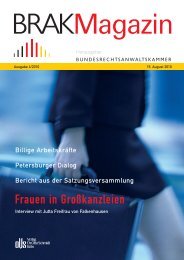2 - brak-mitteilungen.de
2 - brak-mitteilungen.de
2 - brak-mitteilungen.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BRAK-Mitt. 2/2002 Pflichten und Haftung <strong>de</strong>s Anwalts 65<br />
Rechtsprechungsleitsätze<br />
einem Unterlassen erwachsen<strong>de</strong> Sekundäranspruch hat lediglich<br />
Auswirkungen auf die Verjährung, worauf <strong>de</strong>r Senat zutreffend<br />
hinweist.<br />
Den RA trifft aber je<strong>de</strong>nfalls dann eine Pflicht, auf einen baldigen<br />
Verjährungseintritt hinzuweisen, wenn er die Gefahr zuvor<br />
durch Untätigkeit mitverursacht hat (BGH, NJW 1997, 1302). In<br />
<strong>de</strong>r zitierten Entscheidung geht <strong>de</strong>r BGH von zwei Pflichtverletzungen<br />
aus: Bereits das Unterlassen von Vorkehrungen zur Sicherung<br />
<strong>de</strong>s Anspruchs stellt eine Pflichtverletzung dar. Zusätzlich<br />
sah <strong>de</strong>r Senat eine Vertragspflicht, bei Beendigung <strong>de</strong>s Mandats<br />
auf die drohen<strong>de</strong> Verjährung hinzuweisen. Das Verhältnis<br />
dieser bei<strong>de</strong>n Pflichtverletzungen bleibt etwas unklar. Da es im<br />
Einzelfall schwierig zu beurteilen ist, ab wann <strong>de</strong>n RA die Pflicht<br />
trifft, auf mögliche Ansprüche und <strong>de</strong>ren Verjährung hinzuweisen<br />
– die Re<strong>de</strong> ist hier meist davon, dass die „Gefahr besteht,<br />
dass <strong>de</strong>r Anspruch aus <strong>de</strong>m Blick gerät“ –, kann man die Hinweispflicht<br />
bei Mandatsen<strong>de</strong> als eine Art Auffangtatbestand ansehen.<br />
Das im Leitsatz zitierte BGH-Urteil ist aber auch dann<br />
dogmatisch nicht recht verständlich: Dort geht <strong>de</strong>r Senat davon<br />
aus, dass die Pflicht zunächst „noch nicht endgültig verletzt“<br />
gewesen wäre. Warum dann nicht je<strong>de</strong>nfalls bei Mandatsen<strong>de</strong><br />
eine Hinweispflicht bestand, bleibt unklar. Die „Abgrenzung“<br />
im hiesigen Leitsatz ist dann wohl auch eher als „Distanzierung“<br />
anzusehen.<br />
Im Übrigen dürfte die zusätzliche Hinweispflicht bei Mandatsen<strong>de</strong><br />
keine weiteren Auswirkungen haben: Wenn die<br />
Verjährung <strong>de</strong>s ursprünglichen Anspruchs bei Mandatsen<strong>de</strong><br />
noch nicht eingetreten ist, ist auch <strong>de</strong>r Haftpflichtanspruch noch<br />
nicht „entstan<strong>de</strong>n“ (§ 51 b, 1. Halbs. BRAO). Damit läuft in je<strong>de</strong>m<br />
Fall die Verjährung ab Mandatsen<strong>de</strong> (§ 51 b, 2. Halbs.<br />
BRAO).<br />
Rechtsanwältin Antje Jungk<br />
Haftung<br />
Rechtsprechungsleitsätze<br />
Kausalität und Beweislast bei Falschberatung<br />
Die Frage <strong>de</strong>s Ursachenzusammenhangs zwischen einer anwaltlichen<br />
Pflichtverletzung und <strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Mandanten<br />
beantwortet sich nicht danach, ob <strong>de</strong>r Mandant <strong>de</strong>m pflichtwidrigen<br />
Rat <strong>de</strong>s Anwalts gefolgt ist o<strong>de</strong>r aus eigenem Antrieb<br />
gehan<strong>de</strong>lt hat, son<strong>de</strong>rn danach, wie er sich verhalten hätte,<br />
wenn er richtig beraten wor<strong>de</strong>n wäre.<br />
BGH, Urt. v. 6. 12. 2001 – IX ZR 124/00, NJW 2002, 593<br />
Anmerkung: Der bekl. RA ging von einer falschen Rechtslage im<br />
Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Anwendung eines Tarifvertrages aus. Er<br />
erklärte <strong>de</strong>m Mandanten, einem Opernsänger, dass eine ausgesprochene<br />
„Nichtverlängerungsmitteilung“ <strong>de</strong>m Arbeitgeber lt.<br />
Tarifvertrag möglich sei. Das war aber konkret unrichtig, weil<br />
<strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong> Arbeitsvertrag keine Befristung vorsah<br />
und damit die grundsätzlich durch Tarifvertrag vorgesehene<br />
„Nichtverlängerungsmitteilung“ das Arbeitsverhältnis nicht been<strong>de</strong>n<br />
konnte. Infolge<strong>de</strong>ssen hatte er <strong>de</strong>m Mandanten dazu geraten,<br />
einer im Raum stehen<strong>de</strong>n „Abfindungslösung“ näher zu<br />
treten. Der Mandant schloss dann in <strong>de</strong>r Folge selbst mit <strong>de</strong>m<br />
Arbeitgeber einen Abfindungsvertrag. Das Berufungsgericht<br />
hatte in diesem Fall <strong>de</strong>n Grundsatz <strong>de</strong>s „beratungsrichtigen Verhaltens“<br />
missverstan<strong>de</strong>n. Es ging davon aus, dass es danach vermuten<br />
dürfe, die unzutreffen<strong>de</strong> Darstellung <strong>de</strong>s Anwalts sei für<br />
die Entscheidung <strong>de</strong>s Kl., <strong>de</strong>n Vergleich zu akzeptieren, scha<strong>de</strong>nsursächlich<br />
gewesen. Bei <strong>de</strong>r „Vermutung beratungsrichtigen<br />
Verhaltens“ kommt es aber nicht darauf an, was <strong>de</strong>r Mandant<br />
tatsächlich getan hat und dass vermutet wer<strong>de</strong>n kann, diese<br />
tatsächlichen Entschlüsse gingen ohne weiteres auf die unrichtige<br />
Beratung zurück. Der BGH stellt nochmals klar, dass es bei<br />
falscher Beratung darauf ankommt, was <strong>de</strong>r Mandant bei unterstellt<br />
richtiger Beratung getan hätte. Dabei kann ihm <strong>de</strong>r Anscheinsbeweis<br />
unter <strong>de</strong>r Voraussetzung zugute kommen, dass<br />
ein bestimmter Rat geschul<strong>de</strong>t war und es in <strong>de</strong>r gegebenen Situation<br />
unvernünftig gewesen wäre, einem solchen Rat nicht zu<br />
folgen. Hierzu muss das Berufungsgericht aber nun noch weitere<br />
Feststellungen treffen, weil <strong>de</strong>r Arbeitgeber möglicherweise<br />
ohnehin betriebsbedingt hätte kündigen können und <strong>de</strong>r Rat,<br />
<strong>de</strong>n Vergleich zu akzeptieren, dann im Ergebnis doch richtig gewesen<br />
wäre.<br />
Rechtsanwalt Bertin Chab<br />
Hinweispflichten auf Prozessrisiken nach Wi<strong>de</strong>rruf <strong>de</strong>r<br />
Deckungszusage durch <strong>de</strong>n Rechtsschutzversicherer<br />
Führt <strong>de</strong>r RA für einen rechtschutzversicherten Mandanten einen<br />
wenig aussichtsreichen Prozess, so muss er <strong>de</strong>n Mandanten<br />
darüber spätestens dann belehren, wenn <strong>de</strong>r Rechtsschutzversicherer<br />
die zunächst erteilte Deckungszusage zurückzieht<br />
o<strong>de</strong>r einschränkt und <strong>de</strong>r RA dagegen für <strong>de</strong>n Mandanten<br />
nichts unternehmen will.<br />
OLG Düsseldorf, Urt. v. 6. 7. 2001 – 24 U 211/00, NJW-RR<br />
2002, 64<br />
Anmerkung: Der Senat stellt klar, dass <strong>de</strong>r Anwalt nach höchstrichterlicher<br />
Rspr. gehalten ist, <strong>de</strong>n Mandanten vor einer beabsichtigten<br />
Klage über die Gefahren eines möglichen Prozessverlustes<br />
aufzuklären, wenn nach Prüfung <strong>de</strong>r Sach- und Rechtslage<br />
eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Aussichtslosigkeit<br />
spricht. Ganz allgemeine Hinweise, dass ein Prozess auch verloren<br />
gehen kann, genügen nicht. Besteht aber eine Deckungszusage<br />
einer Rechtsschutzversicherung ist das Unterlassen einer<br />
solchen Aufklärung kaum kausal, da auch ein „vernünftiger“<br />
Mandant unter diesen Umstän<strong>de</strong>n eine riskante Klage einreichen<br />
wird. Nach Wi<strong>de</strong>rruf <strong>de</strong>r Deckungszusage durch die<br />
Rechtsschutzversicherung kommt aber die mangelhafte Aufklärung<br />
spätestens zum Tragen. Dann entsteht die Pflicht zur<br />
Aufklärung über die Risiken je<strong>de</strong>nfalls erneut. Eine ganz ähnliche<br />
Situation stellt sich möglicherweise, wenn die Deckungssumme<br />
<strong>de</strong>r Rechtsschutzversicherung ausgeschöpft ist und dies<br />
<strong>de</strong>m Anwalt bekannt ist. Eigene Ermittlungen hierzu muss er<br />
aber auch nicht anstellen (OLG Hamm, Urt. v. 4. 4. 2000 –<br />
28 U 206/99).<br />
Rechtsanwalt Bertin Chab<br />
Haftung <strong>de</strong>s neu eintreten<strong>de</strong>n BGB-Gesellschafters entsprechend<br />
§ 130 HGB<br />
Auf Grund <strong>de</strong>r geän<strong>de</strong>rten BGH-Rspr. zur Rechtsfähigkeit <strong>de</strong>r<br />
BGB-Gesellschaft haftet <strong>de</strong>r neu eintreten<strong>de</strong> Gesellschafter<br />
(RA) nicht nur mit seinem Anteil am Gesellschaftsvermögen für<br />
Altverbindlichkeiten, son<strong>de</strong>rn – als Folge auch <strong>de</strong>r Bejahung<br />
<strong>de</strong>s Akzessorietätsprinzips – in entsprechen<strong>de</strong>r Anwendung <strong>de</strong>s<br />
§ 130 HGB auch mit seinem Privatvermögen.<br />
OLG Hamm, Urt. v. 22. 11. 2001 – 28 U 16/01, BB 2002, 370<br />
Anmerkung: Siehe Grams, in diesem Heft, S. 60 ff.