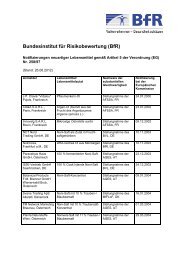Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Frühstadium) behaftet waren. In beiden Studien wurden keine signifikanten<br />
toxischen Effekte auf die Muttertiere festgestellt, was ein wichtiges Kriterium<br />
für die Validität der Befunde ist. Trotzdem kommen die Berichterstatter<br />
zu der Schlussfolgerung, dass eine Kennzeichnung von Glyphosat wegen<br />
reproduktionstoxischer Wirkungen „nicht angemessen und nicht notwendig“<br />
sei. Es stellt sich die Frage, wie dies mit dem beobachteten Auftreten<br />
von Skelettmissbildungen und Implantationsverlusten vereinbar ist.<br />
Disqualifizierung, fehlerhafte Interpretationen und<br />
Unterschlagung von Studien<br />
Peter Clausing<br />
Bestimmte Publikationen aus wissenschaftlichen Zeitschriften, die in einem<br />
Peer-Review bereits ihre wissenschaftliche Qualität unter Beweis gestellt<br />
hatten, werden von den Berichterstattern entweder nicht weiter diskutiert<br />
oder unter Verwendung fragwürdiger Argumente disqualifiziert und somit<br />
von vornherein nicht bei der Bewertung des Wirkstoffs berücksichtigt. So<br />
wird die Arbeit von Daruich et al. (2001) unter anderem wegen „unrealistisch<br />
hoher Dosierungen“ abgelehnt (Renewal Assessment Report 2013,<br />
Volume 1, Level 1, S. 77). Daruich et al. (2001) verabreichten Glyphosat<br />
über das Trinkwasser als 0,5%ige und 1%ige Lösungen, was selbst in der<br />
hohen Dosis nur 125 mg/kg Körpergewicht entsprach – angesichts von<br />
300, 1.000 und 3.500 mg/kg in den regulatorischen Teratogenitätsprüfungen<br />
an Ratten (Renewal Assessment Report 2013, Volume 1, Level 1, S.<br />
70) wohl kaum eine unrealistisch hohe Dosis.<br />
Die wichtige Arbeit von Beuret et al. (2005) findet im bewertenden Teil des<br />
RAR überhaupt keine Erwähnung und wird lediglich im beschreibenden<br />
Band 3 kurz erwähnt (Renewal Assessment Report 2013, Volume 3, Annex<br />
B.6.1, S. 659) und mit Verweis darauf disqualifiziert, dass die beobachteten<br />
Effekte das Resultat eines reduzierten Wasser- und Futterverbrauchs<br />
sein könnten. Die Berichterstatter übernehmen damit ungeprüft das Argument<br />
der Monsanto-gesponsorten Übersichtsarbeit von Williams et al.<br />
(2012). Beuret et al. (2005) ermittelten eine veränderte Lipidperoxidation<br />
in der Leber von Rattenmüttern und ihren Föten, nachdem ihnen das<br />
glyphosathaltige Präparat Herbicygon über das Trinkwasser verabreicht<br />
wurde. Die Befunde waren bemerkenswert eindeutig und zeigten erhöhte<br />
Lipidperoxidation in der Leber, sowohl bei den Müttern als auch bei den<br />
Feten. Das ist deshalb besonders bedeutsam, weil Lipidperoxide zellschädigende<br />
endogene Moleküle sind, die einen Mechanismus für diverse<br />
pathologische Prozesse bis hin zur Tumorbildung darstellen. Lipidperoxide<br />
entstehen laufend im Körper, werden aber normalerweise genauso laufend<br />
abgebaut. Wenn die Deaktivierung dieser Moleküle beeinträchtigt ist, kann<br />
dies zahlreiche Folgewirkungen haben. Williams et al. (2012), auf die die<br />
Berichterstatter Bezug nehmen, versuchen die Befunde u.a. wegen des<br />
reduzierten Futterverbrauchs in der Studie von Beuret et al. (2005) zu diskreditieren.<br />
Sie versuchen, dies mit der Nennung von elf Publikationen zu<br />
untermauern, die über enzymatische Veränderungen in der Leber bei reduziertem<br />
Futterangebot berichten. Schaut man sich die zitierten Arbeiten<br />
29