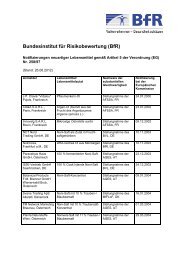Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Roundup___Co_-_Unterschaetzte_Gefahren
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
58<br />
Unkräuter gespritzt wird, können die Anbauanteile der wirtschaftlichsten<br />
Kulturen erheblich ausgedehnt werden. Die heutigen Fruchtfolgen sind<br />
daher mit wenigen Kulturarten im Jahreswechsel in der Regel eng, es<br />
dominieren getreidelastige Fruchtfolgen, oft fehlt der Wechsel zwischen<br />
Sommer- und Winterfrüchten.<br />
Wildgräser und Wildkräuter, die in Wuchs, Vegetationsverlauf, Nährstoff-,<br />
Licht- und Bodenanspruch den angebauten Kulturpflanzen ähneln, werden<br />
durch deren Anbau gefördert. Dominieren Getreidearten die Fruchtfolge,<br />
werden Gräser auf den Standorten schnell zu Problemunkräutern. Werden<br />
keine Sommerfrüchte, wie beispielsweise Hafer, Sommergerste oder<br />
Kartoffeln, angebaut, entfällt die Bodenbearbeitung im Frühjahr – auch<br />
das fördert bestimmte Pflanzen, die sich zu „Problemunkräutern“ entwickeln<br />
können. Durch enge Fruchtfolgen und reduzierte Bodenbearbeitung<br />
wuchs in den letzten Jahren u.a. die Bedeutung des Kleinen und des<br />
Schlitzblättrigen Storchschnabel und der Tauben Trespe als „Ackerunkräuter“(LfL<br />
2011). Andere „Schadgräser im modernen Ackerbau“ sind<br />
Ackerfuchsschwanz und Windhalm. Zurückdrängen lassen sie sich durch<br />
Fruchtfolgen mit Sommergetreide und Blattfrüchten, durch wendende Bodenbearbeitung<br />
bzw. mechanische Bekämpfung im frühen Entwicklungsstadium<br />
und, beim Ackerfuchsschwanz, durch späte Aussaat des Wintergetreides<br />
(LfL 2011). Ähnliches gilt für andere Wildgräser und Wildkräuter:<br />
Durch die Optimierung der Nährstoffversorgung, optimale Saatzeitpunkte,<br />
sauberes Saatgut, mechanische Bodenbearbeitung, Stoppelbearbeitung<br />
und Unkrautregulierung und vor allem durch abwechslungsreiche Fruchtfolgen<br />
und Zwischenfruchtanbau lassen sich Wildkräuter und Wildgräser<br />
auf ein tolerierbares Maß zurückdrängen. Das bestätigt die Praxis des<br />
ökologischen Landbaus.<br />
Um die nicht-chemische Unkrautbekämpfung etwa im für den Glyphosateinsatz<br />
mengenmäßig besonders relevanten Ackerbau zu stärken, sind<br />
Anstrengungen auf verschiedenen Ebenen notwendig. Das Finanzvolumen<br />
für Forschung und Investitionen im Bereich Alternativen-Forschung<br />
und -Förderung muss erhöht werden. Politikbereiche, die einer Diversifizierung<br />
von Fruchtfolgen entgegenstehen, müssen überarbeitet werden.<br />
Dies betrifft u.a. auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das eine<br />
einseitige Förderung des Maisanbaus nach sich zog. Da die Kosten für<br />
Herbizidprodukte nicht die von der Allgemeinheit getragenen externen Gesundheits-<br />
und Umweltkosten beinhalten, sind sie aus betriebswirtschaftlicher<br />
Sicht günstig und daher erste Wahl. Eine entsprechende Besteuerung<br />
der Pestizidprodukte sollte hier gegensteuern (Haffmans 2013). Neue<br />
Absatzmärkte für die Produkte einer vielfältigeren Fruchtfolge müssen geschaffen<br />
werden. Der ökologische Mehrwert herbizidfreier Flächen, durch<br />
die beispielsweise Bestäuber gefördert werden, die wiederum Ernteerträge<br />
sichern helfen, muss sich auf Betriebsebene als „Gewinn“ verbuchen<br />
lassen. Pflanzenschutzberater müssen in einem viel größeren Maße zu<br />
„Anbauberatern“ werden, um Landwirte bei der nicht-chemischen Unkrautkontrolle<br />
zu unterstützen. Lohnunternehmer sollten die mechanische<br />
Unkrautregulierung mit Grubber, Egge und Striegel in ihr Leistungsangebot<br />
aufnehmen.<br />
Diese politischen Anpassungen können nicht allein über eine Novellierung