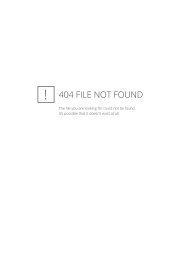Studie - ecos
Studie - ecos
Studie - ecos
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Potenziale und Herausforderungen der Expats-Integration in der Region Basel<br />
Seite 25 von 71<br />
Expats, basierend auf seiner alltäglichen Verwendung nicht zuletzt durch die Expats selbst, eine<br />
Erweiterung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung erfahren 6 .<br />
822 Der Begriff „Integration“<br />
Durch die Interviews und Fokusgruppen bestätigt, lehnt sich die <strong>Studie</strong> beim Integrationsverständnis<br />
an die „Akkulturationstheorie“ von Berry (1980) 7 an. Unter Akkulturation wird die<br />
Veränderung der eingebrachten Kulturmuster von Einwanderungsgruppen infolge fortgesetzten<br />
direkten Kontakts mit der Aufnahmegesellschaft verstanden. Die Theorie unterscheidet vier<br />
Akkulturationsstrategien, definiert über die Fragen, ob die zu integrierende Gruppe die eigene<br />
Kultur beibehalten will, soll und kann und ob irgendeine Form des Kontakts zwischen Einheimischen<br />
und Einwanderern bestehen soll/kann oder nicht.<br />
Ausgehend davon werden die vier Strategien definiert:<br />
1) Segregation<br />
2) Integration<br />
3) Assimilation<br />
4) Marginalisierung<br />
Unter Segregation wird verstanden, dass jede Aufnahmegesellschaft Mechanismen zur<br />
Ausgrenzung von MigrantInnen, aber auch MigrantInnen Mechanismen zur Abgrenzung gegenüber<br />
der Aufnahmegesellschaft haben. Berry (1980) definiert Integration im Allgemeinen<br />
als Eingliederung, beziehungsweise möglichst umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.<br />
Voraussetzung für eine gelungene Integration ist die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft,<br />
die Chancengleichheit und Gleichberechtigung für alle Bürgerinnen und Bürgern zu<br />
garantieren und die Bereitschaft der MigrantInnen selbst zur Eingliederung und Teilhabe am<br />
gesellschaftlichen Leben. Somit ist die Integration unter Wahrung der eigenen kulturellen Identität<br />
der sinnvolle Mittelweg zwischen völliger Assimilation und absoluter Ausgrenzung aus der<br />
Gesellschaft. Die Assimilation hingegen endet in einem Zustand der Ähnlichkeit. Sie stellt an<br />
die MigrantInnen die Anforderung der Auflösung der eigenen mitgebrachten persönlichen wie<br />
auch kulturellen Identität in die Aufnahmegesellschaft. Unter Marginalisierung ist zu verstehen,<br />
dass MigrantInnen sowohl die eigenkulturelle wie auch die der neuen Kultur bildenden<br />
Elemente beziehungsweise Werte ablehnen, was mit der Hoffnung verbunden ist, dass durch<br />
diese Orientierungslosigkeit auch wenig Spannung erlebt würde 8 .<br />
Vereinfacht lassen sich diese Strategien wie folgt in Tabelle 5 darstellen:<br />
6<br />
Nach internationalem Recht definiert sich ein Expat bezogen auf den Zeitraums den Aufenthaltes<br />
auf zwischen einem halben und fünf Jahren.<br />
7 Berry, J. W. (1980). Social and cultural change. In H. C. Triandis, & R. W. Brislin (Eds.),<br />
Handbook of cross-cultural psychology: Social psychology (vol. 5, pp. 211-279). Boston: Allyn<br />
and Bacon.<br />
8<br />
Mohammad Rahrakhshan (2007): „Das psychische Befinden von iranischen Migranten in<br />
Deutschland“, Dissertation: Universität Hamburg.