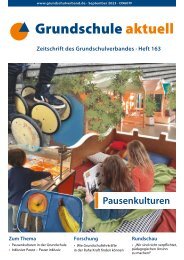Bildung für nachhaltige Entwicklung
GSa166_Mai24_ES
GSa166_Mai24_ES
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praxis: <strong>Bildung</strong> <strong>für</strong> <strong>nachhaltige</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Jaqueline Simon, Toni Simon<br />
Auf in die (Stadt)Wildnis!<br />
Wildnisbildung als Beitrag zu einer <strong>Bildung</strong> <strong>für</strong> <strong>nachhaltige</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> (BNE) – auch in der Primarstufe<br />
Zur Lösung der globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie Klimawandel,<br />
Naturkatastrophen, Ressourcenverknappung wird dem Leitbild der<br />
<strong>nachhaltige</strong>n <strong>Entwicklung</strong> eine große Bedeutung zugesprochen. Für die Umsetzung<br />
einer BNE werden seit mittlerweile 20 Jahren die besonderen Potenziale<br />
der Wildnisbildung diskutiert – dennoch ist diese Konzeption in der Primarpädagogik<br />
bisher weitgehend unbeachtet geblieben.<br />
Wildnisbildung knüpft am Thema<br />
Wildnis an, das u. a. bezogen<br />
auf Kernprobleme des globalen<br />
Wandels öffentlich, politisch und<br />
wissenschaftlich diskutiert und als geeignetes<br />
Thema <strong>für</strong> eine BNE gilt (DUK<br />
2015). Sie zielt auf das sinnlich-leibliche<br />
Erleben von wilder bzw. verwildernder<br />
Natur sowie darauf, dass komplexe Systemzusammenhänge<br />
verstanden, Nachhaltigkeitsfragen<br />
hinsichtlich des Mensch-<br />
Bei Wildnisbildung sollen keine eigenen<br />
Spuren hinterlassen, fremde ggf. sogar<br />
beseitigt werden. Doch was passiert mit<br />
diesem Schuh? Entfernt man ihn, oder ist<br />
er bereits ein Teil der Natur geworden?<br />
Zentrale Themenfelder der Wildnisbildung sind:<br />
Natur-Verhältnisses kritisch reflektiert<br />
sowie Möglichkeiten und Grenzen <strong>nachhaltige</strong>ren<br />
Handelns erörtert werden (vgl.<br />
Lindau/Mohs/Reinboth 2021).<br />
Was ist das Besondere<br />
von Wildnisbildung?<br />
Wildnisbildung entstand Anfang der<br />
2000er-Jahre als ein eigenständiger<br />
Bereich der Natur- und Umweltbildung<br />
in Nationalparks. Beeinflusst wurde sie<br />
von Konzeptionen wie z. B. der Umwelterziehung,<br />
dem Flow-Learning, der<br />
Rucksackschule oder der Öko-Umwelt<br />
Erlebnis- und Wildnispädagogik (vgl.<br />
Hottenroth/van Aken/Hausig/Lindau<br />
2017). Von diesen grenzt sich Wildnisbildung<br />
allerdings wie folgt ab:<br />
1. Sie bezog sich ursprünglich nur auf<br />
Jugendliche und Erwachsene und wurde<br />
nur in Nationalparks umgesetzt.<br />
2. Das Erleben wilder Räume und der<br />
Wirkmächtigkeit von Natur wird durch<br />
(zum Teil extreme) Grenzerfahrungen,<br />
also unvorhergesehene Situationen, die<br />
das Überschreiten persönlicher Grenzen<br />
verlangen und stark belastend sein<br />
können, verstärkt.<br />
a) das Ökosystem Wildnis<br />
b) die Wertschätzung von Wildnis<br />
c) Gerechtigkeit, Verantwortung und Empathie<br />
d) Wildnis als „Gegenwelt“<br />
e) Suffizienz (gezielter Verzicht z. B. auf Komfort wie fließendes Wasser oder Handys<br />
bzw. sparsamer Umgang mit Ressourcen und die Reflexion von Konsumverhalten)<br />
f) das eigene und das gesellschaftliche Mensch-Natur-Verhältnis<br />
Bezogen auf diese Themenfelder werden ökologische, ökonomische, soziale und politische<br />
Fragen in Zusammenhang mit dem Erleben von wilden bzw. verwildernden<br />
Räumen erörtert.<br />
Jaqueline Simon,<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Lehrkraft <strong>für</strong> besondere Aufgaben<br />
Dr. Toni Simon,<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
3. Das Erleben des Kontrasts zwischen<br />
wilden und anthropogen genutzten Räumen<br />
(Grenz- und Kontrasterfahrung)<br />
wird angeregt.<br />
4. Eingriffe in die Natur müssen stets<br />
minimal bleiben (Prinzip „minimal<br />
impact“) und sind kritisch auf ihre Notwendigkeit<br />
zu prüfen (das <strong>für</strong> tradierte<br />
Umweltbildung geläufige Bauen eines<br />
„Tipis“ aus Totholz oder Landart werden<br />
daher eher als problematisch gesehen).<br />
Wildnisbildung – auch in der Stadt?<br />
Seit 2016 hält Wildnisbildung auch Einzug<br />
in den (sub)urbanen Raum sowie<br />
damit einhergehend in die Bereiche<br />
der Elementar- und Primarpädagogik.<br />
Wichtige Impulse hier<strong>für</strong> wurden mit<br />
dem durch die Deutsche Bundesstiftung<br />
Umwelt (DBU) von 2016 bis 2021 geförderten<br />
Projekt „Wilde Nachbarschaft“<br />
(www.mlu.de/495g7) gesetzt. Das Projekt<br />
verfolgte u. a. die Ziele der Wildnisbildung<br />
noch stärker als Strömung von<br />
BNE zu etablieren und sie auf Basis eines<br />
modernen Wildnisverständnisses räumlich<br />
zu entgrenzen – raus aus Nationalparks,<br />
rein in (sub)urbane Räume. Dem<br />
liegt das Verständnis zugrunde, dass<br />
Wildnis auch in kleinen Räumen und i. S.<br />
verwildernder Flächen vorkommt. Hier-<br />
28<br />
GS aktuell 166 • Mai 2024