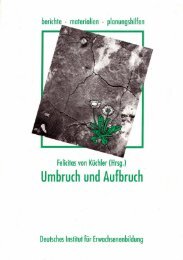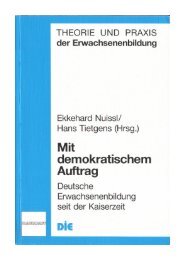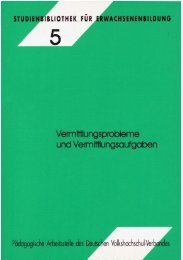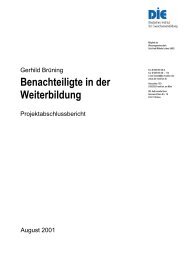Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
38<br />
Eine öffentliche Behandlung dieses Themas hätte<br />
somit die Gesellschaft selbst getroffen. In den letzten<br />
Jahren war allerdings der Trend zu beobachten,<br />
daß man in der familiensoziologischen und kriminologischen<br />
Literatur jener Zeit geschlechtsbezogene<br />
Gewalt als solche wahrgenommen hat. Diese<br />
Vorkommnisse wurden jedoch nie herausgehoben,<br />
sondern verschmolzen mit anderen Problemen und<br />
wurden nicht als Gewalttätigkeiten gekennzeichnet:<br />
Schläge waren z.B. ein nebensächlicher Sonderfall<br />
von Konfliktaustragung in der Ehe oder ein Symptom<br />
zerrütteter Familienverhältnisse. Es fand keine<br />
besondere Beachtung, wer wen schlug. Vergewaltigung<br />
war ein pikanter Teilaspekt von Sexualität<br />
oder wiederum ein Sonderfall von Kriminalität.<br />
Viele Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und<br />
Frauenhaus-Beratungsstellen in Ostdeutschland begründen<br />
ihr Engagement mit eigener Betroffenheit<br />
und selbst erlebten Erfahrungen in der eigenen Beziehung<br />
oder im Beruf (etwa als Krankenschwester,<br />
die jahrelang immer wieder Mißhandlungsverletzungen<br />
gesehen hat). Dies und die Tatsache, daß<br />
bereits die letzte DDR-Regierung die Einrichtung<br />
von Frauenhäusern plante und be<strong>für</strong>wortete,<br />
verdeutlicht, daß gegen Frauen gerichtete innerfamiliäre<br />
Gewalt in der DDR zum Alltag gehörte,<br />
auch wenn sie nicht als solche öffentlich thematisiert<br />
wurde.<br />
Inzwischen begann eine Vielzahl von Frauenhäusern<br />
in Ostdeutschland ihre Arbeit, womit äußerlich<br />
gesehen eine ‚westliche‘ Einrichtung erst einmal im<br />
Osten übernommen wurde. Aber bereits sehr<br />
schnell stellten sich tiefergehende und vielfältige<br />
Probleme bei der Übertragung dieses Modells ein.<br />
Weder auf alltagspraktischer (wie bei der Hausordnung<br />
oder der Beratungsorganisation), noch auf<br />
konzeptioneller (bei der Parteilichkeit <strong>für</strong> Frauen<br />
oder dem Anspruch der Selbsthilfe der Betroffenen),<br />
noch auf der organisatorischen Ebene (etwa die Trägerschaft),<br />
waren die eingeschliffenen Antworten<br />
aus dem Westen der Realität adäquat. Die Übertragbarkeit<br />
der westliche Erklärungsansätze und Praxismodelle<br />
steht in Frage. Die tiefe Spaltung, die<br />
sich zwischen westlichen und östlichen Frauenhauserfahrungen<br />
auftut, ist in mehrfacher Hinsicht exemplarisch.<br />
Einige seien hier kurz umrissen: Die<br />
Frauenhäuser stehen im Westen <strong>für</strong> ein Konfliktmodell<br />
des Geschlechterverhältnisses. Die hohe Akzep-<br />
tanz dieses Modells, das in Westdeutschland mit<br />
starker feministischer Prägung dieses Praxisfeldes<br />
zusammenhängt, erwuchs auf historischem Hintergrund.<br />
Über 25 Jahre hinweg hatte in der Bundesrepublik<br />
eine modernisierte soziokulturelle Trennung<br />
der Sphären von Mann und Frau sich verfestigt.<br />
Frauenhäuser und die ihnen verwandten Projekte<br />
symbolisieren den Anspruch auf eine zivilisierte<br />
Austragung des als selbstverständlich empfundenen<br />
Konfliktes zwischen den Geschlechtern. Diese<br />
Selbstverständlichkeit findet hingegen in Ostdeutschland<br />
keinen vergleichbaren Boden.<br />
Daher leuchten weder die Interpretations- und<br />
Erklärungsmodelle <strong>für</strong> Gewalt gegen Frauen, noch<br />
die eher parteilich und separierend angelegten Maßnahmen<br />
Westdeutschlands unmittelbar ein. Diese<br />
Bewertungsdifferenzen werden noch unzulänglich<br />
artikuliert, da die westlichen Projekte über einen<br />
doppelten, kaum einholbaren Vorsprung verfügen:<br />
Sie verweisen sowohl auf fachliche Ausbildungen in<br />
der sozialen Arbeit, als auch auf viele Jahre Frauenhauspraxis.<br />
Unterschiedliche Sozialisationsbedingungen,<br />
wie sie zwischen Ost und West gegeben<br />
sind, führten zu unterschiedlichen Einstellungen,<br />
Interessen, Bedürfnissen etc. Damit lassen sich die<br />
in Westdeutschland gewonnenen umfangreichen<br />
Kenntnisse zur Thematik nicht ohne weiteres <strong>für</strong> das<br />
Transparentmachen der Ursachen von Gewalt gegen<br />
Frauen im Osten Deutschlands nutzen.<br />
6.3 Familiäre Gewalt in der DDR<br />
Es spricht sehr viel da<strong>für</strong>, daß die Gewaltproblematik<br />
in der DDR eine andere Ausprägung hatte als in<br />
Westdeutschland. Da viele Frauen arbeiten gingen<br />
und Scheidungen relativ leicht möglich waren (hinsichtlich<br />
der materiellen Konsequenzen), waren<br />
langjährige Gewaltbeziehungen sehr selten, ökonomische<br />
Unabhängigkeit und unabhängige Lebensformen<br />
<strong>für</strong> Frauen hatten zumindest Einfluß darauf,<br />
wie die Verweildauer in Gewaltbeziehungen aussah.<br />
Die privatisierten Gewaltverhältnisse hatten sich<br />
auch anders dargestellt auf dem Hintergrund, daß<br />
Frauen im Sozialismus zwar in einem erstaunlich<br />
kleinbürgerlichen Familienmodell lebten (<strong>für</strong> den<br />
Sozialismus sehr erstaunlich), daß aber im Gegensatz<br />
zu den westlichen Ländern, wo es dieses große<br />
Hochhalten von bürgerlichen Familienidealen gibt,