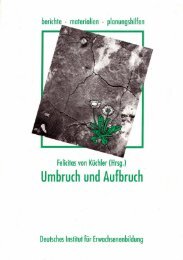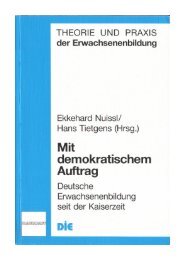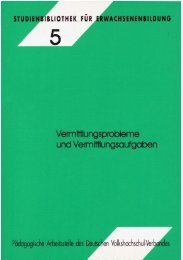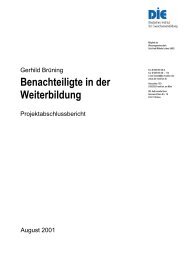Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext (PDF) - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
40<br />
dem alten DDR-Rechtsverfahren, ist dies doch<br />
nicht der einzige Grund. Denn eine Scheidung hat<br />
heute, im Unterschied zum DDR-Recht, einschneidende<br />
soziale Folgen <strong>für</strong> alle Beteiligten.<br />
Kinder sind heute länger von ihren Eltern materiell<br />
abhängig. Einst haben Jugendliche in der DDR<br />
mit Erreichen der wirtschaftlichen Selbständigkeit,<br />
das war <strong>für</strong> etwa 75 % der Zehnteklassenschüler und<br />
Lehrlinge mit Erreichen der Volljährigkeit der Fall,<br />
eine eigene Lebensgestaltung angestrebt, sofern die<br />
Wohnraumlage das zuließ, was in Großstädten eher<br />
der Fall war. Heute ist dies angesichts der hohen<br />
Mieten aber vor allem der hohen Arbeitslosenrate<br />
unter den Jugendlichen schwerer möglich, sie sind<br />
gewissermaßen zum ‚Nesthocken‘ verurteilt. Nur<br />
wenige können sich mit Erreichen der Volljährigkeit<br />
noch eine eigene Wohnung und Lebensführung leisten.<br />
So fühlen sich viele ältere Jugendliche gewissermaßen<br />
zurückgestuft in die elterliche Abhängigkeit,<br />
vermutlich lassen die Eltern sie die vermehrten<br />
finanziellen Belastungen auch spüren. Das<br />
aber trägt letzten Endes zu einer Zuspitzung<br />
innerfamiliärer Konflikte bei, zumal sich die beengte<br />
Wohnraumsituation bei den meisten Familien<br />
eher verschärft hat.<br />
Viele Männer sind unzufrieden mit ihrer Erwerbssituation.<br />
Nur etwa ein Drittel maximal<br />
scheint über einen festen Arbeitsplatz zu verfügen.<br />
Aber die Arbeitsverhältnisse selbst haben sich verändert:<br />
Der Betrieb hat seine Rolle als ‚Freizeitorganisator‘<br />
und zentraler kommunikativer Ort verloren,<br />
die Beschäftigten werden wie in Westdeutschland zu<br />
‚Malochern‘. Zunehmend wird die familiäre Situation<br />
auch durch die Intensivierung der Arbeit in<br />
modernisierten Betrieben oder durch lange Fahrwege<br />
bzw. regelmäßigen, mehrtägigen Aufenthalt in<br />
weit entfernt liegenden Betrieben belastet. So hat<br />
sich also eine erheblich Palette von Unzufriedenheiten<br />
angehäuft, die sich auf das ‚Familienklima‘<br />
auswirken.<br />
Die Frauen waren in der DDR zu einem hohen<br />
Teil erwerbstätig, nirgendwo auf der Welt war die<br />
Quote der erwerbstätigen Frauen höher als in der<br />
DDR. Die oben bereits erwähnten Beziehungen am<br />
Arbeitsplatz in der DDR knüpften das soziokommunikative<br />
Netz der Frauen. Auch wenn sie meistens<br />
mit der Hausarbeit von ihren Ehemänner alleingelassen<br />
wurden und eine Doppelrolle auszufül-<br />
len hatten, hatten sie die Hausarbeit so weit rationalisiert,<br />
daß ihnen eine Ganztagsbeschäftigung als<br />
Hausfrau weder kommunikativ noch ausfüllend erscheint.<br />
Die Hausfrauenrolle wird von den meisten<br />
nicht angenommen, arbeitslose Frauen fühlen sich<br />
unausgelastet und können sich nicht vorstellen, wie<br />
viele ihrer westdeutschen Schwestern sich Sinn<br />
spendend, also hauptamtlich nur mit dem Haushalt<br />
beschäftigen können.<br />
Heute jedoch sind sie Hauptopfer der wirtschaftlichen<br />
Umstrukturierung Ostdeutschlands. Viele<br />
Frauen sind schlicht und einfach frustriert und sie<br />
haben auch allen Grund dazu. Frauen neigen weniger<br />
zur Gewalt als Männer, aber sie thematisieren<br />
doch ihre Unzufriedenheit in den Familien. Es treten<br />
in den Familien Problemfelder auf, die zur Zeit<br />
nicht bearbeitet werden können. Hinzu kommt,<br />
daß sich die Machtverhältnisse in der Familie einseitig<br />
zugunsten der Männern entwickeln. Frauen<br />
signalisieren bereits, daß Männer, die eine gut bezahlte<br />
Stellung haben, und sei es im Westen<br />
Deutschlands, die einseitige materielle Abhängigkeit<br />
der Frauen zur Demonstration von Chauvinismus<br />
nutzen. Wochenendpendler kommen nach Hause<br />
und verordnen der Familie die Unterordnung; die<br />
Konkurrenz im Kampf um den Arbeitsplatz wird in<br />
das eheliche Schlafzimmer verlagert, der Besitzer eines<br />
Arbeitsplatzes sorgt <strong>für</strong> die materielle Reproduktion<br />
der Familie und läßt sich dies durch ein bisher<br />
ungekanntes Verlangen von Dienstleistungen bezahlen.<br />
„Wer verdient, hat das Sagen. Wer mehr verdient<br />
hat, mehr zu sagen...“ Das sind Zitate von<br />
Frauen; Männer äußern dies wohl ziemlich unmißverständlich.<br />
Neu ist, daß dies plötzlich in allen Bevölkerungsschichten<br />
auftritt.<br />
6.5 Eine erste Bilanz der Nachwendezeit:<br />
die Überforderung der Familien<br />
In Beziehungen, in denen Frauen nach der Wende<br />
plötzlich mit psychischer oder physischer Gewalt<br />
konfrontiert wurden, entdecken sie bei ihren Partnern<br />
Verhaltensweisen, die sie früher in dieser Form<br />
nicht festgestellt hatten. In Befragungen wurden als<br />
Gründe <strong>für</strong> das Schlagen angegeben: „grundlose Eifersucht“,<br />
„das Vertreten einer eigenen Meinung“,<br />
„Alkohol“, der „Einfluß anderer“. Diese Faktoren<br />
korrespondieren mit dem traditionellen Rollenver-