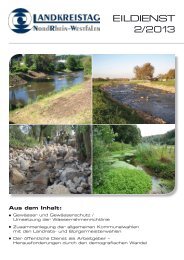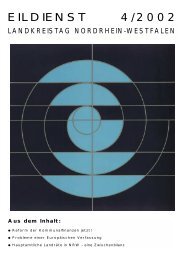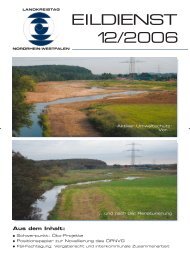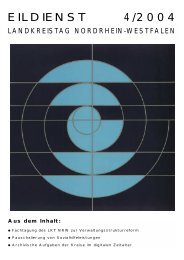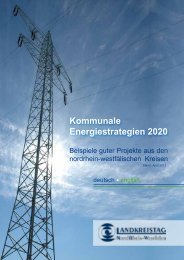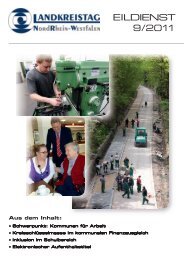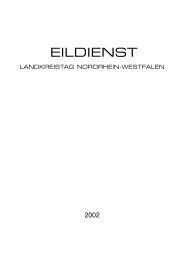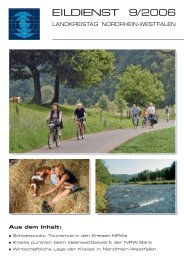von Landrat Gerd W iesmann, (Kreis Borken) - Landkreistag NRW
von Landrat Gerd W iesmann, (Kreis Borken) - Landkreistag NRW
von Landrat Gerd W iesmann, (Kreis Borken) - Landkreistag NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Themen<br />
Notwendig ist es überdies, die Problematik<br />
der Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-<br />
RL 20 bereits auf der Ebene <strong>von</strong> Raumordnung<br />
und Landesplanung aufzugreifen<br />
und nach Möglichkeit für Planungen zu<br />
bewältigen. Wird eine hochstufige Verträglichkeitsprüfung<br />
bereits auf der Ebene<br />
<strong>von</strong> Raumordnung und Landesplanung<br />
durchgeführt, ist im Grundsätzlichen damit<br />
über die Vereinbarkeit oder nicht Vereinbarkeit<br />
eines Projektes oder Planungsverfahren<br />
mit den Schutz- und Erhaltungszielen<br />
europäischer Schutzgebiete entschieden.<br />
Die Problematik kann damit, wird sie<br />
auf der Ebene <strong>von</strong> Raumordnung und Landesplanung<br />
aufgegriffen, im Fall der Nichtvereinbarkeit<br />
bereits auf dieser Planungsstufe<br />
abschließend bewältigt werden. Im<br />
Fall der Vereinbarkeit kann <strong>von</strong> einer derartigen<br />
Prüfung eine erhebliche Entlastungswirkung<br />
für nachfolgende Planungsstufen<br />
ausgehen, da die Verträglichkeitsprüfung<br />
dann auf den nachfolgenden Stufen nicht<br />
mehr in vollem Umfang durchgeführt werden<br />
muss, sondern allenfalls noch ergänzende,<br />
sich aus größerer Detaillierungsschärfe<br />
einer Planung ergebende Prüfungen<br />
erforderlich sind.<br />
Was die Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
angeht, sieht das derzeitige UVP-Verfahren<br />
eine Einbeziehung <strong>von</strong> Raumordnung<br />
und Landesplanung sowie der Gebietsentwicklungsplanung<br />
in die UVP-Pflichtigkeit<br />
nicht vor, sieht man einmal <strong>von</strong> bestimmten<br />
Braunkohleplänen ab, die den Status<br />
<strong>von</strong> bergbaulichen Rahmenplänen haben.<br />
Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gilt<br />
ähnliches wie für die vorgenannten Aspekte:<br />
Die Abschichtungswirkung, die <strong>von</strong><br />
hochstufigen Planverfahren ausgehen<br />
kann, bleibt dann unvollkommen, wenn<br />
die Gebietsentwicklungsplanung in das<br />
System der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
nicht integriert ist. Insoweit ist auch – auch<br />
mit Blick auf die Plan-UVP-RL der EU, die<br />
eine Einbeziehung der Gebietsentwicklungsplanung<br />
in die Plan-UVP vorsieht 21<br />
– das derzeitige System <strong>von</strong> Raumordnung<br />
und Landesplanung einschließlich der<br />
Gebietsentwicklungsplanung defizitär, da<br />
hier<strong>von</strong> nach den geltenden rechtlichen<br />
Vorgaben Entlastungswirkung für nachfolgende<br />
Planungsebenen in der UVP nicht<br />
ausgehen kann.<br />
3. Wege zum Ziel der<br />
Dezentralisation<br />
Eine Dezentralisation in der Landesplanung<br />
ist sinnvoll, um hierdurch die Entschei-<br />
20 Vgl. dazu nur Spannowsky, UPR 2000, 201,<br />
204.<br />
21 So zur Gestaltung des Anzeigeverfahrens in § 11<br />
BauGB: Hoppe, in: Hoppe/Grotefels, Öffentliches<br />
Baurecht, 1995, § 5 RN 99.<br />
114<br />
dungsspielräume auf der regionalen Ebene<br />
zu stärken. Darin besteht nach Einführung<br />
der Regionalräte mit ihren gegenüber den<br />
Aufgaben der Bezirksplanungsräte stark<br />
ausgeweiteten Kompetenzen ein erhebliches<br />
Interesse, sollen die Regionalräte ihre<br />
Aufgabe der integrierten Strukturentwicklung<br />
in den Regierungsbezirken wirklich<br />
vollinhaltlich wahrnehmen können. Bleibt<br />
es bei der bisherigen Systematik und der<br />
Aufgabenabschichtung zwischen Raumordnung<br />
und Landesplanung einerseits<br />
und Gebietsentwicklungsplanung andererseits,<br />
erscheint es zweifelhaft, ob die<br />
Regionalräte <strong>von</strong> ihrer Gestaltungskompetenz<br />
für die Region wirklich in vollem<br />
Umfang Gebrauch machen können. Schon<br />
deshalb ist es sinnvoll, Raumordnung und<br />
Landesplanung stärker als in der Vergangenheit<br />
zu dezentralisieren. Vorteile bietet<br />
eine Dezentralisation auch für eine verstärkte<br />
Geltungskraft des Gegenstromprinzips,<br />
denn je größer die Spielräume auf der<br />
regionalen Ebene sind, um so eher ist es<br />
möglich, Anregungen, die <strong>von</strong> den Akteuren<br />
vor Ort in den Regionalrat eingebracht<br />
werden, aufzugreifen und zu realisieren.<br />
Eine Vernetzung der Planungsebenen und<br />
eine zielgenauere Regionalplanung, die die<br />
Probleme vor Ort wirklich aufgreift und<br />
ihren Anspruch auf großräumige Lenkung<br />
<strong>von</strong> Entwicklungsprozessen gerecht wird,<br />
ist um so eher gewährleistet, je größer die<br />
Spielräume auf der regionalen Ebene sind.<br />
Mit einer Dezentralisation können weitere<br />
Vorteile zugunsten der kommunalen<br />
Gebietskörperschaften einhergehen: Je<br />
größer die Spielräume des Regionalrates in<br />
der Gebietsentwicklungsplanung sind, um<br />
so eher ist gewährleistet, dass den Kommunen<br />
vor Ort ausreichende Planungsspielräume<br />
erhalten bleiben. Sind die Spielräume<br />
bei der Gebietsentwicklungsplanung<br />
nur gering, besteht tendenziell die<br />
Erwartung, dass diese auch in vollen<br />
Umfang ausgeschöpft werden, weil es ja<br />
nicht viel zu entscheiden gibt. Je weiter<br />
diese Spielräume sind, um so eher kann<br />
da<strong>von</strong> ausgegangen werden, dass der<br />
Regionalrat sich einer Selbstbeschränkung<br />
dort unterwirft, wo es genügt, die Ziele<br />
relativ grob zu umschreiben und den<br />
Gemeinden eine Ausfüllung der dann verbliebenen<br />
Freiräume zu ermöglichen.<br />
Dezentralisation in der Landesplanung<br />
kann damit eine gemessen an den Zielsetzungen<br />
<strong>von</strong> Raumordnung und Landesplanung<br />
positive Wirkung entfalten, indem sie<br />
die Möglichkeiten verbessert, auf der<br />
regionalen Ebene Sachprobleme nach den<br />
dort vorhandenen spezifischen Problemlagen<br />
und Entwicklungschancen aufzugreifen<br />
und einer planerischen Lösung zuzuführen.<br />
Die Strukturentwicklung des Landes<br />
wird so verbessert, die Spielräume für<br />
die kommunalen Gebietskörperschaften,<br />
die Entwicklung vor Ort selbst zu lenken<br />
und zu steuern, können so vergrößert werden.<br />
Für die Strukturentwicklung kann dies<br />
nur vorteilhaft sein.<br />
Eine Dezentralisation der Landesplanung<br />
setzt Änderungen in mehreren Bereichen<br />
voraus. Dazu gehören<br />
– das Planungsverfahren,<br />
– die Planungssystematik und<br />
– die Planinhalte.<br />
3.1 Planungsverfahren<br />
3.1.1 Anzeige- statt<br />
Genehmigungsverfahren<br />
Die Verfahrensverzögerungen einerseits<br />
und die mit dem Genehmigungsverfahren<br />
verbundene Tendenz der Landesplanungsbehörde<br />
jenseits einer Rechtskontrolle in<br />
die Planinhalte hinein zu regieren, können<br />
durch eine Ersetzung des Genehmigungsverfahrens<br />
durch ein Anzeigeverfahren<br />
bewältigt werden. Vorbild könnte insoweit<br />
das Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 1<br />
Satz 1, 2. HS BauGB a. F. sein. Nach dieser<br />
Regelung waren Bebauungspläne, die aus<br />
dem Flächennutzungsplan entwickelt<br />
waren, der höheren Verwaltungsbehörde<br />
nach Satzungsbeschluss durch die Gemeinde<br />
anzuzeigen. Äußerte sich die höhere<br />
Verwaltungsbehörde innerhalb einer Frist<br />
<strong>von</strong> drei Monaten nicht, konnte die<br />
Gemeinde den Bebauungsplan in Kraft setzen.<br />
Nach Ablauf der Frist konnte die<br />
höhere Verwaltungsbehörde erklären, dass<br />
sie keine Verletzung konkreter Vorschriften<br />
geltend machen werde. Hatte die höhere<br />
Verwaltungsbehörde innerhalb der Dreimonatsfrist<br />
Bedenken hinsichtlich der<br />
Rechtmäßigkeit, konnte sie etwaige<br />
Rechtsverstöße geltend machen mit der<br />
Folge, dass die Gemeinde den Plan nicht<br />
durch Veröffentlichung in Kraft setzen<br />
konnte. Durch dieses Verfahren sollte der<br />
Planungshoheit der Gemeinden Rechnung<br />
getragen und die Kontrolle auf eine reine<br />
Rechtmäßigkeitsaufsicht zurückgeführt werden.<br />
Daneben sollte ein erheblicher<br />
Beschleunigungseffekt bewirkt werden, da<br />
innerhalb <strong>von</strong> drei Monaten grundsätzlich<br />
über die Rechtskraft eines Bebauungsplanes<br />
entschieden werden sollte.<br />
Es bietet sich an, ein solches Verfahren<br />
auch für die Gebietsentwicklungsplanung<br />
vorzusehen. Für die Einführung eines solchen<br />
Verfahrens spricht zunächst die<br />
Rechtsähnlichkeit zwischen der Bauleitplanung<br />
und der Gebietsentwicklungsplanung:<br />
Hier wie dort geht es darum, den<br />
Plan einer Rechtmäßigkeitskontrolle zu<br />
unterwerfen und dabei zugleich die Planungsautonomie<br />
der planenden Ebene zu<br />
wahren. Dabei sind die Prüfungsmaßstäbe<br />
für die Rechtskontrolle im wesentlichen