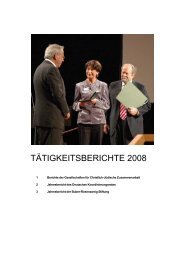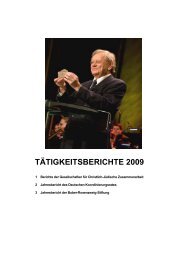epd Dokumentation online - Der Deutsche Koordinierungsrat der ...
epd Dokumentation online - Der Deutsche Koordinierungsrat der ...
epd Dokumentation online - Der Deutsche Koordinierungsrat der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52 10/2007 <strong>epd</strong>-<strong>Dokumentation</strong><br />
die« auf Judentum und Christentum. 17 Er ist »von<br />
vornherein Religion und will gar nichts an<strong>der</strong>es<br />
sein; er ist mit Bewusstsein ‚gestiftet‘«.<br />
Diese religionskritische Sicht erinnert an Karl<br />
Barth, für den die Religionen in ihrer Religionshaftigkeit<br />
»Unglaube«, die »Angelegenheit des<br />
gottlosen Menschen« sind – das Christentum eingeschlossen.<br />
18 Immer wie<strong>der</strong> ruft Gottes lebendige<br />
Stimme und Wort, seine Offenbarung aus dem<br />
Gehäuse <strong>der</strong> Religion, aus dieser »Babylonischen<br />
Gefangenschaft <strong>der</strong> Kirche«, für die F. Dostojewskis<br />
Großinquisitor <strong>der</strong> prototypische Vertreter ist,<br />
heraus. An<strong>der</strong>erseits ist für Barth Religion das<br />
»menschliche Gesicht« <strong>der</strong> Offenbarung. 19<br />
Während seiner Übersetzung <strong>der</strong> Gedichte Jehudas<br />
Halevis liest Rosenzweig immer wie<strong>der</strong> Karl<br />
Barth. Er findet ihn – im Gegensatz zu Sören<br />
Kierkegaards existentiellem Denken – zu abstrakt.<br />
Er ahnt nichts von dem Ringen um Predigt und<br />
Unterricht, um soziale Gerechtigkeit in Barths<br />
Gemeinde Safenwil, woraus die existentiell<br />
höchst lebendigen Fragen und die Kirchen- wie<br />
Religionskritiken Barths stammen. Gott als <strong>der</strong><br />
»ganz An<strong>der</strong>e«, er sollte zu einer an ihn »gewöhnlich-gewöhnten«<br />
Christenheit wie<strong>der</strong> neu<br />
sprechen. Das war des jungen Barth Abschied<br />
von je<strong>der</strong> Theologie und Religion, die vom Menschen<br />
ausgeht. Damals, in <strong>der</strong> Aufbruchzeit <strong>der</strong><br />
Wort-Gottes-Theologie war für ihn, so wird Barth<br />
später erzählen, »<strong>der</strong> Mond nur halb zu sehen,<br />
und ist doch rund und schön« (Matthias Claudius).<br />
Zum vollen Schein des Mondes gehören<br />
später in seiner kirchlichen Dogmatik konstitutiv<br />
humane Ethik und die Entdeckung <strong>der</strong> bleibenden<br />
Erwählung Israels und ihrer Bewährung im<br />
Kirchenkampf gegen das NS-Regime, obwohl<br />
traditionelle Relikte eines Denkens bei Barth nicht<br />
ganz verschwunden sind, die Juden theologisch<br />
herabwürdigen, z.B. als »Spiegel des Zornes<br />
Gotttes« im Vergleich zum »Spiegel <strong>der</strong> Gnade«,<br />
<strong>der</strong> zu sein er <strong>der</strong> Kirche zuschreibt. 20<br />
Aber eine an<strong>der</strong>e Parallele zwischen Barth und<br />
Rosenzweig ist für unseren Zusammenhang<br />
wichtiger. Es ist die Rede von <strong>der</strong> Schwierigkeit,<br />
Theologie zu treiben. Sie erfährt Gott und seine<br />
Offenbarung als »totaliter aliter« gegenüber allen<br />
menschlichen, gerade auch religiösen Zugriffen,<br />
wie es die von Sören Kierkegaard und Karl Barth<br />
benutzte Formel auszudrücken versucht. »Die<br />
Unterschiedenheit von Gott und Mensch, dieser<br />
furchtbare Anstoß für alles neue und alte Heidentum,<br />
<strong>der</strong> beleidigende Gedanke <strong>der</strong> Offenbarung,<br />
dies Hereinstürzen höheren Inhalts in unwürdiges<br />
Gefäß, ist zum Schweigen gebracht.« 21<br />
Wenn christlicherseits eine idealistische (Jesus als<br />
<strong>der</strong> ideale Mensch) o<strong>der</strong> gar historische Selbstvergewisserung<br />
(wie z.B. in <strong>der</strong> Leben Jesu Forschung)<br />
Platz greifen würde; und jüdischerseits<br />
eine »Judenvolkstheologie«, die das Volk vergöttert,<br />
dann ist dagegen die Unverfügbarkeit <strong>der</strong><br />
göttlichen Offenbarung neu zu lernen. Das jüdische<br />
Volk verlöre die drei Strahlen des Sterns <strong>der</strong><br />
Erlösung: »Gottes Macht und Demut, des jüdischen<br />
Menschen Auserwähltheit sowie <strong>der</strong> jüdischen<br />
Welt Diesseitigkeit und Zukünftigkeit.« 22<br />
Im ersten Teil insistiert Rosenzweig »In Philosophos!«<br />
auf dem Ursprung <strong>der</strong> Wahrheit in Gott,<br />
und nennt die Schwierigkeit <strong>der</strong> Theologie: »Von<br />
Gott wissen wir nichts. Aber dieses Nichtwissen<br />
ist Nichtwissen von Gott. Als solches ist es <strong>der</strong><br />
Anfang unseres Wissens von Gott.« 23 Rosenzweig<br />
drückt präzise die Fremdheit und die Nähe, die<br />
Schwierigkeit, von Gott zu reden, und die Offenheit<br />
für Gott aus.<br />
Barth schreibt zur gleichen Zeit einen ähnlichen<br />
Gedanken nie<strong>der</strong>: »Wir sollen als Theologen von<br />
Gott reden. Wir sind aber Menschen und können<br />
als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides,<br />
unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen<br />
und eben damit Gott die Ehre geben.« 24<br />
Gegen<br />
jedes pausbäckige o<strong>der</strong> folkloristische Reden von<br />
und mit Gott, gegen jedes liturgische und dogmatische<br />
Einfangen Gottes in Sätze und Rituale wird<br />
hier von beiden Denkern dialektisch an das erste<br />
Gebot erinnert: Gott in seiner Unverfügbarkeit die<br />
Ehre zu gegen und zugleich – auch das sagt das<br />
erste Gebot – auf die tatsächliche Selbsterschließung<br />
Gottes in <strong>der</strong> erwählenden Berufung und<br />
konkreten Befreiung aus Zwangsarbeit und<br />
Fremdbestimmung in Ägypten zu hören – und<br />
dort, im Christentum Barths, die Selbsterschließung<br />
Gottes in Jesus von Nazaret zu vernehmen<br />
und entsprechend zu leben. Auf christlicher Seite<br />
hat diese Barthschen und Rosenzweigschen Gedanken<br />
am originellsten aufgenommen <strong>der</strong> holländische<br />
Protestant Kornelis Heiko Mislotte in<br />
seinem Buch »Wenn die Götter schweigen«. Es<br />
erschien zuerst 1956 in den Nie<strong>der</strong>landen und hat<br />
zwei Vorläufer, die zum Schaden <strong>der</strong> Christenheit<br />
zu wenig zur Kenntnis genommen wurden. 1932<br />
stellte er »Das Wesen des Judentums« einer<br />
christlichen Welt vor, die meinte aus dem Alten<br />
Testament (in christlicher Interpretation!) und<br />
aus dem Johannesevangelium wie von Paulus<br />
genug über »das« Judentum zu wissen. 1939 veröffentlichte<br />
er »Edda en Tora. Een vergelijking<br />
van germaansche en Israelitische religie«. Diese<br />
Schriften arbeiten nicht zuletzt die Kritik an allen<br />
Nationalismen (und an<strong>der</strong>en, sich absolut set-