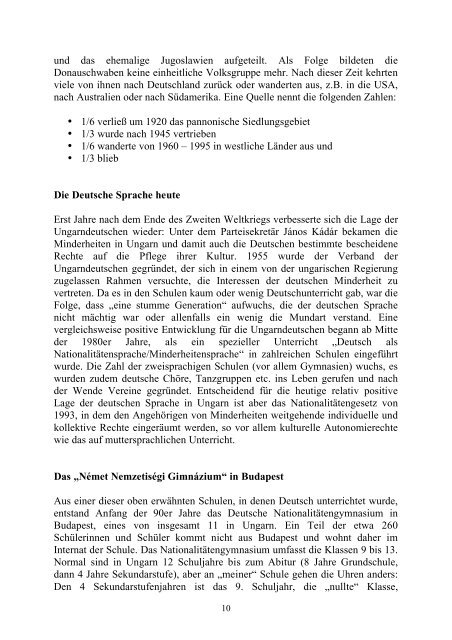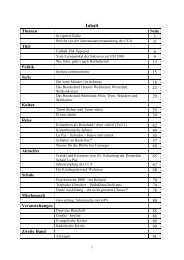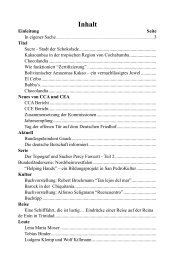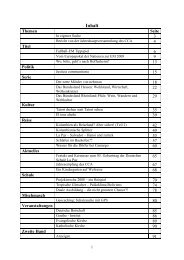IV - CCA Monatsblatt
IV - CCA Monatsblatt
IV - CCA Monatsblatt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und das ehemalige Jugoslawien aufgeteilt. Als Folge bildeten die<br />
Donauschwaben keine einheitliche Volksgruppe mehr. Nach dieser Zeit kehrten<br />
viele von ihnen nach Deutschland zurück oder wanderten aus, z.B. in die USA,<br />
nach Australien oder nach Südamerika. Eine Quelle nennt die folgenden Zahlen:<br />
• 1/6 verließ um 1920 das pannonische Siedlungsgebiet<br />
• 1/3 wurde nach 1945 vertrieben<br />
• 1/6 wanderte von 1960 – 1995 in westliche Länder aus und<br />
• 1/3 blieb<br />
Die Deutsche Sprache heute<br />
Erst Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verbesserte sich die Lage der<br />
Ungarndeutschen wieder: Unter dem Parteisekretär János Kádár bekamen die<br />
Minderheiten in Ungarn und damit auch die Deutschen bestimmte bescheidene<br />
Rechte auf die Pflege ihrer Kultur. 1955 wurde der Verband der<br />
Ungarndeutschen gegründet, der sich in einem von der ungarischen Regierung<br />
zugelassen Rahmen versuchte, die Interessen der deutschen Minderheit zu<br />
vertreten. Da es in den Schulen kaum oder wenig Deutschunterricht gab, war die<br />
Folge, dass „eine stumme Generation“ aufwuchs, die der deutschen Sprache<br />
nicht mächtig war oder allenfalls ein wenig die Mundart verstand. Eine<br />
vergleichsweise positive Entwicklung für die Ungarndeutschen begann ab Mitte<br />
der 1980er Jahre, als ein spezieller Unterricht „Deutsch als<br />
Nationalitätensprache/Minderheitensprache“ in zahlreichen Schulen eingeführt<br />
wurde. Die Zahl der zweisprachigen Schulen (vor allem Gymnasien) wuchs, es<br />
wurden zudem deutsche Chöre, Tanzgruppen etc. ins Leben gerufen und nach<br />
der Wende Vereine gegründet. Entscheidend für die heutige relativ positive<br />
Lage der deutschen Sprache in Ungarn ist aber das Nationalitätengesetz von<br />
1993, in dem den Angehörigen von Minderheiten weitgehende individuelle und<br />
kollektive Rechte eingeräumt werden, so vor allem kulturelle Autonomierechte<br />
wie das auf muttersprachlichen Unterricht.<br />
Das „Német Nemzetiségi Gimnázium“ in Budapest<br />
Aus einer dieser oben erwähnten Schulen, in denen Deutsch unterrichtet wurde,<br />
entstand Anfang der 90er Jahre das Deutsche Nationalitätengymnasium in<br />
Budapest, eines von insgesamt 11 in Ungarn. Ein Teil der etwa 260<br />
Schülerinnen und Schüler kommt nicht aus Budapest und wohnt daher im<br />
Internat der Schule. Das Nationalitätengymnasium umfasst die Klassen 9 bis 13.<br />
Normal sind in Ungarn 12 Schuljahre bis zum Abitur (8 Jahre Grundschule,<br />
dann 4 Jahre Sekundarstufe), aber an „meiner“ Schule gehen die Uhren anders:<br />
Den 4 Sekundarstufenjahren ist das 9. Schuljahr, die „nullte“ Klasse,<br />
10