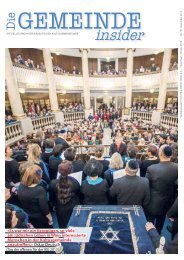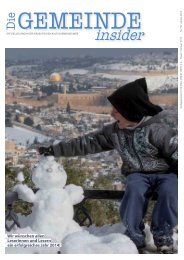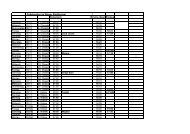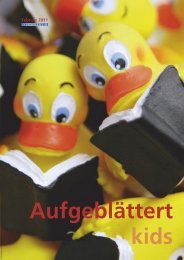Die Gemeinde - Israelitische Kultusgemeinde Wien
Die Gemeinde - Israelitische Kultusgemeinde Wien
Die Gemeinde - Israelitische Kultusgemeinde Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
en den sowie Holocaust-Überlebenden<br />
beziehungsweise deren nach fah -<br />
ren zu beantworten. Letztere werden<br />
sofort bearbeitet. Bei Abfragen für<br />
For schungs- oder Gedenkprojekte so -<br />
wie Dissertationen und Diplomarbei<br />
ten könne die Wartezeit jedoch bis<br />
zu zwei monate betragen, bedauert<br />
Uslu-Pauer.<br />
Derzeit ist das Archiv der iKG nicht<br />
öf fentlich zugänglich. Das heißt: es<br />
kann weder von Wissenschaftern<br />
noch von Privatpersonen direkt ge -<br />
nutzt wer den. Persönlich mit den ma -<br />
teria li en arbeiten dürfen nur die mit -<br />
ar bei ter der Res titutionsabteilung der<br />
Kultus ge mein de sowie, unter Anlei -<br />
tung, die mitglie der der Kommission<br />
für Pro ve nienz forschung sowie mit -<br />
ar beiter des na ti o nalfonds der Repu -<br />
blik Ös ter reich und des Allgemeinen<br />
Ent schä di gungs fonds.<br />
Was aber macht das Archiv der iKG<br />
so einzigartig? Herausstechend sind<br />
vor allem der lange Zeitraum, über<br />
den material gesammelt wurde, und<br />
die Fülle der Dokumente – darunter<br />
auch detailliertes material aus der<br />
nS-Zeit, wie etwa tausende und abertausende<br />
Karteikarten sowie Auswan -<br />
derungs-Fragebögen. Was die Arbeit<br />
der heutigen Archivare schwierig<br />
macht, ist die „Zerrissenheit der Be stän -<br />
de“ ab der nS-Zeit, sagt Uslu-Pau er.<br />
So wurden Teile der Akten von den<br />
nationalsozialisten zunächst nach Ber -<br />
lin ins Reichssicherheitshauptamt ver -<br />
bracht, im Sommer 1943 im Zug der<br />
Luftangriffe allerdings nach Schlesien<br />
übersiedelt. Dort wurden sie nach<br />
Ende des Zweiten Weltkriegs von der<br />
Roten Armee entdeckt und nach mos -<br />
kau transportiert, wo sie bis heute<br />
lagern. <strong>Die</strong>se Bestände könnten übrigens<br />
in absehbarer Zeit wieder nach<br />
<strong>Wien</strong> übersiedelt werden. im vergangenen<br />
mai wurde die Sichtung des<br />
Gesamtbestandes in moskau abgeschlossen.<br />
iKG und Außenministe ri um<br />
bemühen sich derzeit um die Rück ga -<br />
be der über 1.200 Archivkartons. nun<br />
gilt es die Entscheidung Russlands<br />
abzuwarten.<br />
Andere materialien wiederum, die<br />
aus der Zeit vor 1938 und aus der nS-<br />
Zeit stammen, wurden in mehreren<br />
Tranchen in den 1950-er bis 1970-er<br />
Jahren nach Jerusalem verbracht, wo<br />
sie bis heute als Leihgabe der iKG in<br />
IN EIGENER SACHE • HINTER DEN KULISSEN<br />
den Central Archives for the History of<br />
the Jewish People lagern.<br />
Und der dritte große Teil des Archivs,<br />
dessen Kern Dokumente aus der nS-<br />
Zeit bilden, der aber auch material<br />
aus der Zeit vor 1938 und nach 1945<br />
umfasst, wurde 1986 bei Umbauar bei -<br />
ten im Keller der Seitenstettengasse<br />
zum ersten mal entdeckt. Wohin dieser<br />
Archivbestand damals gebracht<br />
wurde, geriet allerdings in Verges sen -<br />
heit und sollte sich erst 2000 klären.<br />
in diesem Jahr wurden in einem La -<br />
ger in der Herklotzgasse kistenweise<br />
Dokumente gefunden, welche die iKG-<br />
Verantwortlichen daraufhin um ge hend<br />
in die Räumlichkeiten der An lauf stel le<br />
der iKG transportieren ließen. in den<br />
hunderten Kisten fanden sich schließlich<br />
u.a. an die 500.000 Blätter aus der<br />
nS-Zeit – wertvolles material nicht nur<br />
zur Aufarbeitung der Shoah mit personenbezogenen<br />
Karteien, son dern<br />
auch zur Beantwortung von Fragen<br />
zum Ver mögensentzug und ei ner allfälligen<br />
„Wiedergut ma chung“.<br />
<strong>Die</strong> Ur sprün ge<br />
des Ar chivs reichen<br />
in des sen<br />
we sent lich wei -<br />
ter zu rück.<br />
Of fi zi ell ge grün -<br />
det wur de das<br />
Ar chiv der Kul -<br />
tus ge mein de<br />
im Juni 1816.<br />
<strong>Die</strong> Vertreter der<br />
jü di schen Gemein -<br />
de be schlossen da -<br />
mals, den Aktuar,<br />
so nann te man den<br />
Schriftführer, „zu ver -<br />
anlassen, alle Akten -<br />
stücke, die in An ge le gen -<br />
heiten der hiesigen Israeli ten<br />
ergan gen sind, zusam men -<br />
zulegen, um sie zu ei nem<br />
gewissen Gebrauche zu verwenden“.<br />
Gesammelt und dokumentiert<br />
werden sollten damit beispielsweise<br />
alle Patente, also kaiserliche Er -<br />
lässe und Verordnungen, welche die<br />
Rechte und Pflichten der ortsansässigen<br />
Juden re gelten.<br />
Es dauerte jedoch weitere 30 Jahre, „bis<br />
sich das Archiv institutionalisierte“, er -<br />
zählt Uslu-Pauer. Der damalige Ar -<br />
chi var Ludwig August Frankl sorgte für<br />
eine bessere Unterbringung der Ar chi -<br />
valien und ließ im Gebäude der Ge -<br />
mein de in der Seitenstettengasse ei nen<br />
Archivraum einrichten. <strong>Die</strong> alten und<br />
neu hinzukommenden Ak ten stücke<br />
wur den sukzessive geordnet, indiziert<br />
und katalogisiert. Wie einem Bericht<br />
Frankls vom September 1841 zu entnehmen<br />
ist, umfassten die Bestände zu<br />
diesem Zeitpunkt 10.145 Akten stü cke,<br />
davon 22 aus den Jahren 1626 bis 1805,<br />
die restlichen aus der Zeit danach.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde<br />
die „Historische Kommission“ ge grün -<br />
det. „Sie sollte sich mit der wissenschaftlichen<br />
Aufarbeitung der Geschichte der<br />
Ju den in Österreich befassen und zu diesem<br />
Zweck sämtliche, in österreichischen<br />
Ar ch i ven verfügbaren historischen Quel -<br />
len, zu diesem Thema identifizieren und<br />
sammeln“, sagt Uslu-Pauer. <strong>Die</strong> Grün de<br />
für diese initiative seien nicht eindeutig<br />
belegt. „Ein Grund könnte in dem zuneh<br />
menden Bedürfnis nach Iden ti tätssi -<br />
cherung liegen“, meint die Lei te rin des<br />
iKG-Archivs. „Ein weiterer könnte auch<br />
gewesen sein, dem damals stark wachsenden<br />
Antisemitismus mit fun diertem<br />
Wissen über die Geschichte der Juden in<br />
Österreich entgegentreten zu kön nen.“<br />
Unmittelbar nach dem „An -<br />
schluss“ Österreichs an Hit ler-<br />
Deutschland im märz 1938<br />
wurde das Archiv aufgelöst<br />
und die <strong>Kultusgemeinde</strong> zu -<br />
nächst geschlossen, im mai<br />
1938 jedoch wieder geöffnet<br />
und gezwungen, „unter<br />
An weisung der NS-Be hör -<br />
den die Aus wan de rung<br />
der jüdischen Be völ ke -<br />
rung und in wei terer<br />
Folge die De por ta -<br />
tion von Jü din nen<br />
und Ju den in die<br />
Kon zen tra tions- und<br />
Vernich tungs lager zu<br />
organisieren“.<br />
Erschütternde, großformatige Dokumente<br />
aus dieser Zeit, die sich bis<br />
heute im Archiv der iKG, aber auch<br />
teils in moskau, befinden: Wand ta -<br />
feln, auf denen schematisch „<strong>Die</strong> jüdische<br />
Wanderung aus der Ostmark“ dargestellt<br />
wird. <strong>Die</strong> Tafeln seien vermutlich<br />
im Auftrag der „Zentralstelle<br />
für jüdische Auswanderung“ von<br />
mitarbeitern der <strong>Kultusgemeinde</strong> an -<br />
gefertigt worden, so Uslu-Pauer. Für<br />
die Leiterin des Archivs sind diese<br />
August 2009 - Aw/Elul 5769 5