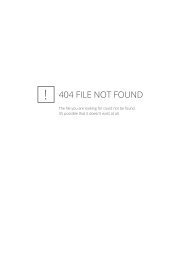Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe ... - WZB
Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe ... - WZB
Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe ... - WZB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
40<br />
Armen erfor<strong>der</strong>te, wurde Gesundheit im späten 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
als Resultat städtischer Umwelthygiene erkannt. Daraus bildete<br />
sich eine Hygienebewegung, die unter <strong>der</strong> Thematik <strong>der</strong> Sozial<br />
hygiene auch rassische Eugenik einbezog. Aus <strong>der</strong> Perspektive,<br />
daß die Rassenhygiene des Nationalsozialismus an die früheren<br />
Hygieneprogramme anknüpfte, was man heute nicht vergessen<br />
solle, warnt Stollberg vor den Implikationen <strong>der</strong> neuen gesund<br />
heitspolitischen Kontrollprogramme:<br />
"Die Rassenhygiene hat sich um den Gesundheitszustand einer als<br />
Ganzheit begriffenen Population bemüht; um Prävention und<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung war es ihr in beson<strong>der</strong>er Weise zu tun. Die<br />
Lenkung von Gesundheitspolitik lag durchaus in ihrem Blickfeld.<br />
Insofern muß im Sinne von Baduras Definition auch die Rassenhygiene<br />
als eine Konzeption von Public Health begriffen werden.<br />
Überdies wurde sie von einer zeitgenössischen sozialen Bewegung<br />
aufgegriffen. Daß die Rassenhygiene insofern in die Ahnenreihe<br />
von Public Health-Konzeptionen gehört, sollte für die Gegenwart<br />
bedenklich stimmen" (1993:10-11).<br />
Hier wird die Interventionslogik <strong>der</strong> Präventionsprogramme des<br />
"neuen Public Health" problematisiert: Man kann also nicht<br />
davon ausgehen, daß die Public-Health-Stellen, die sich um die<br />
Verbesserung <strong>der</strong> gesundheitlichen Situation einer Bevölkerung<br />
bemühen, eo ipso das "bessere Wissen" haben und auch das<br />
Richtige tun. Es wäre ebensogut denkbar, daß hier ein neues<br />
Expertentum mit gesundheitswissenschaftlichem Selbstbewußtsein<br />
entsteht, das sich selbst als Gegenkraft gegen das Expertentum<br />
<strong>der</strong> Medizin setzt. Deren professionelle Kompetenz mag mit viel<br />
fältigen Begründungen als inadäquat o<strong>der</strong> sogar gesundheitlich<br />
kontraproduktiv abgelehnt werden - siehe beispielsweise von<br />
Ferbers Kritik an <strong>der</strong> Medikalisierung durch die Medizin. Aber<br />
die weltanschauliche Einseitigkeit, die in den Argumentationen<br />
gegen das klinische Denken und Handeln steckt, ist unüberseh<br />
bar. Am deutlichsten wurde sie in Ivan Illichs polemischem<br />
Essay Die Nemesis <strong>der</strong> Medizin (1975). Er bezweifelte die<br />
Leistungskompetenz <strong>der</strong> professionellen Medizin und propagierte<br />
eine Rückkehr zur Natur des "nichtentfremdeten" Lebens und<br />
Leidens. Dabei wurden <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Klinik Fehlentwicklungen zur<br />
Last gelegt, die die Kultur und selbst die Selbstbestimmung des<br />
Menschen zerstört hätten. Illichs Thesen waren mehr als ein<br />
Jahrzehnt bis in die zweite Hälfte <strong>der</strong> achtziger Jahre en<br />
yocrue, obwohl heute ihr Dilettantismus durchschaut wird. Aber