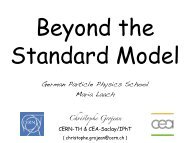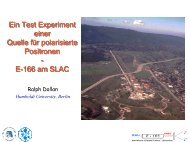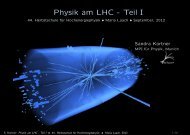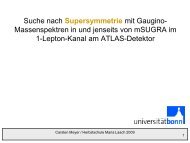Skript - Herbstschule Maria Laach
Skript - Herbstschule Maria Laach
Skript - Herbstschule Maria Laach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Spin-0:<br />
Feynmanregeln 47<br />
p<br />
⇐⇒<br />
i<br />
p 2 − m 2 + iǫ<br />
(120c)<br />
Die S-Matrix enthält immer ein (meistens) uninteressantes diagonales Stück und die globale<br />
Impulserhaltung<br />
S = 1 + (2π) 4 δ 4 (p1 + p2 − q1 − q2 . . . − . . . qn)iT (121)<br />
so daß wir uns auf T konzentrieren können. Die Anwendung der folgenden Feynman-Regeln liefert<br />
den Ausdruck für iT:<br />
1. Zeichne alle Diagramme aus Propagatoren und Wechselwirkungsvertices, die den<br />
Anfangszustand mit dem Endzustand verbinden und lege die Impulse der äußeren Linien<br />
entsprechend fest.<br />
2. Nutze die Impulserhaltung an jedem Vertex, um die Impulse der inneren Linien festzulegen.<br />
3. Verfolge jede zusammenhängende Fermionenlinie entgegen der Pfeilrichtung und schreibe den<br />
entsprechenden Ausdruck aus Propagatoren und Vertices.<br />
4. Vervollständige iT durch die verbleibenden Propagatoren und Vertices.<br />
5. Addiere die Diagramme mit Vorzeichen, so daß das Ergebnis anti-symmetrisch unter dem<br />
Austausch von äußeren (Anti-)Fermionen ist.<br />
Th. Ohl Feynmandiagramme für Anfänger <strong>Maria</strong> <strong>Laach</strong> 2007<br />
Feynmanregeln 48<br />
• In Diagrammen mit Schleifen sind nicht alle Impulse festgelegt, z. B.:<br />
und über die freien Impulse ist mit<br />
zu integrieren.<br />
k<br />
p − k<br />
es gibt unendlich viele Schleifendiagramme zu jedem Prozeß!<br />
p<br />
k<br />
4 d p<br />
· · · (122)<br />
(2π) 4<br />
• die Schleifendiagramme haben aber mehr Vertices und damit eine höhere Ordnung der<br />
Kopplungskonstanten<br />
in schwach wechselwirkenden Theorien können die Beiträge von Schleifendiagrammen<br />
sukzessive in Störungsrechnung berücksichtigt werden.<br />
Gegenstand einer der anderen Übungen . . .<br />
Th. Ohl Feynmandiagramme für Anfänger <strong>Maria</strong> <strong>Laach</strong> 2007<br />
Definition aus physikalischen Größen<br />
Wirkungsquerschnitt 49<br />
σ (∆Φ) = R(∆Φ)<br />
j<br />
(123)<br />
∆Φ = Phasenraumbereich (124a)<br />
σ (∆Φ) = Wirkungsquerschnitt für Streuung in ∆Φ (124b)<br />
R(∆Φ) = Ereignisrate in ∆Φ (124c)<br />
j = einfallender Fluß (124d)<br />
Der einfallende Fluß j ist für fixed targed Experimente die Anzahl der einfallenden Teilchen pro<br />
Zeiteinheit und pro Flächenelement.<br />
Differentieller Wirkungsquerschnitt:<br />
σ (∆Φ) =<br />
<br />
∆Φ<br />
Phasenraumelement dΦ, z. B. dΩ = sinθdθdφ für 2 → 2.<br />
dσ<br />
(Φ)dΦ (125)<br />
dΦ<br />
Eine sorgfältige Konstruktion von Wellenpaketen für die einlaufenden Teilchen erlaubt es, den<br />
differentiellen Wirkungsquerschnitt durch die Streuamplitude T und das Phasenraumvolumen<br />
auszudrücken. Hier genüge die nachfolgende Formel ohne Beweis.<br />
Th. Ohl Feynmandiagramme für Anfänger <strong>Maria</strong> <strong>Laach</strong> 2007