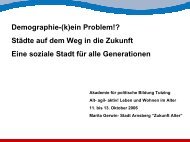3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft –<br />
Zukunft ohne Arbeit?<br />
Visionen in der Literatur und in Filmen erweisen sich oft als<br />
schneller realisierbar als vielleicht sogar vom Autor angenommen.<br />
Science Fiction-Romane oder -Filme sind nicht abgehobene<br />
Gedankenspielereien oder Phantasien hyperkreativer Hirne,<br />
sondern Gesellschaftskritik pur. Unsere Welt hat sich aus und<br />
auf Visionen hin entwickelt. Gerade Filme, <strong>für</strong> viele selbst eine Vision,<br />
nehmen später eintreffende Wirklichkeit und Realität häufig<br />
vorweg. Dies zeigte eine auch historisch angelegte Tagung <strong>für</strong> Filmbegeisterte<br />
in Zusammenarbeit mit der LAG Film Bayern. Bei den<br />
Visionen durfte natürlich das Thema „Zukunft der Arbeit“ nicht<br />
fehlen. Der Volkswirt und Soziologe Gerd Mutz von der Fachhochschule<br />
München und Direktor des Munich Institute for Social Sciences<br />
(MISS) sprach über die aktuelle Situation und mögliche Szenarien,<br />
wie sich die Welt der Arbeit verändern könnte.<br />
Ausgehend von der wirtschaftlichen<br />
Situation stellte Mutz fest, dass<br />
Deutschland seit 2003 wieder „Export-<br />
Weltmeister“ ist. In den letzten fünf<br />
Jahren seien die Exporte um 48 Prozent<br />
gestiegen. Entgegen allen Unkenrufen<br />
sei Deutschland als Standort nach<br />
wie vor attraktiv: es belegt Platz 5 bei<br />
den Direktinvestitionen in OECD-Länder.<br />
Mutz’ Fazit: „Im Hinblick auf die<br />
Kostensituation und das Preis-/Leistungsverhältnis<br />
ist Deutschland international<br />
wettbewerbsfähig. Allein der<br />
Export begründet die positiven Wachstumsraten<br />
in Deutschland.“ Und die so<br />
häufig gescholtene Globalisierung<br />
habe die wirtschaftliche Situation in<br />
Deutschland netto verbessert.<br />
Rege Umverteilung<br />
Auch die häufig als zu hoch bezeichnete<br />
Staatsquote sei nicht das Problem:<br />
sie liegt mit 48 Prozent seit 35 Jahren<br />
unverändert im europäischen Mittelfeld<br />
– und das trotz der erheblichen<br />
Lasten der deutschen Einheit.<br />
Diese Staatsquote werde überwiegend<br />
durch Abgaben auf den Faktor Arbeit<br />
finanziert: zum einen die Sozialabgaben,<br />
aber auch durch eine hohe Lohnsteuer<br />
und indirekte Steuern (Mehrwert-,<br />
Mineralöl- und Ökosteuer). Das<br />
mache 85 Prozent des gesamten Steueraufkommens<br />
aus. Nur 15 Prozent<br />
kommen von Unternehmen und Selbstständigen.<br />
Zum Vergleich: 1971 waren<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 3/20<strong>05</strong><br />
es hier noch 31 Prozent. „Da ist also<br />
eine rege Umverteilung im Gange“,<br />
sagte Mutz. Der Münchner Volkswirt<br />
sieht das Hauptproblem bei der zu geringen<br />
Kaufkraft bei den privaten<br />
Haushalten und der zu hohen Sparquote.<br />
Gerd Mutz: stärkste Umverteilung<br />
zu Lasten der Arbeitnehmer seit<br />
1945 Foto:ms<br />
Kaufkraft stärken<br />
Die Arbeitsproduktivität in Deutschland<br />
ist hoch: mit einer geringen Anzahl<br />
von Arbeitskräften kann ein hohes<br />
Wachstum erzeugt werden. Deshalb<br />
liegen die Lohnstückkosten im<br />
europäischen Mittelfeld. Trotzdem<br />
bleibt der Experte skeptisch: „Selbst<br />
wenn es gelingen würde, die Nachfra-<br />
gebedingungen zu verbessern, wird die<br />
Ausweitung des Volumens der Erwerbsarbeit<br />
nicht ausreichen, um einen<br />
wesentlichen Teil der heute Arbeitsuchenden<br />
zu integrieren. Mutz forderte<br />
eine Nachfragepolitik, die die Kaufkraft<br />
stärkt und zugleich eine flankierende<br />
Arbeitsmarktpolitik, die auch im<br />
Dritten Sektor und neben der klassischen<br />
Erwerbsarbeit Beschäftigungsfelder<br />
generiert und begünstigt.<br />
Die Arbeitswelt ist seit den 70er Jahren<br />
des vorigen Jahrhunderts einem<br />
enormen Strukturwandel ausgesetzt.<br />
Dazu zählt die Pluralisierung der Erwerbsformen<br />
wie Ich-AGs und Mini-<br />
Jobs. Das Normalarbeitsverhältnis sei<br />
einer ständigen Erosion unterworfen.<br />
Und die Übergänge zwischen Arbeit<br />
und Leben in der Freizeit werden<br />
immer fließender. Eine sinkende Zahl<br />
von Arbeitnehmern weist eine sehr stabile<br />
Beschäftigung auf. Dagegen ist<br />
eine steigende Zahl von Arbeitnehmern<br />
durch Diskontinuität und Instabilität<br />
betroffen. Soziale Unsicherheit nimmt<br />
zu, die Lebensplanung wird ungewisser<br />
und es wird viel mehr gespart. Die<br />
„gefühlte“ Beschäftigungsunsicherheit<br />
und Zukunftsangst nimmt zu – auch bei<br />
denen, die bisher in stabilen Beschäftigungsverhältnissen<br />
waren.<br />
Drehtüreffekt<br />
Die Langzeitarbeitslosigkeit (mehr als<br />
ein Jahr) betrifft etwa ein Drittel aller<br />
Arbeitslosen und hat sich auf hohem<br />
Niveau stabilisiert. Entscheidend <strong>für</strong><br />
diese Gefahr sind die Region, der Wirtschaftszweig<br />
(die Produktion ist mehr<br />
betroffen als die Dienstleistung), die<br />
Qualifikation und das Alter (höher als<br />
50).<br />
Zugleich ist der Arbeitsmarkt hoch flexibel<br />
geworden: „Im Omnibus der Arbeitslosen<br />
sitzen immer 5 Millionen,<br />
aber nie die gleichen. Manche steigen<br />
aus, andere zu.“ Eine zunehmende<br />
Zahl von Beschäftigten ist von einem<br />
„Drehtüreffekt“ betroffen: sie werden<br />
immer häufiger arbeitslos.<br />
�<br />
17