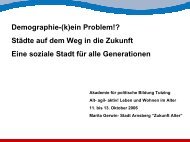3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Regieren mit weniger Geld<br />
Reformpolitik in Zeiten knapper Kassen<br />
„Reformpolitik“ – früher ein Synonym <strong>für</strong> die Ausweitung sozialer<br />
Wohltaten, steht heute vor allem <strong>für</strong> Um- bzw. sogar Abbau des Sozialstaates.<br />
Statt Rentenerhöhung und Ausbau des Gesundheitssystems<br />
heißen die Ziele nun Reduzierung von Staatsverschuldung<br />
und Haushaltssanierung. An die Stelle von Wohltaten treten Zumutungen.<br />
Und der politische Streit dreht sich um die Fragen: Wo soll<br />
gespart werden und wie werden die Lasten gerecht verteilt? Für die<br />
Politiker ergibt sich daraus eine erhebliche kommunikative Herausforderung,<br />
sind sie es doch, die den Bürgerinnen und Bürgern die<br />
Notwendigkeit aller dieser Maßnahmen, die heute und morgen Einschränkung<br />
und Verzicht mit sich bringen, erklären müssen. Mit<br />
diesen Fragen grundsätzlich und anhand konkreter Politikfelder<br />
beschäftigte sich die Tagung „Regieren mit weniger Geld. Reformpolitik<br />
in Zeiten knapper Kassen“.<br />
Einen schonungslosen Blick auf<br />
die Situation in Deutschland<br />
warf Thiess Büttner (LMU und<br />
ifo Institut <strong>für</strong> Wirtschaftsforschung<br />
München). „Jeder“, so Büttner, „der an<br />
staatliches Handeln glaubt, sollte die<br />
Sicherung der Leistungsfähigkeit des<br />
Staates ernst nehmen.“ Diese Leis-<br />
Wirtschaftsforscher Thiess Büttner:<br />
schonungsloser Blick auf Deutschland<br />
Fotos: Schröder/Schwarzm.<br />
tungsfähigkeit sieht der Ökonom<br />
durch die Einengung des finanziellen<br />
Spielraums ernsthaft gefährdet. Seiner<br />
Ansicht nach „sind Schulden kein Mittel<br />
der Finanzierung von Staatsaufgaben“.<br />
Die Verschiebung der Finanzierungslast<br />
auf der Zeitachse – nichts<br />
anderes seien Schulden – werde dann<br />
zum Problem, wenn es nicht gelinge,<br />
„zumindest regelmäßig mit den Primäreinnahmen<br />
die Schulden zu übertreffen.“<br />
(Siehe Diagramm S. 5).<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 3/20<strong>05</strong><br />
Eine differenzierte Betrachtung der<br />
deutschen Bundesländer offenbare<br />
große Unterschiede: Um mittelfristig<br />
einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen<br />
und damit „argentinische Verhältnisse<br />
von teilweiser Zahlungsunfähigkeit“<br />
zu vermeiden, müsste Berlin<br />
beispielsweise die aktuellen Ausgaben<br />
um 25 bis 28 Prozent kürzen, Bayern<br />
um 6,48 Prozent.<br />
Keine Alternative<br />
zum Sparen<br />
Genau dieses Ziel habe die bayerische<br />
Staatsregierung vor Augen mit ihrer<br />
2004 begonnenen Politik des ausgeglichenen<br />
Staatshaushalts ab 2006,<br />
betonte der bayerische Finanzminister<br />
Kurt Faltlhauser. Nur so könne die Investitionsquote<br />
(derzeit 12,5 Prozent),<br />
die „Kennzeichen <strong>für</strong> Beweglichkeit in<br />
einem Haushalt ist“, wieder erhöht<br />
werden (Ziel: 15 Prozent). In der Vergangenheit<br />
wurde nur zu oft – und da<br />
nahm sich Faltlhauser selbst nicht aus<br />
– „die Hand gehoben <strong>für</strong> mehr Verschuldung,<br />
um Verteilungskämpfe zu<br />
vermeiden.“ Zur Sparpolitik gebe es<br />
keine Alternative, betonte Faltlhauser,<br />
und Vorgaben in Gesetzesform stärkten<br />
ihm den Rücken bei den Verhandlungen<br />
mit den Ressortministern. Mit<br />
Nachdruck verwies er darauf, dass die<br />
Aufweichung der Konvergenzkriterien<br />
des EU-Stabilitätspakts den fal-<br />
schen Weg weise. Er warnte eindringlich<br />
davor, dass das Haushaltsproblem<br />
zum Demokratieproblem werden könne,<br />
falls sich die Gestaltungschance der<br />
Politik immer mehr verenge.<br />
Vertrauensverlust<br />
Einen grenzüberschreitenden Blick auf<br />
die Entwicklung der Parteiendemokratien<br />
eröffnete Uwe Jun (Universität<br />
Trier). Generell, so Jun, sei ein Bedeutungsverlust<br />
der großen Volksparteien<br />
auf gesellschaftlicher Ebene zu kon-<br />
Bayerns Finanzminister Kurt Faltlhauser:<br />
Das Haushaltsproblem<br />
kann zum Demokratieproblem<br />
werden.<br />
statieren, wo<strong>für</strong> er drei Gründe ausfindig<br />
machte: Mitgliederrückgang, rückläufige<br />
langfristige Bindungsneigung<br />
der Wähler an Parteien und weniger<br />
national zugeschnittenes programmatisches<br />
Profil. Ebenfalls festzustellen<br />
sei ein grundlegender Vertrauensverlust<br />
in die Fähigkeit von Parteien, Probleme<br />
zu lösen: „Der Allzuständigkeits-<br />
und Allmachtseindruck wird<br />
konterkariert durch begrenzte Handlungsmöglichkeiten.“<br />
<strong>Politische</strong> Parteien,<br />
die angesichts der Staatsverschuldung<br />
massive soziale Einschnitte<br />
umsetzen, müssten sich darüber im<br />
klaren sein, dass sie Gefahr laufen,<br />
nach vier Jahren wieder abgewählt zu<br />
werden. In diesem Sinne gab Jun<br />
Hans-Werner Sinn Recht, der von den<br />
Parteien in der aktuellen Krise den<br />
„Mut zum Untergang“ einforderte.<br />
Unter dem Titel „In der Schuldenfalle<br />
– Rufe aus dem Jammertal“ beschrieb<br />
�<br />
3