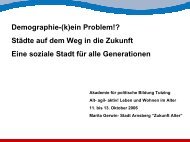3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
3/05 - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auch die Investitionsquoten sehr hoch<br />
gewesen, natürlich bedingt durch die<br />
Zerstörungen. Das Wirtschaftswunder<br />
in Westdeutschland sei durch einen<br />
schnellen Anstieg des Lebensstandards<br />
und die dadurch geförderte baldige<br />
Akzeptanz der Demokratie geprägt<br />
gewesen. All dies sei in der DDR, bedingt<br />
durch die Trägheit des sozialistischen<br />
Systems und der Planwirtschaft,<br />
entweder wesentlich geringer,<br />
teilweise sogar defizitär ausgefallen.<br />
Der entscheidende Anstoß <strong>für</strong> das<br />
Wirtschaftswunder kam durch die Liberalisierung<br />
des Außenhandels der<br />
Bundesrepublik, ihre Rückkehr auf den<br />
Weltmarkt. Das Sozialbudget wuchs<br />
beachtlich – besonders der Anteil der<br />
Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung.<br />
Beamtenversorgung,<br />
Lohnfortzahlung, Kindergeld und Sozialhilfe<br />
stiegen zwar auch, aber nicht<br />
im selben Maße. Heute liege die Sozialquote<br />
bei über einem Drittel und die<br />
Sozialausgaben pro Einwohner bei<br />
rund 7800 Euro. Soziale Marktwirtschaft<br />
sei aber nicht Marktwirtschaft<br />
mit möglichst viel sozialen Ausgaben.<br />
Vielmehr sei von Erhard eine Wettbewerbswirtschaft<br />
gewollt gewesen, die<br />
vom Staat gegen Kartelle und Protektionismus<br />
geschützt werden sollte.<br />
Auflösung bürgerlicher<br />
Ordnung<br />
Konrad Jarausch von der<br />
Universität Potsdam zeigte<br />
den „langen Weg zur<br />
Zivilgesellschaft“ auf.<br />
Nach dem Zerfall der<br />
Wehrmacht, der Auflösung<br />
der NSDAP und dem<br />
Ansturm von entlassenen<br />
Häftlingen, Flüchtlingen<br />
und Zwangsarbeitern löste<br />
sich die bürgerliche<br />
Ordnung in Deutschland<br />
auf. Das Leben kurz vor<br />
und nach Kriegsende sei<br />
durch die Niederlage, Vergewaltigung,<br />
Verlust,<br />
Überlebensfreude, Besatzung,<br />
Befreiung, Tod und<br />
eine atemberaubende physische<br />
und psychische<br />
Zerstörung geprägt gewe-<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 3/20<strong>05</strong><br />
Christoph Buchheim: „Soziale<br />
Marktwirtschaft ist nicht Marktwirtschaft<br />
mit möglichst vielen<br />
sozialen Ausgaben.“<br />
sen. Aus dem Ende habe sich ein Anfang<br />
ergeben. Die KZ-Verbrechen, mit<br />
denen die Besatzungsmächte die Deutschen<br />
konfrontierten, lösten bei ihnen<br />
Unglauben und eine beschleunigte Distanzierung<br />
vom Dritten Reich,<br />
allerdings ohne wirkliche Schuldanerkenntnis<br />
aus. Die Mehrzahl der Deutschen<br />
schob alle Schuld auf Hitler. Bei<br />
den Westalliierten führte der Ende der<br />
40er Jahre einsetzende Kalte Krieg zu<br />
Konrad Jarausch zeigte den langen Weg der<br />
Deutschen zur Zivilgesellschaft auf.<br />
einem raschen und pragmatischen<br />
Wandel in der Behandlung der Deutschen.<br />
Es sei eine widersprüchliche<br />
Zeit zwischen Entnazifizierten, Kriegsgewinnlern,<br />
Wendehälsen, Tätern und<br />
Angepassten gewesen, meinte der Historiker<br />
Jarausch. Deutschland sei vor<br />
1933 eine westliche Demokratie mit<br />
Kant, Beethoven und Goethe gewesen,<br />
dennoch hatte es diesen Rückfall in die<br />
Barbarei, diesen Zivilisationsbruch<br />
gegeben.<br />
Demokratiefähig durch<br />
die Katastrophe<br />
Erst die Katastrophe habe die Deutschen<br />
demokratiefähig gemacht. Der<br />
Demilitarisierung sei eine Pazifizierung,<br />
der Denazifizierung ein Bruch<br />
mit allen Traditionen sowie eine Europäisierung<br />
des Landes und der Demontage<br />
die soziale Marktwirtschaft<br />
gefolgt. Weitere prägende Veränderungen<br />
hätten sich aus der „Westernisierung“<br />
und inneren Demokratisierung<br />
der 60er Jahre ergeben. Lernprozesse<br />
seien nie gradlinig, sie verliefen auch<br />
mal in die falsche Richtung.<br />
Der radikalste Bruch mit der Vergangenheit<br />
habe in der DDR stattgefunden<br />
und sei in eine neue Diktatur gemündet.<br />
Nachdem Deutschland nun<br />
von Freunden umgeben sei, werde die<br />
Verbindung von Demokratie und Nation<br />
schwierig und Europa als Rettung<br />
gesehen. Zu einem neuen Test der Zivilgesellschaft<br />
würden die Themen<br />
Weltoffenheit, Migration, Fremdenfeindlichkeit<br />
und Minderheiten avancieren.<br />
Eine Zivilgesellschaft sei eine<br />
ständige Herausforderung, an der man<br />
arbeiten müsse. �<br />
Andreas von Delhaes<br />
33